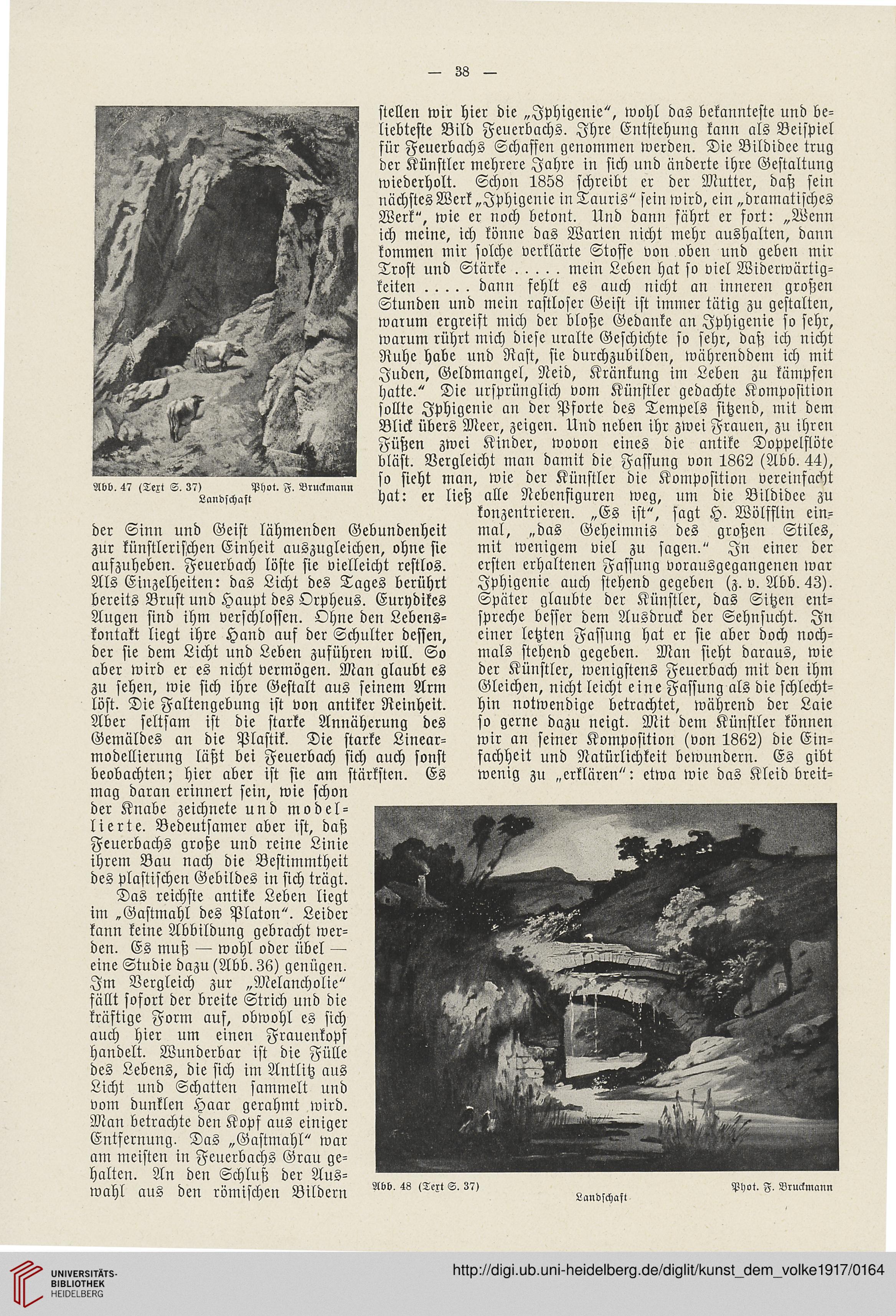38
Abb. 47 (Text S. 37> Pl,ot. F. Bructmann
Landschaft
der Sinn und Geist lähmenden Gebundenheit
zur künstlerischen Einheit auszugleichen, ohne sie
aufzuheben. Feuerbach löste sie vielleicht restlos.
Als Einzelheiten: das Licht des Tages berührt
bereits Brust und Haupt des Orpheus. Eurydikes
Augen sind ihm verschlossen. Ohne den Lebens-
kontakt liegt ihre Hand auf der Schulter dessen,
der sie dem Licht und Leben zuführen will. So
aber wird er es nicht vermögen. Man glaubt es
zu sehen, wie sich ihre Gestalt aus seinem Arm
löst. Die Faltengebung ist von antiker Reinheit.
Aber seltsam ist die starke Annäherung des
Gemäldes an die Plastik. Die starke Linear-
modellierung läßt bei Feuerbach sich auch sonst
beobachten; hier aber ist sie am stärksten. Es
mag daran erinnert sein, wie schon
der Knabe zeichnete und model-
lierte. Bedeutsamer aber ist, daß
Feuerbachs große und reine Linie
ihrem Bau nach die Bestimmtheit
des plastischen Gebildes in sich trägt.
Das reichste antike Leben liegt
im „Gastmahl des Platon". Leider
kann keine Abbildung gebracht wer-
den. Es muß — wohl oder übel —
eine Studie dazu (Abb. 36) genügen.
Jm Vergleich zur „Melancholie"
fällt sofort der breite Strich und die
kräftige Form auf, obwohl es sich
auch hier um einen Frauenkopf
handelt. Wunderbar ist die Fülle
des Lebens, die sich im Antlitz aus
Licht und Schatten sammelt und
vom dunklen Haar gerahmt wird.
Man betrachte den Kops aus einiger
Entfernung. Das „Gastmahl" war
am meisten in Feuerbachs Grau ge-
halten. An den Schluß der Aus-
wahl aus den römischen Bildern
stellen wir hier die „Jphigenie", wohl das bekannteste und be-
liebteste Bild Feuerbachs. Jhre Entstehung kann als Beispiel
für Feuerbachs Schaffen genommen werden. Die Bildidee trug
der Künstler mehrere Jahre in sich und änderte ihre Gestaltung
wiederholt. Schon 1858 schreibt er der Mutter, daß sein
nächstes Werk„Jphigenie in Tauris" sein wird, ein „dramatisches
Werk", wie er noch betont. Und dann fährt er fort: „Wenn
ich meine, ich könne das Warten nicht mehr aushalten, dann
kommen mir solche verklärte Stosfe von oben und geben mir
Trost und Stärke.mein Leben hat so viel Widerwärtig-
keiten.dann fehlt es auch nicht an inneren großen
Stunden und mein rastloser Geist ist immer tätig zu gestalten,
warum ergreift mich der bloße Gedanke an Jphigenie so sehr,
warum rührt mich diese uralte Geschichte so sehr, daß ich nicht
Nuhe habe und Rast, sie durchzubilden, währenddem ich mit
Juden, Geldmangel, Neid, Kränkung im Leben zu kämpfen
hatte." Die ursprünglich vom Künstler gedachte Komposition
sollte Jphigenie an der Pforte des Tempels sitzend, mit dem
Blick übers Meer, zeigen. Und neben ihr zwei Frauen, zu ihren
Füßen zwei Kinder, wovon eines die antike Doppelflöte
bläst. Vergleicht man damit die Fassung von 1862 (Abb. 44),
so sieht man, wie der Künstler die Komposition vereinsacht
hat: er ließ alle Nebenfiguren weg, um die Bildidee zu
konzentrieren. „Es ist", sagt H. Wölfflin ein-
mal, „das Geheimnis des großen Stiles,
mit wenigem viel zu sagen." Jn einer der
ersten erhaltenen Fassung vorausgegangenen war
Jphigenie auch stehend gegeben (z. v. Abb. 43).
Später glaubte der Künstler, das Sitzen ent-
spreche besser dem Ausdruck der Sehnsucht. Jn
einer letzten Fassung hat er sie aber doch noch-
mals stehend gegeben. Man sieht daraus, wie
der Künstler, wenigstens Feuerbach mit den ihm
Gleichen, nicht leicht eine Fassung als die schlecht-
hin notwendige betrachtet, während der Laie
so gerne dazu neigt. Mit dem Künstler können
wir an seiner Komposition (von 1862) die Ein-
fachheit und Natürlichkeit bewundern. Es gibt
wenig zu „erklären": etwa wie das Kleid breit-
Abb. 48 <Text S. 37>
Landschaft
Phot. F. Bruckmann
Abb. 47 (Text S. 37> Pl,ot. F. Bructmann
Landschaft
der Sinn und Geist lähmenden Gebundenheit
zur künstlerischen Einheit auszugleichen, ohne sie
aufzuheben. Feuerbach löste sie vielleicht restlos.
Als Einzelheiten: das Licht des Tages berührt
bereits Brust und Haupt des Orpheus. Eurydikes
Augen sind ihm verschlossen. Ohne den Lebens-
kontakt liegt ihre Hand auf der Schulter dessen,
der sie dem Licht und Leben zuführen will. So
aber wird er es nicht vermögen. Man glaubt es
zu sehen, wie sich ihre Gestalt aus seinem Arm
löst. Die Faltengebung ist von antiker Reinheit.
Aber seltsam ist die starke Annäherung des
Gemäldes an die Plastik. Die starke Linear-
modellierung läßt bei Feuerbach sich auch sonst
beobachten; hier aber ist sie am stärksten. Es
mag daran erinnert sein, wie schon
der Knabe zeichnete und model-
lierte. Bedeutsamer aber ist, daß
Feuerbachs große und reine Linie
ihrem Bau nach die Bestimmtheit
des plastischen Gebildes in sich trägt.
Das reichste antike Leben liegt
im „Gastmahl des Platon". Leider
kann keine Abbildung gebracht wer-
den. Es muß — wohl oder übel —
eine Studie dazu (Abb. 36) genügen.
Jm Vergleich zur „Melancholie"
fällt sofort der breite Strich und die
kräftige Form auf, obwohl es sich
auch hier um einen Frauenkopf
handelt. Wunderbar ist die Fülle
des Lebens, die sich im Antlitz aus
Licht und Schatten sammelt und
vom dunklen Haar gerahmt wird.
Man betrachte den Kops aus einiger
Entfernung. Das „Gastmahl" war
am meisten in Feuerbachs Grau ge-
halten. An den Schluß der Aus-
wahl aus den römischen Bildern
stellen wir hier die „Jphigenie", wohl das bekannteste und be-
liebteste Bild Feuerbachs. Jhre Entstehung kann als Beispiel
für Feuerbachs Schaffen genommen werden. Die Bildidee trug
der Künstler mehrere Jahre in sich und änderte ihre Gestaltung
wiederholt. Schon 1858 schreibt er der Mutter, daß sein
nächstes Werk„Jphigenie in Tauris" sein wird, ein „dramatisches
Werk", wie er noch betont. Und dann fährt er fort: „Wenn
ich meine, ich könne das Warten nicht mehr aushalten, dann
kommen mir solche verklärte Stosfe von oben und geben mir
Trost und Stärke.mein Leben hat so viel Widerwärtig-
keiten.dann fehlt es auch nicht an inneren großen
Stunden und mein rastloser Geist ist immer tätig zu gestalten,
warum ergreift mich der bloße Gedanke an Jphigenie so sehr,
warum rührt mich diese uralte Geschichte so sehr, daß ich nicht
Nuhe habe und Rast, sie durchzubilden, währenddem ich mit
Juden, Geldmangel, Neid, Kränkung im Leben zu kämpfen
hatte." Die ursprünglich vom Künstler gedachte Komposition
sollte Jphigenie an der Pforte des Tempels sitzend, mit dem
Blick übers Meer, zeigen. Und neben ihr zwei Frauen, zu ihren
Füßen zwei Kinder, wovon eines die antike Doppelflöte
bläst. Vergleicht man damit die Fassung von 1862 (Abb. 44),
so sieht man, wie der Künstler die Komposition vereinsacht
hat: er ließ alle Nebenfiguren weg, um die Bildidee zu
konzentrieren. „Es ist", sagt H. Wölfflin ein-
mal, „das Geheimnis des großen Stiles,
mit wenigem viel zu sagen." Jn einer der
ersten erhaltenen Fassung vorausgegangenen war
Jphigenie auch stehend gegeben (z. v. Abb. 43).
Später glaubte der Künstler, das Sitzen ent-
spreche besser dem Ausdruck der Sehnsucht. Jn
einer letzten Fassung hat er sie aber doch noch-
mals stehend gegeben. Man sieht daraus, wie
der Künstler, wenigstens Feuerbach mit den ihm
Gleichen, nicht leicht eine Fassung als die schlecht-
hin notwendige betrachtet, während der Laie
so gerne dazu neigt. Mit dem Künstler können
wir an seiner Komposition (von 1862) die Ein-
fachheit und Natürlichkeit bewundern. Es gibt
wenig zu „erklären": etwa wie das Kleid breit-
Abb. 48 <Text S. 37>
Landschaft
Phot. F. Bruckmann