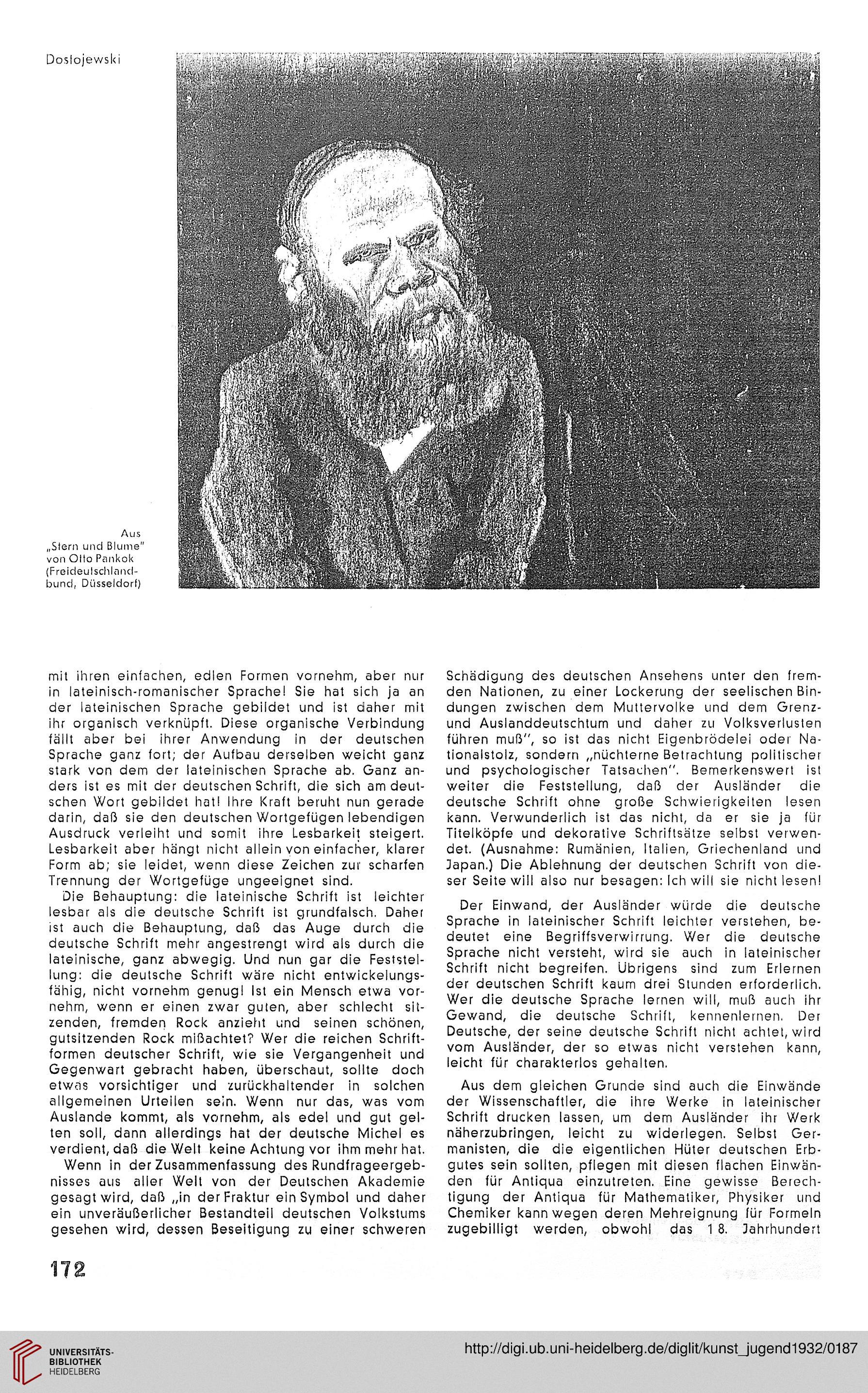Dostojewski
Aus
„Stern und Blume"
von Otto Pankok
(Freideulschland-
bund, Düsseldorf)
mit ihren einfachen, edlen Formen vornehm, aber nur
in lateinisch-romanischer Sprachel Sie hat sich ja an
der lateinischen Sprache gebildet und ist daher mit
ihr organisch verknüpft. Diese organische Verbindung
fällt aber bei ihrer Anwendung in der deutschen
Sprache ganz fort; der Aufbau derselben weicht ganz
stark von dem der lateinischen Sprache ab. Ganz an-
ders ist es mit der deutschen Schrift, die sich am deut-
schen Wort gebildet hat! Ihre Kraft beruht nun gerade
darin, daß sie den deutschen Wortgefügen lebendigen
Ausdruck verleiht und somit ihre Lesbarkeit steigert.
Lesbarkeit aber hängt nicht allein von einfacher, klarer
Form ab; sie leidet, wenn diese Zeichen zur scharfen
Trennung der Wortgefüge ungeeignet sind.
Die Behauptung: die lateinische Schrift ist leichter
lesbar als die deutsche Schrift ist grundfalsch. Daher
ist auch die Behauptung, daß das Auge durch die
deutsche Schrift mehr angestrengt wird als durch die
lateinische, ganz abwegig. Und nun gar die Feststel-
lung: die deutsche Schrift wäre nicht entwickelungs-
fähig, nicht vornehm genugl ist ein Mensch etwa vor-
nehm, wenn er einen zwar guten, aber schlecht sit-
zenden, fremden Rock anzieht und seinen schönen,
gutsitzenden Rock mißachtet? Wer die reichen Schrift-
formen deutscher Schrift, wie sie Vergangenheit und
Gegenwart gebracht haben, überschaut, sollte doch
etwas vorsichtiger und zurückhaltender in solchen
allgemeinen Urteilen sein. Wenn nur das, was vom
Auslande kommt, als vornehm, als edel und gut gel-
ten soll, dann allerdings hat der deutsche Michel es
verdient, daß die Welt keine Achtung vor ihm mehr hat.
Wenn in der Zusammenfassung des Rundfrageergeb-
nisses aus aller Welt von der Deutschen Akademie
gesagt wird, daß „in der Fraktur ein Symbol und daher
ein unveräußerlicher Bestandteil deutschen Volkstums
gesehen wird, dessen Beseitigung zu einer schweren
Schädigung des deutschen Ansehens unter den frem-
den Nationen, zu einer Lockerung der seelischen Bin-
dungen zwischen dem Muttervolke und dem Grenz-
und Auslanddeutschtum und daher zu Volksverlusten
führen muß'', so ist das nicht Eigenbrödelei oder Na-
tionalstolz, sondern „nüchterne Betrachtung politischer
und psychologischer Tatsachen''. Bemerkenswert ist
weiter die Feststellung, daß der Ausländer die
deutsche Schrift ohne große Schwierigkeiten lesen
kann. Verwunderlich ist das nicht, da er sie ja für
Titelköpfe und dekorative Schriftsätze selbst verwen-
det. (Ausnahme: Rumänien, Italien, Griechenland und
Japan.) Die Ablehnung der deutschen Schrift von die-
ser Seite will also nur besagen: Ich will sie nicht lesen!
Der Einwand, der Ausländer würde die deutsche
Sprache in lateinischer Schrift leichter verstehen, be-
deutet eine Begriffsverwirrung. Wer die deutsche
Sprache nicht versteht, wird sie auch in lateinischer
Schrift nicht begreifen. Übrigens sind zum Erlernen
der deutschen Schrift kaum drei Stunden erforderlich.
Wer die deutsche Sprache lernen will, muß auch ihr
Gewand, die deutsche Schrift, kennenlernen. Der
Deutsche, der seine deutsche Schrift nicht achtet, wird
vom Ausländer, der so etwas nicht verstehen kann,
leicht für charakterlos gehalten.
Aus dem gleichen Grunde sind auch die Einwände
der Wissenschaftler, die ihre Werke in lateinischer
Schrift drucken lassen, um dem Ausländer ihr Werk
näherzubringen, leicht zu widerlegen. Selbst Ger-
manisten, die die eigentlichen Hüter deutschen Erb-
gutes sein sollten, pflegen mit diesen flachen Einwän-
den für Antiqua einzutreten. Eine gewisse Berech-
tigung der Antiqua für Mathematiker, Physiker und
Chemiker kann wegen deren Mehreignung für Formeln
zugebilligt werden, obwohl das 1 8. Jahrhundert
172
Aus
„Stern und Blume"
von Otto Pankok
(Freideulschland-
bund, Düsseldorf)
mit ihren einfachen, edlen Formen vornehm, aber nur
in lateinisch-romanischer Sprachel Sie hat sich ja an
der lateinischen Sprache gebildet und ist daher mit
ihr organisch verknüpft. Diese organische Verbindung
fällt aber bei ihrer Anwendung in der deutschen
Sprache ganz fort; der Aufbau derselben weicht ganz
stark von dem der lateinischen Sprache ab. Ganz an-
ders ist es mit der deutschen Schrift, die sich am deut-
schen Wort gebildet hat! Ihre Kraft beruht nun gerade
darin, daß sie den deutschen Wortgefügen lebendigen
Ausdruck verleiht und somit ihre Lesbarkeit steigert.
Lesbarkeit aber hängt nicht allein von einfacher, klarer
Form ab; sie leidet, wenn diese Zeichen zur scharfen
Trennung der Wortgefüge ungeeignet sind.
Die Behauptung: die lateinische Schrift ist leichter
lesbar als die deutsche Schrift ist grundfalsch. Daher
ist auch die Behauptung, daß das Auge durch die
deutsche Schrift mehr angestrengt wird als durch die
lateinische, ganz abwegig. Und nun gar die Feststel-
lung: die deutsche Schrift wäre nicht entwickelungs-
fähig, nicht vornehm genugl ist ein Mensch etwa vor-
nehm, wenn er einen zwar guten, aber schlecht sit-
zenden, fremden Rock anzieht und seinen schönen,
gutsitzenden Rock mißachtet? Wer die reichen Schrift-
formen deutscher Schrift, wie sie Vergangenheit und
Gegenwart gebracht haben, überschaut, sollte doch
etwas vorsichtiger und zurückhaltender in solchen
allgemeinen Urteilen sein. Wenn nur das, was vom
Auslande kommt, als vornehm, als edel und gut gel-
ten soll, dann allerdings hat der deutsche Michel es
verdient, daß die Welt keine Achtung vor ihm mehr hat.
Wenn in der Zusammenfassung des Rundfrageergeb-
nisses aus aller Welt von der Deutschen Akademie
gesagt wird, daß „in der Fraktur ein Symbol und daher
ein unveräußerlicher Bestandteil deutschen Volkstums
gesehen wird, dessen Beseitigung zu einer schweren
Schädigung des deutschen Ansehens unter den frem-
den Nationen, zu einer Lockerung der seelischen Bin-
dungen zwischen dem Muttervolke und dem Grenz-
und Auslanddeutschtum und daher zu Volksverlusten
führen muß'', so ist das nicht Eigenbrödelei oder Na-
tionalstolz, sondern „nüchterne Betrachtung politischer
und psychologischer Tatsachen''. Bemerkenswert ist
weiter die Feststellung, daß der Ausländer die
deutsche Schrift ohne große Schwierigkeiten lesen
kann. Verwunderlich ist das nicht, da er sie ja für
Titelköpfe und dekorative Schriftsätze selbst verwen-
det. (Ausnahme: Rumänien, Italien, Griechenland und
Japan.) Die Ablehnung der deutschen Schrift von die-
ser Seite will also nur besagen: Ich will sie nicht lesen!
Der Einwand, der Ausländer würde die deutsche
Sprache in lateinischer Schrift leichter verstehen, be-
deutet eine Begriffsverwirrung. Wer die deutsche
Sprache nicht versteht, wird sie auch in lateinischer
Schrift nicht begreifen. Übrigens sind zum Erlernen
der deutschen Schrift kaum drei Stunden erforderlich.
Wer die deutsche Sprache lernen will, muß auch ihr
Gewand, die deutsche Schrift, kennenlernen. Der
Deutsche, der seine deutsche Schrift nicht achtet, wird
vom Ausländer, der so etwas nicht verstehen kann,
leicht für charakterlos gehalten.
Aus dem gleichen Grunde sind auch die Einwände
der Wissenschaftler, die ihre Werke in lateinischer
Schrift drucken lassen, um dem Ausländer ihr Werk
näherzubringen, leicht zu widerlegen. Selbst Ger-
manisten, die die eigentlichen Hüter deutschen Erb-
gutes sein sollten, pflegen mit diesen flachen Einwän-
den für Antiqua einzutreten. Eine gewisse Berech-
tigung der Antiqua für Mathematiker, Physiker und
Chemiker kann wegen deren Mehreignung für Formeln
zugebilligt werden, obwohl das 1 8. Jahrhundert
172