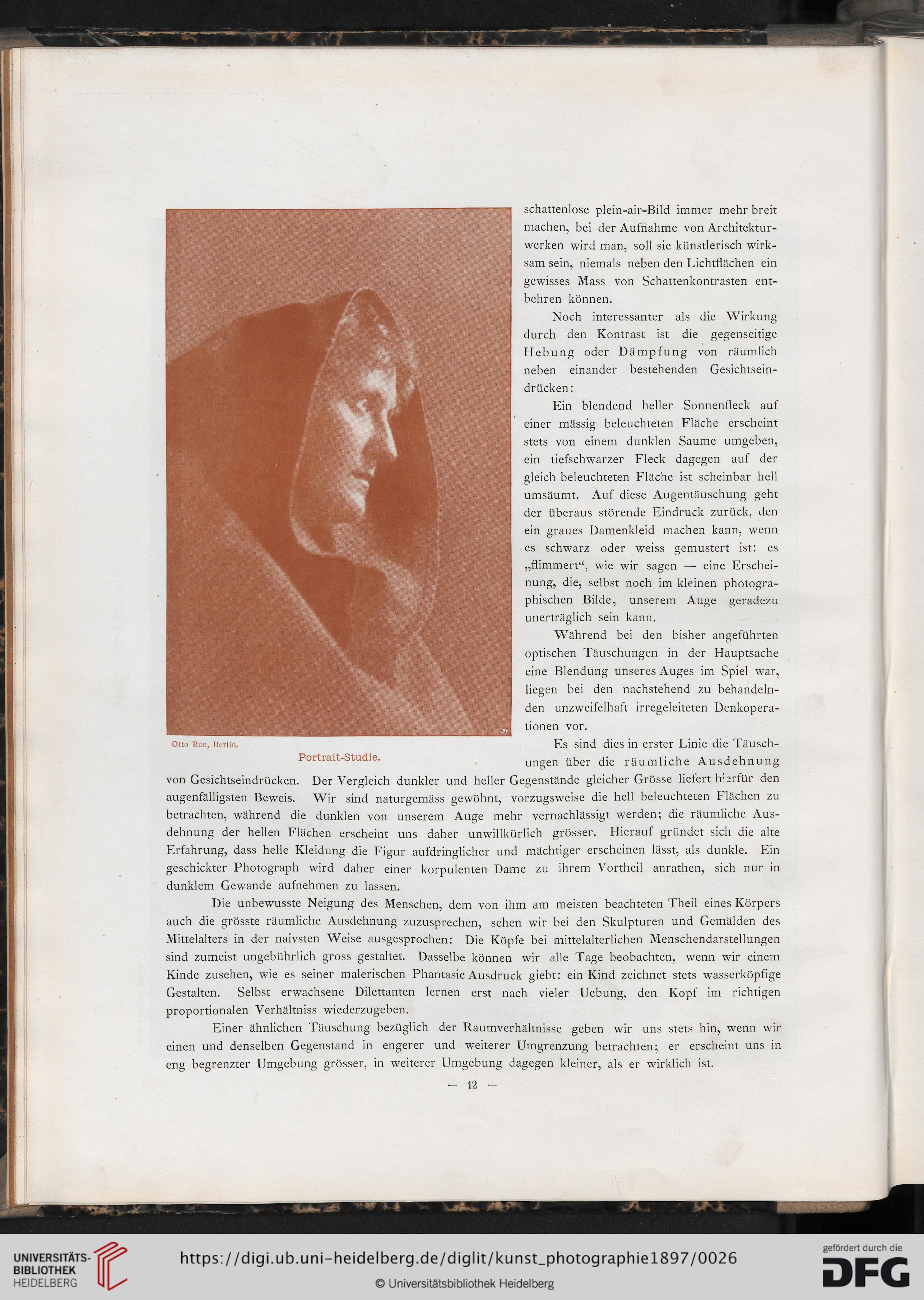schattenlose plein-air-Bild immer mehr breit
machen, bei der Aufnahme von Architektur-
werken wird man, soll sie künstlerisch wirk-
sam sein, niemals neben den Lichtflächen ein
gewisses Mass von Schattenkontrasten ent-
behren können.
Noch interessanter als die Wirkung
durch den Kontrast ist die gegenseitige
Hebung oder Dämpfung von räumlich
neben einander bestehenden Gesichtsein-
drücken:
Ein blendend heller Sonnenfleck auf
einer mässig beleuchteten Fläche erscheint
stets von einem dunklen Saume umgeben,
ein tiefschwarzer Fleck dagegen auf der
gleich beleuchteten Fläche ist scheinbar hell
umsäumt. Auf diese Augentäuschung geht
der überaus störende Eindruck zurück, den
ein graues Damenkleid machen kann, wenn
es schwarz oder weiss gemustert ist: es
„flimmert“, wie wir sagen — eine Erschei-
nung, die, selbst noch im kleinen photogra-
phischen Bilde, unserem Auge geradezu
unerträglich sein kann.
Während bei den bisher angeführten
optischen Täuschungen in der Hauptsache
eine Blendung unseres Auges im Spiel war,
liegen bei den nachstehend zu behandeln-
den unzweifelhaft irregeleiteten Denkopera-
tionen vor.
Es sind dies in erster Linie die Täusch-
ungen über die räumliche Ausdehnung
von Gesichtseindrücken. Der Vergleich dunkler und heller Gegenstände gleicher Grösse liefert hierfür den
augenfälligsten Beweis. Wir sind naturgemäss gewöhnt, vorzugsweise die hell beleuchteten Flächen zu
betrachten, während die dunklen von unserem Auge mehr vernachlässigt werden; die räumliche Aus-
dehnung der hellen Flächen erscheint uns daher unwillkürlich grösser. Hierauf gründet sich die alte
Erfahrung, dass helle Kleidung die Figur aufdringlicher und mächtiger erscheinen lässt, als dunkle. Ein
geschickter Photograph wird daher einer korpulenten Dame zu ihrem Vortheil anrathen, sich nur in
dunklem Gewände aufnehmen zu lassen.
Die unbewusste Neigung des Menschen, dem von ihm am meisten beachteten Theil eines Körpers
auch die grösste räumliche Ausdehnung zuzusprechen, sehen wir bei den Skulpturen und Gemälden des
Mittelalters in der naivsten Weise ausgesprochen: Die Köpfe bei mittelalterlichen Menschendarstellungen
sind zumeist ungebührlich gross gestaltet. Dasselbe können wir alle Tage beobachten, wenn wir einem
Kinde Zusehen, wie es seiner malerischen Phantasie Ausdruck giebt: ein Kind zeichnet stets wasserköpfige
Gestalten. Selbst erwachsene Dilettanten lernen erst nach vieler Uebung, den Kopf im richtigen
proportionalen Verhältniss wiederzugeben.
Einer ähnlichen Täuschung bezüglich der Raumverhältnisse geben wir uns stets hin, wenn wir
einen und denselben Gegenstand in engerer und weiterer Umgrenzung betrachten; er erscheint uns in
eng begrenzter Umgebung grösser, in weiterer Umgebung dagegen kleiner, als er wirklich ist.
12
machen, bei der Aufnahme von Architektur-
werken wird man, soll sie künstlerisch wirk-
sam sein, niemals neben den Lichtflächen ein
gewisses Mass von Schattenkontrasten ent-
behren können.
Noch interessanter als die Wirkung
durch den Kontrast ist die gegenseitige
Hebung oder Dämpfung von räumlich
neben einander bestehenden Gesichtsein-
drücken:
Ein blendend heller Sonnenfleck auf
einer mässig beleuchteten Fläche erscheint
stets von einem dunklen Saume umgeben,
ein tiefschwarzer Fleck dagegen auf der
gleich beleuchteten Fläche ist scheinbar hell
umsäumt. Auf diese Augentäuschung geht
der überaus störende Eindruck zurück, den
ein graues Damenkleid machen kann, wenn
es schwarz oder weiss gemustert ist: es
„flimmert“, wie wir sagen — eine Erschei-
nung, die, selbst noch im kleinen photogra-
phischen Bilde, unserem Auge geradezu
unerträglich sein kann.
Während bei den bisher angeführten
optischen Täuschungen in der Hauptsache
eine Blendung unseres Auges im Spiel war,
liegen bei den nachstehend zu behandeln-
den unzweifelhaft irregeleiteten Denkopera-
tionen vor.
Es sind dies in erster Linie die Täusch-
ungen über die räumliche Ausdehnung
von Gesichtseindrücken. Der Vergleich dunkler und heller Gegenstände gleicher Grösse liefert hierfür den
augenfälligsten Beweis. Wir sind naturgemäss gewöhnt, vorzugsweise die hell beleuchteten Flächen zu
betrachten, während die dunklen von unserem Auge mehr vernachlässigt werden; die räumliche Aus-
dehnung der hellen Flächen erscheint uns daher unwillkürlich grösser. Hierauf gründet sich die alte
Erfahrung, dass helle Kleidung die Figur aufdringlicher und mächtiger erscheinen lässt, als dunkle. Ein
geschickter Photograph wird daher einer korpulenten Dame zu ihrem Vortheil anrathen, sich nur in
dunklem Gewände aufnehmen zu lassen.
Die unbewusste Neigung des Menschen, dem von ihm am meisten beachteten Theil eines Körpers
auch die grösste räumliche Ausdehnung zuzusprechen, sehen wir bei den Skulpturen und Gemälden des
Mittelalters in der naivsten Weise ausgesprochen: Die Köpfe bei mittelalterlichen Menschendarstellungen
sind zumeist ungebührlich gross gestaltet. Dasselbe können wir alle Tage beobachten, wenn wir einem
Kinde Zusehen, wie es seiner malerischen Phantasie Ausdruck giebt: ein Kind zeichnet stets wasserköpfige
Gestalten. Selbst erwachsene Dilettanten lernen erst nach vieler Uebung, den Kopf im richtigen
proportionalen Verhältniss wiederzugeben.
Einer ähnlichen Täuschung bezüglich der Raumverhältnisse geben wir uns stets hin, wenn wir
einen und denselben Gegenstand in engerer und weiterer Umgrenzung betrachten; er erscheint uns in
eng begrenzter Umgebung grösser, in weiterer Umgebung dagegen kleiner, als er wirklich ist.
12