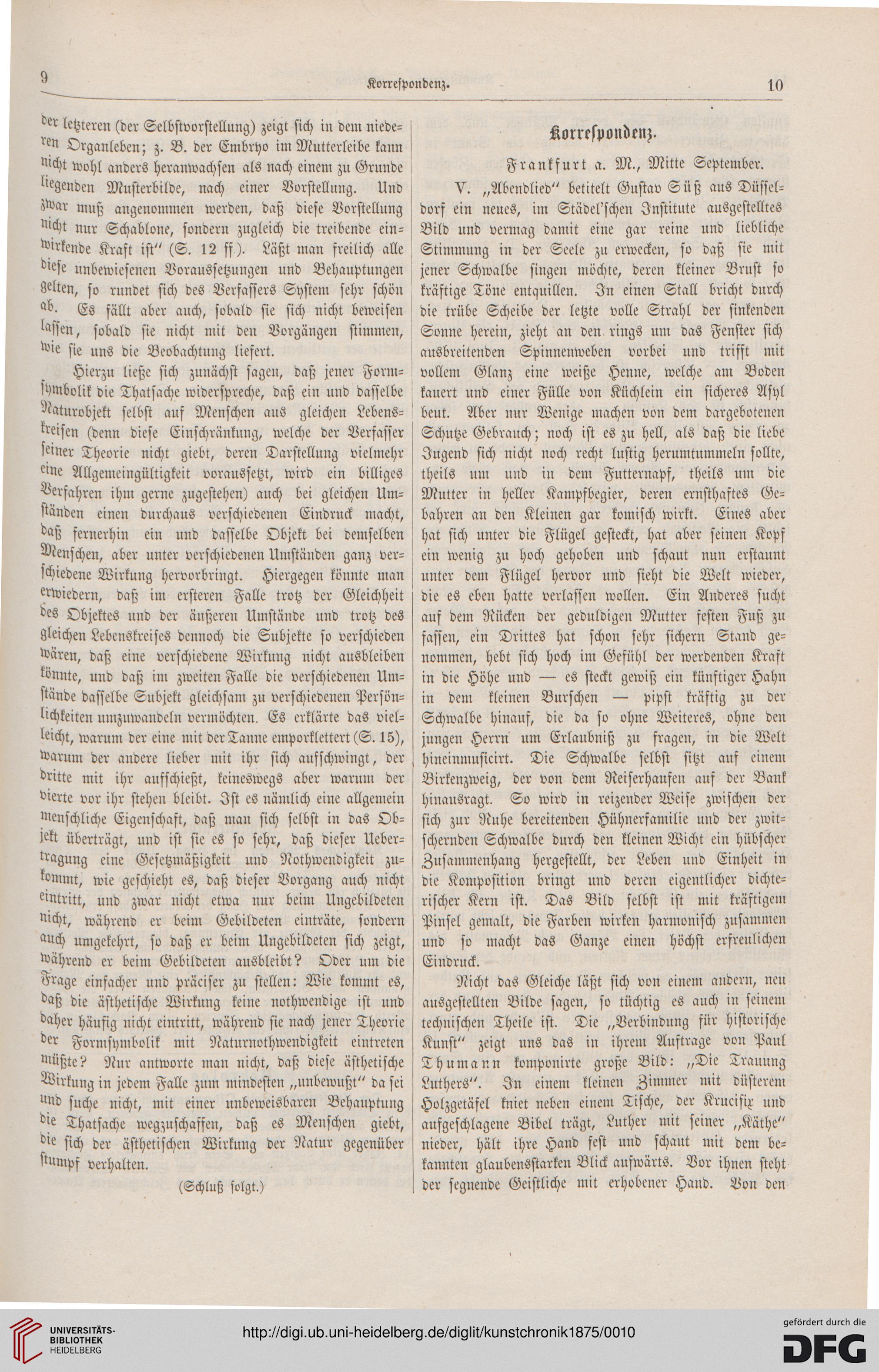9
Korrespondenz.
1»
Korrrspoildkiy.
letzteren (der Selbstvorstellung) zeigt sich in dem niede-
Organleben; z. B. der Embryo im Mutterleibe kann
">cht wohl anders heranwachsen als nach einem zu Grunde
^genden Musterbilde, nach einer Vorstellung. Und
Mar muß angenommen werden, daß diese Vorstellung
^^cht nur Schablone, sondern zugleich die treibende ein-
^'rkende Kraft ist" (S. 12 ff ). Läßt man freilich alle
^rse nnbewiesenen Voraussetzungen und Behauptungen
gelten, so rundet sich des Verfassers System sehr schön
ob. Eg sällt aber auch, sobald sie sich nicht beweisen
chssm, sobald sie nicht mit den Vorgängen stimmen,
sie uns die Beobachtung liefert.
Hierzu ließe sich zunächst sagen, daß jener Form-
shmbolik die Thatsache widerspreche, daß ein und dasselbe
^aturobjekt selbst auf Menschen aus gleichen Lebens-
^reisen (denn diese Einschränkung, welche der Verfasser
seiner Theorie nicht giebt, deren Darstellung vielmehr
eme Allgemeingültigkeit voraussetzt, wird ein billiges
^erfahren ihm gerne zugestehen) auch bei gleichen Um-
ständen einen durchaus verschiedenen Eindruck macht,
baß fernerhin ein und dasselbe Objekt bei demselben
^enschen, aber unter verschiedenen Umständen ganz ver-
schiedene Wirkung hervorbringt. Hiergegen könnte man
erwiedern, daß im ersteren Falle trotz der Gleichheit
bes Objektes und der äußeren Umstände und trotz des
gieichen Lebenskreises dcnnoch die Subjekte so verschieden
^vären, daß eine verschiedene Wirkung nicht ausbleiben
kvnnte, und daß im zweiten Falle die verschiedenen Um-
stände dasselbe Subjekt gleichsam zu verschiedenen Persön-
tichkeiten umzuwandeln vermöchten. Es erklärte das viel-
tvicht, warum der eine mit derTanne emporklettert (S. 15),
tvarum der andere lieber mit ihr sich aufschwingt, der
dritte mit ihr aufschießt, keineswegs aber warum der
vierte vor ihr stehen bleibt. Jst es nämlich eine allgemein
Menschliche Eigenschaft, daß man sich selbst in das Ob-
M überträgt, und ist sie es so sehr, daß dieser Ueber-
tragung eine Gesetzmäßigkeit und Nothwendigkeit zu-
kvinmt, wie geschieht es, daß dieser Vorgang auch nicht
kMtritt, und zwar nicht etwa nur beim Ungebildeten
v>cht, während er beim Gebildeten einträte, sondern
auch umgekehrt, so daß er beim Ungebildeten sich zeigt,
Mährend er beim Gebildeten ausbleibt? Oder um die
Trage einfacher und präciser zu stellen: Wie kommt es,
daß die ästhetische Wirkung keine nothwendige ist und
vaher häufig nicht eintritt, währeud sie nach jener Theorie
^rr Formsymbolik mit Naturnothwendigkeit eintreten
luüßte? Nur antworte man nicht, daß diese ästhetische
Wirkung in jedem Falle zum mindesten „unbewußt" da sei
vud suche nicht, mit einer unbeweisbaren Behauptung
Thatsache wegzuschaffen, daß es Menschen giebt,
^ sich der ästhetischen Wirkung der Natur gegenüber
stuinpf verhalten.
Frankfurt a. M., Mitte September.
V. „Abeudlied" bctitelt Gustav Süß aus Dllssel-
dorf ein neues, im Städel'schen Jnstitute ausgestelltes
Bild und vermag damit eine gar reine und liebliche
Stimmung in der Seele zu erwecken, so daß sie mit
jener Schwalbe singen möchle, deren kleiner Brust so
kräftige Töne entquillen. Jn einen Stall bricht dnrch
die trübe Scheibe der letzte volle Strahl der sinkenden
Sonne herein, zieht an ven rings um das Fenster sich
ausbreitenden Spinnenweben vorbei und trifft mit
vollcm Glanz eine weiße Henne, welche am Boden
kaucrt nnv eiuer Fülle von Küchlein ein sicheres Asyl
beut. Aber nur Wenige machen von dem dargebotenen
Schutze Gebrauch; noch ist es zu hell, als daß die liebe
Jugend sich nicht noch recht lustig herumtummeln sollte,
theils um und in dem Futternapf, theils um die
Mutter in heller Kampfbegier, deren ernsthaftes Ge-
bahren an den Kleinen gar komisch wirkt. Eines aber
hat sich unter die Flügel gesteckt, hat aber seinen Kopf
ein wenig zu hoch gehoben und schaut nun erstaunt
unter deni Fliigel hervor und sieht die Welt wieder,
die es eben hatte verlassen wollen. Ein Anderes sucht
auf dem Rücken der geduldigen Mutter festen Fuß zu
fassen, ein Drittes hat schon schr sichern Stand ge-
nommen, hebt sich hoch im Gefühl der werdenden Kraft
in die Höhe und — es steckt gewiß ein künftiger Hahn
iu dem kleinen Burschen — pipst kräftig zu der
Schwalbe hinauf, die da so ohne Weiteres, ohne den
jungen Herrn um Erlaubniß zu fragen, in die Welt
hineinmusicirt. Die Schwalbe selbst sitzt auf einem
Birkenzweig, der von dem Reiserhaufen auf der Bank
hinausragt. So wird in reizender Weise zwischen der
sich zur Nuhe bereitenden Hühnerfamilie und der zwit-
schernden Schwalbe durch den kleinen Wicht ein hübscher
Ziisammenhang hergestellt, der Leben und Einheit in
die Komposition bringt und deren eigentlicher dichte-
rischer Kern ist. Das Bild sclbst ist mit kräfttgem
Pinsel gemalt, die Farben wirken harmonisch zusammen
und so macht das Ganze einen höchst erfreulichen
Eindruck.
Nicht das Gleiche läßt sich von einem andern, neu
ausgestellten Bilde sagen, so tüchtig es auch in seinem
technischen Theile ist. Die „Berbinduiig für historische
Kunst" zeigt uns das in ihrem Auftrage von Paul
Thumann komponirte große Bild: „Die Trauung
Luthers". Jn eincm kleinen Zimmer mit düstercm
Hvlzgetäfel kniet neben eiucm Tische, der Krucifix uud
aufgeschlagene Bibel trägt, Luther mit seiner „Käthe"
niedcr, hält ihrc Hand fest uud schaut mit dem bc-
kanntcn glaubensstarkcn Blick aufwärts. Vor ihnen stcht
der segnende Geistliche mit erhobener Hand. Von den
(Schluß solgt.)
Korrespondenz.
1»
Korrrspoildkiy.
letzteren (der Selbstvorstellung) zeigt sich in dem niede-
Organleben; z. B. der Embryo im Mutterleibe kann
">cht wohl anders heranwachsen als nach einem zu Grunde
^genden Musterbilde, nach einer Vorstellung. Und
Mar muß angenommen werden, daß diese Vorstellung
^^cht nur Schablone, sondern zugleich die treibende ein-
^'rkende Kraft ist" (S. 12 ff ). Läßt man freilich alle
^rse nnbewiesenen Voraussetzungen und Behauptungen
gelten, so rundet sich des Verfassers System sehr schön
ob. Eg sällt aber auch, sobald sie sich nicht beweisen
chssm, sobald sie nicht mit den Vorgängen stimmen,
sie uns die Beobachtung liefert.
Hierzu ließe sich zunächst sagen, daß jener Form-
shmbolik die Thatsache widerspreche, daß ein und dasselbe
^aturobjekt selbst auf Menschen aus gleichen Lebens-
^reisen (denn diese Einschränkung, welche der Verfasser
seiner Theorie nicht giebt, deren Darstellung vielmehr
eme Allgemeingültigkeit voraussetzt, wird ein billiges
^erfahren ihm gerne zugestehen) auch bei gleichen Um-
ständen einen durchaus verschiedenen Eindruck macht,
baß fernerhin ein und dasselbe Objekt bei demselben
^enschen, aber unter verschiedenen Umständen ganz ver-
schiedene Wirkung hervorbringt. Hiergegen könnte man
erwiedern, daß im ersteren Falle trotz der Gleichheit
bes Objektes und der äußeren Umstände und trotz des
gieichen Lebenskreises dcnnoch die Subjekte so verschieden
^vären, daß eine verschiedene Wirkung nicht ausbleiben
kvnnte, und daß im zweiten Falle die verschiedenen Um-
stände dasselbe Subjekt gleichsam zu verschiedenen Persön-
tichkeiten umzuwandeln vermöchten. Es erklärte das viel-
tvicht, warum der eine mit derTanne emporklettert (S. 15),
tvarum der andere lieber mit ihr sich aufschwingt, der
dritte mit ihr aufschießt, keineswegs aber warum der
vierte vor ihr stehen bleibt. Jst es nämlich eine allgemein
Menschliche Eigenschaft, daß man sich selbst in das Ob-
M überträgt, und ist sie es so sehr, daß dieser Ueber-
tragung eine Gesetzmäßigkeit und Nothwendigkeit zu-
kvinmt, wie geschieht es, daß dieser Vorgang auch nicht
kMtritt, und zwar nicht etwa nur beim Ungebildeten
v>cht, während er beim Gebildeten einträte, sondern
auch umgekehrt, so daß er beim Ungebildeten sich zeigt,
Mährend er beim Gebildeten ausbleibt? Oder um die
Trage einfacher und präciser zu stellen: Wie kommt es,
daß die ästhetische Wirkung keine nothwendige ist und
vaher häufig nicht eintritt, währeud sie nach jener Theorie
^rr Formsymbolik mit Naturnothwendigkeit eintreten
luüßte? Nur antworte man nicht, daß diese ästhetische
Wirkung in jedem Falle zum mindesten „unbewußt" da sei
vud suche nicht, mit einer unbeweisbaren Behauptung
Thatsache wegzuschaffen, daß es Menschen giebt,
^ sich der ästhetischen Wirkung der Natur gegenüber
stuinpf verhalten.
Frankfurt a. M., Mitte September.
V. „Abeudlied" bctitelt Gustav Süß aus Dllssel-
dorf ein neues, im Städel'schen Jnstitute ausgestelltes
Bild und vermag damit eine gar reine und liebliche
Stimmung in der Seele zu erwecken, so daß sie mit
jener Schwalbe singen möchle, deren kleiner Brust so
kräftige Töne entquillen. Jn einen Stall bricht dnrch
die trübe Scheibe der letzte volle Strahl der sinkenden
Sonne herein, zieht an ven rings um das Fenster sich
ausbreitenden Spinnenweben vorbei und trifft mit
vollcm Glanz eine weiße Henne, welche am Boden
kaucrt nnv eiuer Fülle von Küchlein ein sicheres Asyl
beut. Aber nur Wenige machen von dem dargebotenen
Schutze Gebrauch; noch ist es zu hell, als daß die liebe
Jugend sich nicht noch recht lustig herumtummeln sollte,
theils um und in dem Futternapf, theils um die
Mutter in heller Kampfbegier, deren ernsthaftes Ge-
bahren an den Kleinen gar komisch wirkt. Eines aber
hat sich unter die Flügel gesteckt, hat aber seinen Kopf
ein wenig zu hoch gehoben und schaut nun erstaunt
unter deni Fliigel hervor und sieht die Welt wieder,
die es eben hatte verlassen wollen. Ein Anderes sucht
auf dem Rücken der geduldigen Mutter festen Fuß zu
fassen, ein Drittes hat schon schr sichern Stand ge-
nommen, hebt sich hoch im Gefühl der werdenden Kraft
in die Höhe und — es steckt gewiß ein künftiger Hahn
iu dem kleinen Burschen — pipst kräftig zu der
Schwalbe hinauf, die da so ohne Weiteres, ohne den
jungen Herrn um Erlaubniß zu fragen, in die Welt
hineinmusicirt. Die Schwalbe selbst sitzt auf einem
Birkenzweig, der von dem Reiserhaufen auf der Bank
hinausragt. So wird in reizender Weise zwischen der
sich zur Nuhe bereitenden Hühnerfamilie und der zwit-
schernden Schwalbe durch den kleinen Wicht ein hübscher
Ziisammenhang hergestellt, der Leben und Einheit in
die Komposition bringt und deren eigentlicher dichte-
rischer Kern ist. Das Bild sclbst ist mit kräfttgem
Pinsel gemalt, die Farben wirken harmonisch zusammen
und so macht das Ganze einen höchst erfreulichen
Eindruck.
Nicht das Gleiche läßt sich von einem andern, neu
ausgestellten Bilde sagen, so tüchtig es auch in seinem
technischen Theile ist. Die „Berbinduiig für historische
Kunst" zeigt uns das in ihrem Auftrage von Paul
Thumann komponirte große Bild: „Die Trauung
Luthers". Jn eincm kleinen Zimmer mit düstercm
Hvlzgetäfel kniet neben eiucm Tische, der Krucifix uud
aufgeschlagene Bibel trägt, Luther mit seiner „Käthe"
niedcr, hält ihrc Hand fest uud schaut mit dem bc-
kanntcn glaubensstarkcn Blick aufwärts. Vor ihnen stcht
der segnende Geistliche mit erhobener Hand. Von den
(Schluß solgt.)