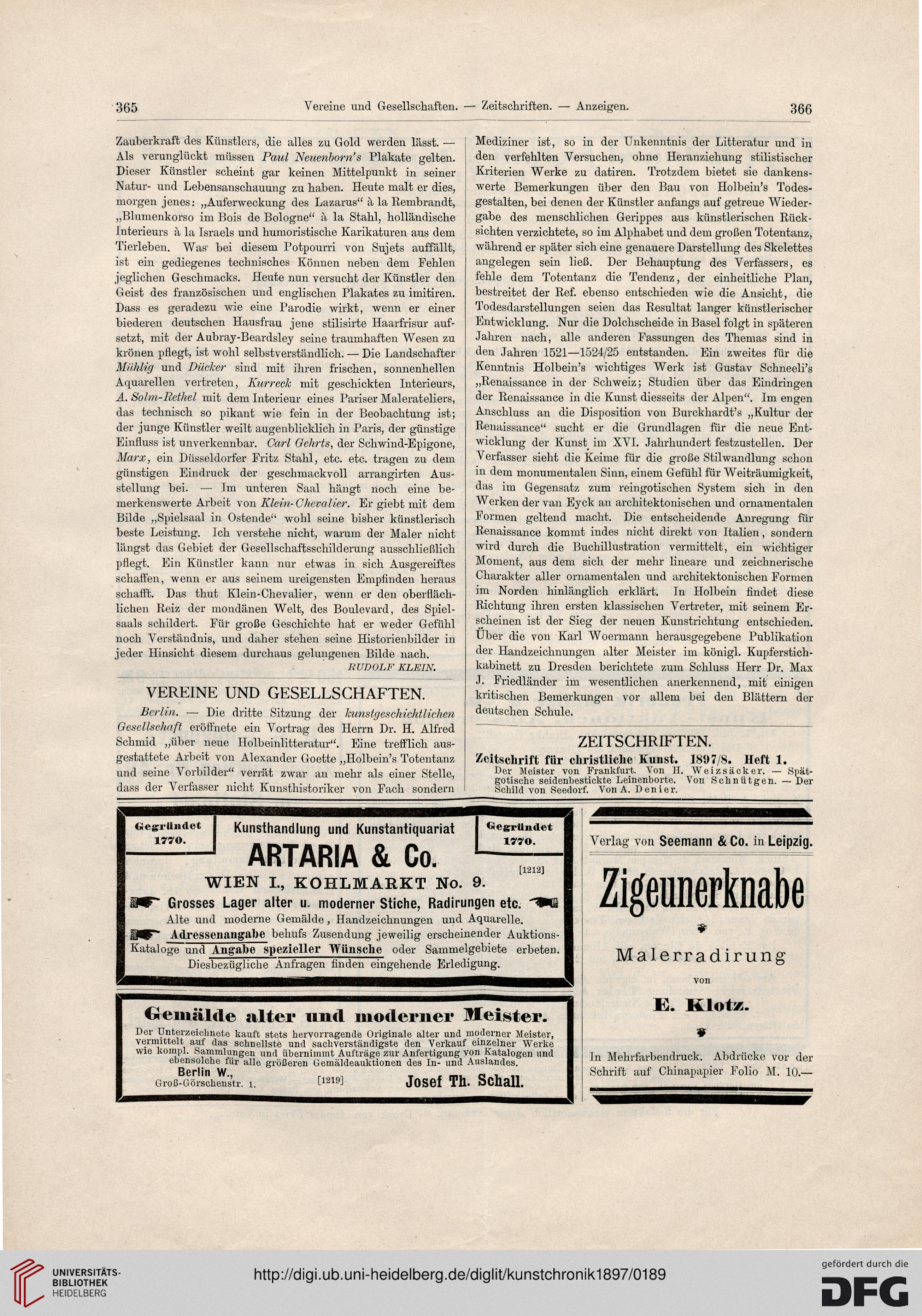365
366
Zauberkraft des Künstlers, die alles zu Gold werden lässt. —
Als verunglückt müssen Paul Neuenhorn's Plakate gelten.
Dieser Künstler scheint gar keinen Mittelpunkt in seiner
Natur- und Lebensanschauung zu haben. Heute malt er dies,
morgen jenes: „Auferweckung des Lazarus" ä la Hembrandt,
„Blumenkorso im Bois de Bologne" ä la Stahl, holländische
Interieurs ä la Israels und humoristische Karikaturen aus dem
Tierleben. Was' bei diesem Potpourri von Sujets auffällt,
ist ein gediegenes technisches Können neben dem Fehlen
jeglichen Geschmacks. Heute nun versucht der Künstler den
Geist des französischen und englischen Plakates zu imitiren.
Dass es geradezu wie eine Parodie wirkt, wenn er einer
biederen deutschon Hausfrau jene stilisirte Haarfrisur auf-
setzt, mit der Aübray-Beardslcy seine traumhaften Wesen zu
krönen pflegt, ist wohl selbstverständlich. — Die Landschafter
MüfUig und DUchcr sind mit ihren frischen, sonnenhellen
Aquarellen vertreten, Kurreck mit geschickten Interieurs,
A. Sülm-Bethel mit dem Interieur eines Pariser Malerateliers,
das technisch so pikant wie fein in der Beobachtung ist;
der junge Künstler weilt augenblicklich in Paris, der günstige
Kinfluss ist unverkennbar. Carl Ochrts, der Schwind-Epigone,
Marx, ein Düsseldorfer Fritz Stahl, etc. etc. tragen zu dem
günstigen Eindruck der geschmackvoll arrangirten Aus-
stellung bei. — Im unteren Saal hängt noch eine be-
merkenswerte Arbeit von Klein- Chevalier. Er giebt mit dem
Bilde „Spielsaal in Ostende" wohl seine bisher künstlerisch
beste Leistung. Ich verstehe nicht, warum der Maler nicht
längst das Gebiet der Gesellschaftsschilderung ausschließlich
pflegt. Ein Künstler kann nur etwas in sich Ausgereiftes
schaffen, wenn er aus seinem ureigensten Empfinden heraus
schafft. Das thut Klein-Chevalier, wenn er den oberfläch-
lichen Reiz der mondänen Welt, des Boulevard, des Spiel-
saals schildert. Für große Geschichte hat er weder Gefühl
noch Verständnis, und daher stehen seine Historienbilder in
jeder Hinsicht diesem durchaus gelungenen Bilde nach.
RUDOLF KLEIN.
VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.
Berlin. — Die dritte Sitzung der hinstyeschichtlichen
Gesellschaft eröffnete ein Vortrag des Herrn Dr. H. Alfred
Schmid „über neue Holbeinlitteratur". Eine trefflich aus-
gestattete Arbeit von Alexander Goette „Holboin's Totentanz
und seine Vorbilder" verrät zwar an mehr als einer Stelle,
dass der Verfasser nicht Kunsthistoriker von Fach sondern
Mediziner ist, so in der Unkenntnis der Litteratur und in
den verfehlten Versuchen, ohne Heranziehung stilistischer
Kriterien Werke zu datiren. Trotzdem bietet sie dankens-
werte Bemerkungen über den Bau von Holbein's Todes-
gestalten, bei denen der Künstler anfangs auf getreue Wieder-
gabe des menschlichen Gerippes aus künstlerischen Rück-
sichten verzichtete, so im Alphabet und dem großen Totentanz,
während er später sich eine genauere Darstellung des Skelettes
angelegen sein ließ. Der Behauptung des Verfassers, es
fehle dem Totentanz die Tendenz, der einheitliche Plan,
bestreitet der Ref. ebenso entschieden wie die Ansicht, die
Todesdarstellungen seien das Resultat langer künstlerischer
Entwicklung. Nur die Dolchscheide in Basel folgt in späteren
Jahren nach, alle anderen Fassungen des Themas sind in
den Jahren 1521—1524/25 entstanden. Ein zweites für die
Kenntnis Holbein's wichtiges Werk ist Gustav Sehneeli's
„Renaissance in der Schweiz; Studien über das Eindringen
der Renaissance in die Kunst diesseits der Alpen". Im engen
Anschluss an die Disposition von Burckhardt's „Kultur der
Renaissance" sucht er die Grundlagen für die neue Ent-
wicklung der Kunst im XVI. Jahrhundert festzustellen. Der
Verfasser sieht die Keime für die große Stilwandlung schon
in dem monumentalen Sinn, einem Gefühl für Weiträumigkeit,
das im Gegensatz zum reingotischen System sich in den
Werken der van Eyck an architektonischen und ornamentalen
Formen geltend macht. Die entscheidende Anregung für
Renaissance kommt indes nicht direkt von Italien, sondern
wird durch die Buchillustration vermittelt, ein wichtiger
Moment, aus dem sich der mehr lineare und zeichnerische
Charakter aller ornamentalen und architektonischen Formen
im Norden hinlänglich erklärt. In Holbein findet diese
Richtung ihren ersten klassischen Vertreter, mit seinem Er-
scheinen ist der Sieg der neuen Kunstrichtung entschieden.
Über die von Karl Woermann herausgegebene Publikation
der Handzeichnungen alter Meister im königl. Kupferstich-
kabinett zu Dresden berichtete zum Schluss Herr Dr. Max
J. Friedländer im wesentlichen anerkennend, mit einigen
kritischen Bemerkungen vor allem bei den Blättern der
deutschen Schule.
ZEITSCHRIFTEN.
Zeitschrift für christliche Kunst. 185)7/8. Heft 1.
Der Meister von Frankfurt. Von H. Weizsäcker. — Spät-
gotische seidenbestickte Leinenborte. Von Schnütgen. — Der
Schild von Seedorf. Von A. Denier.
Gegründet
1770.
Kunsthandlung und Kunstantiquariat
ARTARIA & Co.
Gegründet
1770.
[1212]
WIEN L, KOHL MARKT No. 9.
Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc. "»12
Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle.
Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender Auktions-
Kataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten.
Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung.
Gemälde alter und moderner Meister.
Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister,
vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke
wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und
ebensolche für alle größereu liemäldeauktionen des In- und Auslandes.
Berlin W.,
üroß-Görschenstr.
[1219]
Josef Th. Schall.
Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.
Zigeunerknabe
*
Malerradirung
von
E. Klotz.
In Mehrfarbendruck. Abdrücke vor der
Schrift auf Chinapapier Folio M. 10.—
366
Zauberkraft des Künstlers, die alles zu Gold werden lässt. —
Als verunglückt müssen Paul Neuenhorn's Plakate gelten.
Dieser Künstler scheint gar keinen Mittelpunkt in seiner
Natur- und Lebensanschauung zu haben. Heute malt er dies,
morgen jenes: „Auferweckung des Lazarus" ä la Hembrandt,
„Blumenkorso im Bois de Bologne" ä la Stahl, holländische
Interieurs ä la Israels und humoristische Karikaturen aus dem
Tierleben. Was' bei diesem Potpourri von Sujets auffällt,
ist ein gediegenes technisches Können neben dem Fehlen
jeglichen Geschmacks. Heute nun versucht der Künstler den
Geist des französischen und englischen Plakates zu imitiren.
Dass es geradezu wie eine Parodie wirkt, wenn er einer
biederen deutschon Hausfrau jene stilisirte Haarfrisur auf-
setzt, mit der Aübray-Beardslcy seine traumhaften Wesen zu
krönen pflegt, ist wohl selbstverständlich. — Die Landschafter
MüfUig und DUchcr sind mit ihren frischen, sonnenhellen
Aquarellen vertreten, Kurreck mit geschickten Interieurs,
A. Sülm-Bethel mit dem Interieur eines Pariser Malerateliers,
das technisch so pikant wie fein in der Beobachtung ist;
der junge Künstler weilt augenblicklich in Paris, der günstige
Kinfluss ist unverkennbar. Carl Ochrts, der Schwind-Epigone,
Marx, ein Düsseldorfer Fritz Stahl, etc. etc. tragen zu dem
günstigen Eindruck der geschmackvoll arrangirten Aus-
stellung bei. — Im unteren Saal hängt noch eine be-
merkenswerte Arbeit von Klein- Chevalier. Er giebt mit dem
Bilde „Spielsaal in Ostende" wohl seine bisher künstlerisch
beste Leistung. Ich verstehe nicht, warum der Maler nicht
längst das Gebiet der Gesellschaftsschilderung ausschließlich
pflegt. Ein Künstler kann nur etwas in sich Ausgereiftes
schaffen, wenn er aus seinem ureigensten Empfinden heraus
schafft. Das thut Klein-Chevalier, wenn er den oberfläch-
lichen Reiz der mondänen Welt, des Boulevard, des Spiel-
saals schildert. Für große Geschichte hat er weder Gefühl
noch Verständnis, und daher stehen seine Historienbilder in
jeder Hinsicht diesem durchaus gelungenen Bilde nach.
RUDOLF KLEIN.
VEREINE UND GESELLSCHAFTEN.
Berlin. — Die dritte Sitzung der hinstyeschichtlichen
Gesellschaft eröffnete ein Vortrag des Herrn Dr. H. Alfred
Schmid „über neue Holbeinlitteratur". Eine trefflich aus-
gestattete Arbeit von Alexander Goette „Holboin's Totentanz
und seine Vorbilder" verrät zwar an mehr als einer Stelle,
dass der Verfasser nicht Kunsthistoriker von Fach sondern
Mediziner ist, so in der Unkenntnis der Litteratur und in
den verfehlten Versuchen, ohne Heranziehung stilistischer
Kriterien Werke zu datiren. Trotzdem bietet sie dankens-
werte Bemerkungen über den Bau von Holbein's Todes-
gestalten, bei denen der Künstler anfangs auf getreue Wieder-
gabe des menschlichen Gerippes aus künstlerischen Rück-
sichten verzichtete, so im Alphabet und dem großen Totentanz,
während er später sich eine genauere Darstellung des Skelettes
angelegen sein ließ. Der Behauptung des Verfassers, es
fehle dem Totentanz die Tendenz, der einheitliche Plan,
bestreitet der Ref. ebenso entschieden wie die Ansicht, die
Todesdarstellungen seien das Resultat langer künstlerischer
Entwicklung. Nur die Dolchscheide in Basel folgt in späteren
Jahren nach, alle anderen Fassungen des Themas sind in
den Jahren 1521—1524/25 entstanden. Ein zweites für die
Kenntnis Holbein's wichtiges Werk ist Gustav Sehneeli's
„Renaissance in der Schweiz; Studien über das Eindringen
der Renaissance in die Kunst diesseits der Alpen". Im engen
Anschluss an die Disposition von Burckhardt's „Kultur der
Renaissance" sucht er die Grundlagen für die neue Ent-
wicklung der Kunst im XVI. Jahrhundert festzustellen. Der
Verfasser sieht die Keime für die große Stilwandlung schon
in dem monumentalen Sinn, einem Gefühl für Weiträumigkeit,
das im Gegensatz zum reingotischen System sich in den
Werken der van Eyck an architektonischen und ornamentalen
Formen geltend macht. Die entscheidende Anregung für
Renaissance kommt indes nicht direkt von Italien, sondern
wird durch die Buchillustration vermittelt, ein wichtiger
Moment, aus dem sich der mehr lineare und zeichnerische
Charakter aller ornamentalen und architektonischen Formen
im Norden hinlänglich erklärt. In Holbein findet diese
Richtung ihren ersten klassischen Vertreter, mit seinem Er-
scheinen ist der Sieg der neuen Kunstrichtung entschieden.
Über die von Karl Woermann herausgegebene Publikation
der Handzeichnungen alter Meister im königl. Kupferstich-
kabinett zu Dresden berichtete zum Schluss Herr Dr. Max
J. Friedländer im wesentlichen anerkennend, mit einigen
kritischen Bemerkungen vor allem bei den Blättern der
deutschen Schule.
ZEITSCHRIFTEN.
Zeitschrift für christliche Kunst. 185)7/8. Heft 1.
Der Meister von Frankfurt. Von H. Weizsäcker. — Spät-
gotische seidenbestickte Leinenborte. Von Schnütgen. — Der
Schild von Seedorf. Von A. Denier.
Gegründet
1770.
Kunsthandlung und Kunstantiquariat
ARTARIA & Co.
Gegründet
1770.
[1212]
WIEN L, KOHL MARKT No. 9.
Grosses Lager alter u. moderner Stiche, Radirungen etc. "»12
Alte und moderne Gemälde, Handzeichnungen und Aquarelle.
Adressenangabe behufs Zusendung jeweilig erscheinender Auktions-
Kataloge und Angabe spezieller Wünsche oder Sammelgebiete erbeten.
Diesbezügliche Anfragen finden eingehende Erledigung.
Gemälde alter und moderner Meister.
Der Unterzeichnete kauft stets hervorragende Originale alter und moderner Meister,
vermittelt auf das schnellste und sachverständigste den Verkauf einzelner Werke
wie kompl. Sammlungen und übernimmt Aufträge zur Anfertigung von Katalogen und
ebensolche für alle größereu liemäldeauktionen des In- und Auslandes.
Berlin W.,
üroß-Görschenstr.
[1219]
Josef Th. Schall.
Verlag von Seemann & Co. in Leipzig.
Zigeunerknabe
*
Malerradirung
von
E. Klotz.
In Mehrfarbendruck. Abdrücke vor der
Schrift auf Chinapapier Folio M. 10.—