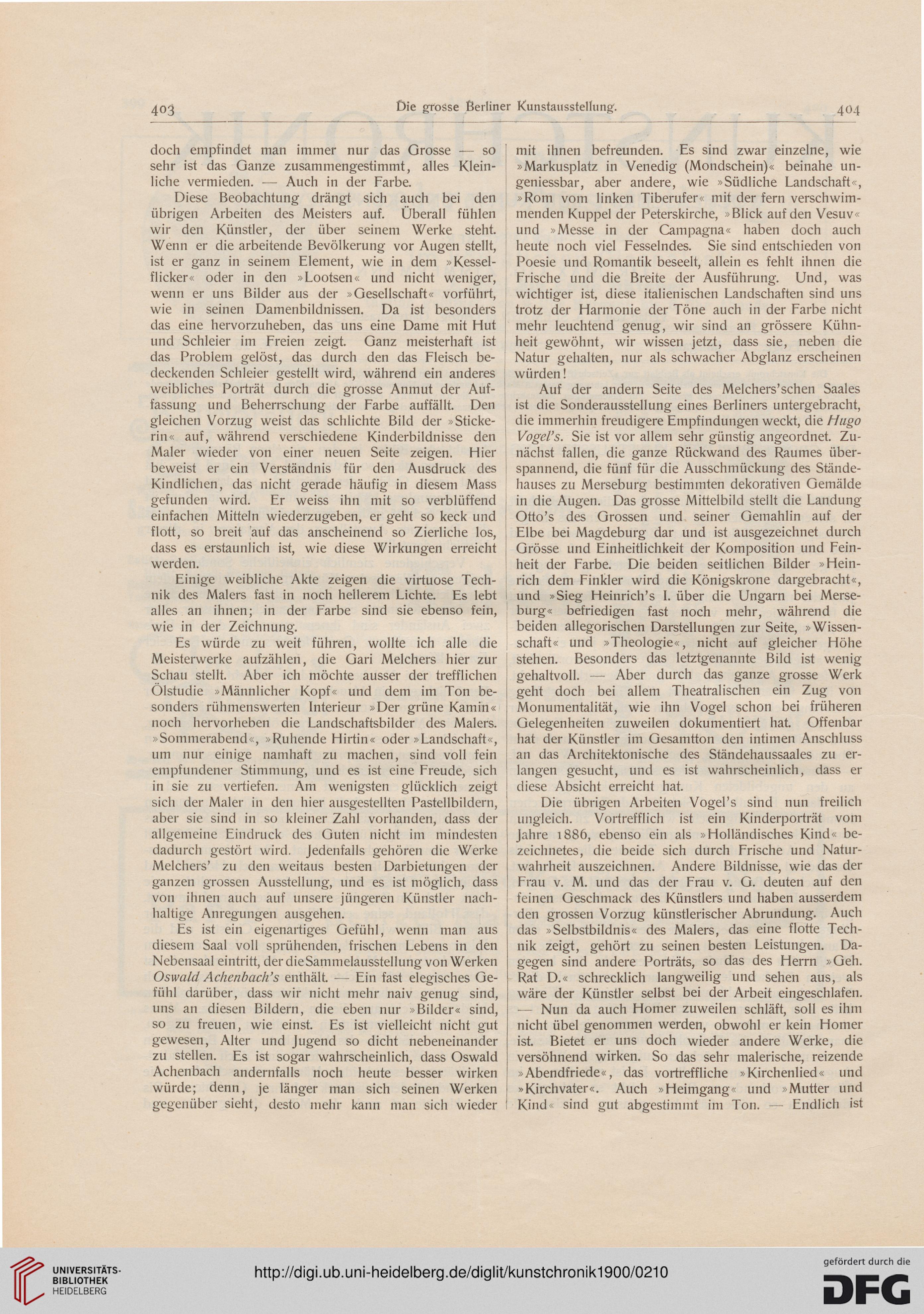403
Die grosse Berliner Kunstausstellung;.
404
doch empfindet man immer nur das Grosse — so
sehr ist das Ganze zusammengestimmt, alles Klein-
liche vermieden. — Auch in der Farbe.
Diese Beobachtung drängt sich auch bei den
übrigen Arbeiten des Meisters auf. Überall fühlen
wir den Künstler, der über seinem Werke steht.
Wenn er die arbeitende Bevölkerung vor Augen stellt,
ist er ganz in seinem Element, wie in dem »Kessel-
flicker« oder in den »Lootsen« und nicht weniger,
wenn er uns Bilder aus der »Gesellschaft« vorführt,
wie in seinen Damenbildnissen. Da ist besonders
das eine hervorzuheben, das uns eine Dame mit Hut
und Schleier im Freien zeigt. Ganz meisterhaft ist
das Problem gelöst, das durch den das Fleisch be-
deckenden Schleier gestellt wird, während ein anderes
weibliches Porträt durch die grosse Anmut der Auf-
fassung und Beherrschung der Farbe auffällt. Den
gleichen Vorzug weist das schlichte Bild der »Sticke-
rin« auf, während verschiedene Kinderbildnisse den
Maler wieder von einer neuen Seite zeigen. Hier
beweist er ein Verständnis für den Ausdruck des
Kindlichen, das nicht gerade häufig in diesem Mass
gefunden wird. Er weiss ihn mit so verblüffend
einfachen Mitteln wiederzugeben, er geht so keck und
flott, so breit auf das anscheinend so Zierliche los,
dass es erstaunlich ist, wie diese Wirkungen erreicht
werden.
Einige weibliche Akte zeigen die virtuose Tech-
nik des Malers fast in noch hellerem Lichte. Es lebt
alles an ihnen; in der Farbe sind sie ebenso fein,
wie in der Zeichnung.
Es würde zu weit führen, wollte ich alle die
Meisterwerke aufzählen, die Gari Melchers hier zur
Schau stellt. Aber ich möchte ausser der trefflichen
Ölstudie »Männlicher Kopf« und dem im Ton be-
sonders rühmenswerten Interieur »Der grüne Kamin«
noch hervorheben die Landschaftsbilder des Malers.
»Sommerabend«, »Ruhende Hirtin« oder »Landschaft«,
um nur einige namhaft zu machen, sind voll fein
empfundener Stimmung, und es ist eine Freude, sich
in sie zu vertiefen. Am wenigsten glücklich zeigt
sich der Maler in den hier ausgestellten Pastellbildern,
aber sie sind in so kleiner Zahl vorhanden, dass der
allgemeine Eindruck des Guten nicht im mindesten
dadurch gestört wird. Jedenfalls gehören die Werke
Melchers' zu den weitaus besten Darbietungen der
ganzen grossen Ausstellung, und es ist möglich, dass
von ihnen auch auf unsere jüngeren Künstler nach-
haltige Anregungen ausgehen.
Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man aus
diesem Saal voll sprühenden, frischen Lebens in den
Nebensaal eintritt, derdieSammelausstellung von Werken
Oswald Achenbach's enthält. — Ein fast elegisches Ge-
fühl darüber, dass wir nicht mehr naiv genug sind,
uns an diesen Bildern, die eben nur »Bilder« sind,
so zu freuen, wie einst. Es ist vielleicht nicht gut
gewesen, Alter und Jugend so dicht nebeneinander
zu stellen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass Oswald
Achenbach andernfalls noch heute besser wirken
würde; denn, je länger man sich seinen Werken
gegenüber sieht, desto mehr kann man sich wieder
mit ihnen befreunden. Es sind zwar einzelne, wie
»Markusplatz in Venedig (Mondschein)« beinahe un-
geniessbar, aber andere, wie »Südliche Landschaft«,
»Rom vom linken Tiberufer« mit der fern verschwim-
, menden Kuppel der Peterskirche, »Blick auf den Vesuv«
und »Messe in der Campagna« haben doch auch
heute noch viel Fesselndes. Sie sind entschieden von
; Poesie und Romantik beseelt, allein es fehlt ihnen die
Frische und die Breite der Ausführung. Und, was
wichtiger ist, diese italienischen Landschaften sind uns
trotz der Harmonie der Töne auch in der Farbe nicht
mehr leuchtend genug, wir sind an grössere Kühn-
heit gewöhnt, wir wissen jetzt, dass sie, neben die
Natur gehalten, nur als schwacher Abglanz erscheinen
würden!
Auf der andern Seite des Melchers'schen Saales
ist die Sonderausstellung eines Berliners untergebracht,
die immerhin freudigere Empfindungen weckt, die Hugo
Vogel's. Sie ist vor allem sehr günstig angeordnet. Zu-
nächst fallen, die ganze Rückwand des Raumes über-
spannend, die fünf für die Ausschmückung des Stände-
hauses zu Merseburg bestimmten dekorativen Gemälde
i in die Augen. Das grosse Mittelbild stellt die Landung
Otto's des Grossen und seiner Gemahlin auf der
Elbe bei Magdeburg dar und ist ausgezeichnet durch
Grösse und Einheitlichkeit der Komposition und Fein-
heit der Farbe. Die beiden seitlichen Bilder »Hein-
rich dem Finkler wird die Königskrone dargebracht«,
I und »Sieg Heinrich's 1. über die Ungarn bei Merse-
burg« befriedigen fast noch mehr, während die
beiden allegorischen Darstellungen zur Seite, »Wissen-
schaft« und »Theologie«, nicht auf gleicher Höhe
stehen. Besonders das letztgenannte Bild ist wenig
gehaltvoll. — Aber durch das ganze grosse Werk
geht doch bei allem Theatralischen ein Zug von
Monumentalität, wie ihn Vogel schon bei früheren
Gelegenheiten zuweilen dokumentiert hat. Offenbar
hat der Künstler im Gesamtton den intimen Anschluss
an das Architektonische des Ständehaussaales zu er-
langen gesucht, und es ist wahrscheinlich, dass er
diese Absicht erreicht hat.
Die übrigen Arbeiten Vogel's sind nun freilich
ungleich. Vortrefflich ist ein Kinderporträt vom
Jahre 1886, ebenso ein als »Holländisches Kind« be-
zeichnetes, die beide sich durch Frische und Natur-
wahrheit auszeichnen. Andere Bildnisse, wie das der
Frau v. M. und das der Frau v. G. deuten auf den
feinen Geschmack des Künstlers und haben ausserdem
den grossen Vorzug künstlerischer Abrundung. Auch
das »Selbstbildnis« des Malers, das eine flotte Tech-
nik zeigt, gehört zu seinen besten Leistungen. Da-
gegen sind andere Porträts, so das des Herrn »Geh.
Rat D.« schrecklich langweilig und sehen aus, als
wäre der Künstler selbst bei der Arbeit eingeschlafen.
— Nun da auch Homer zuweilen schläft, soll es ihm
nicht übel genommen werden, obwohl er kein Homer
ist. Bietet er uns doch wieder andere Werke, die
versöhnend wirken. So das sehr malerische, reizende
»Abendfriede«, das vortreffliche »Kirchenlied« und
»Kirchvater«. Auch »Heimgang« und »Mutter und
I Kind« sind gut abgestimmt im Ton. — Endlich ist
Die grosse Berliner Kunstausstellung;.
404
doch empfindet man immer nur das Grosse — so
sehr ist das Ganze zusammengestimmt, alles Klein-
liche vermieden. — Auch in der Farbe.
Diese Beobachtung drängt sich auch bei den
übrigen Arbeiten des Meisters auf. Überall fühlen
wir den Künstler, der über seinem Werke steht.
Wenn er die arbeitende Bevölkerung vor Augen stellt,
ist er ganz in seinem Element, wie in dem »Kessel-
flicker« oder in den »Lootsen« und nicht weniger,
wenn er uns Bilder aus der »Gesellschaft« vorführt,
wie in seinen Damenbildnissen. Da ist besonders
das eine hervorzuheben, das uns eine Dame mit Hut
und Schleier im Freien zeigt. Ganz meisterhaft ist
das Problem gelöst, das durch den das Fleisch be-
deckenden Schleier gestellt wird, während ein anderes
weibliches Porträt durch die grosse Anmut der Auf-
fassung und Beherrschung der Farbe auffällt. Den
gleichen Vorzug weist das schlichte Bild der »Sticke-
rin« auf, während verschiedene Kinderbildnisse den
Maler wieder von einer neuen Seite zeigen. Hier
beweist er ein Verständnis für den Ausdruck des
Kindlichen, das nicht gerade häufig in diesem Mass
gefunden wird. Er weiss ihn mit so verblüffend
einfachen Mitteln wiederzugeben, er geht so keck und
flott, so breit auf das anscheinend so Zierliche los,
dass es erstaunlich ist, wie diese Wirkungen erreicht
werden.
Einige weibliche Akte zeigen die virtuose Tech-
nik des Malers fast in noch hellerem Lichte. Es lebt
alles an ihnen; in der Farbe sind sie ebenso fein,
wie in der Zeichnung.
Es würde zu weit führen, wollte ich alle die
Meisterwerke aufzählen, die Gari Melchers hier zur
Schau stellt. Aber ich möchte ausser der trefflichen
Ölstudie »Männlicher Kopf« und dem im Ton be-
sonders rühmenswerten Interieur »Der grüne Kamin«
noch hervorheben die Landschaftsbilder des Malers.
»Sommerabend«, »Ruhende Hirtin« oder »Landschaft«,
um nur einige namhaft zu machen, sind voll fein
empfundener Stimmung, und es ist eine Freude, sich
in sie zu vertiefen. Am wenigsten glücklich zeigt
sich der Maler in den hier ausgestellten Pastellbildern,
aber sie sind in so kleiner Zahl vorhanden, dass der
allgemeine Eindruck des Guten nicht im mindesten
dadurch gestört wird. Jedenfalls gehören die Werke
Melchers' zu den weitaus besten Darbietungen der
ganzen grossen Ausstellung, und es ist möglich, dass
von ihnen auch auf unsere jüngeren Künstler nach-
haltige Anregungen ausgehen.
Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man aus
diesem Saal voll sprühenden, frischen Lebens in den
Nebensaal eintritt, derdieSammelausstellung von Werken
Oswald Achenbach's enthält. — Ein fast elegisches Ge-
fühl darüber, dass wir nicht mehr naiv genug sind,
uns an diesen Bildern, die eben nur »Bilder« sind,
so zu freuen, wie einst. Es ist vielleicht nicht gut
gewesen, Alter und Jugend so dicht nebeneinander
zu stellen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass Oswald
Achenbach andernfalls noch heute besser wirken
würde; denn, je länger man sich seinen Werken
gegenüber sieht, desto mehr kann man sich wieder
mit ihnen befreunden. Es sind zwar einzelne, wie
»Markusplatz in Venedig (Mondschein)« beinahe un-
geniessbar, aber andere, wie »Südliche Landschaft«,
»Rom vom linken Tiberufer« mit der fern verschwim-
, menden Kuppel der Peterskirche, »Blick auf den Vesuv«
und »Messe in der Campagna« haben doch auch
heute noch viel Fesselndes. Sie sind entschieden von
; Poesie und Romantik beseelt, allein es fehlt ihnen die
Frische und die Breite der Ausführung. Und, was
wichtiger ist, diese italienischen Landschaften sind uns
trotz der Harmonie der Töne auch in der Farbe nicht
mehr leuchtend genug, wir sind an grössere Kühn-
heit gewöhnt, wir wissen jetzt, dass sie, neben die
Natur gehalten, nur als schwacher Abglanz erscheinen
würden!
Auf der andern Seite des Melchers'schen Saales
ist die Sonderausstellung eines Berliners untergebracht,
die immerhin freudigere Empfindungen weckt, die Hugo
Vogel's. Sie ist vor allem sehr günstig angeordnet. Zu-
nächst fallen, die ganze Rückwand des Raumes über-
spannend, die fünf für die Ausschmückung des Stände-
hauses zu Merseburg bestimmten dekorativen Gemälde
i in die Augen. Das grosse Mittelbild stellt die Landung
Otto's des Grossen und seiner Gemahlin auf der
Elbe bei Magdeburg dar und ist ausgezeichnet durch
Grösse und Einheitlichkeit der Komposition und Fein-
heit der Farbe. Die beiden seitlichen Bilder »Hein-
rich dem Finkler wird die Königskrone dargebracht«,
I und »Sieg Heinrich's 1. über die Ungarn bei Merse-
burg« befriedigen fast noch mehr, während die
beiden allegorischen Darstellungen zur Seite, »Wissen-
schaft« und »Theologie«, nicht auf gleicher Höhe
stehen. Besonders das letztgenannte Bild ist wenig
gehaltvoll. — Aber durch das ganze grosse Werk
geht doch bei allem Theatralischen ein Zug von
Monumentalität, wie ihn Vogel schon bei früheren
Gelegenheiten zuweilen dokumentiert hat. Offenbar
hat der Künstler im Gesamtton den intimen Anschluss
an das Architektonische des Ständehaussaales zu er-
langen gesucht, und es ist wahrscheinlich, dass er
diese Absicht erreicht hat.
Die übrigen Arbeiten Vogel's sind nun freilich
ungleich. Vortrefflich ist ein Kinderporträt vom
Jahre 1886, ebenso ein als »Holländisches Kind« be-
zeichnetes, die beide sich durch Frische und Natur-
wahrheit auszeichnen. Andere Bildnisse, wie das der
Frau v. M. und das der Frau v. G. deuten auf den
feinen Geschmack des Künstlers und haben ausserdem
den grossen Vorzug künstlerischer Abrundung. Auch
das »Selbstbildnis« des Malers, das eine flotte Tech-
nik zeigt, gehört zu seinen besten Leistungen. Da-
gegen sind andere Porträts, so das des Herrn »Geh.
Rat D.« schrecklich langweilig und sehen aus, als
wäre der Künstler selbst bei der Arbeit eingeschlafen.
— Nun da auch Homer zuweilen schläft, soll es ihm
nicht übel genommen werden, obwohl er kein Homer
ist. Bietet er uns doch wieder andere Werke, die
versöhnend wirken. So das sehr malerische, reizende
»Abendfriede«, das vortreffliche »Kirchenlied« und
»Kirchvater«. Auch »Heimgang« und »Mutter und
I Kind« sind gut abgestimmt im Ton. — Endlich ist