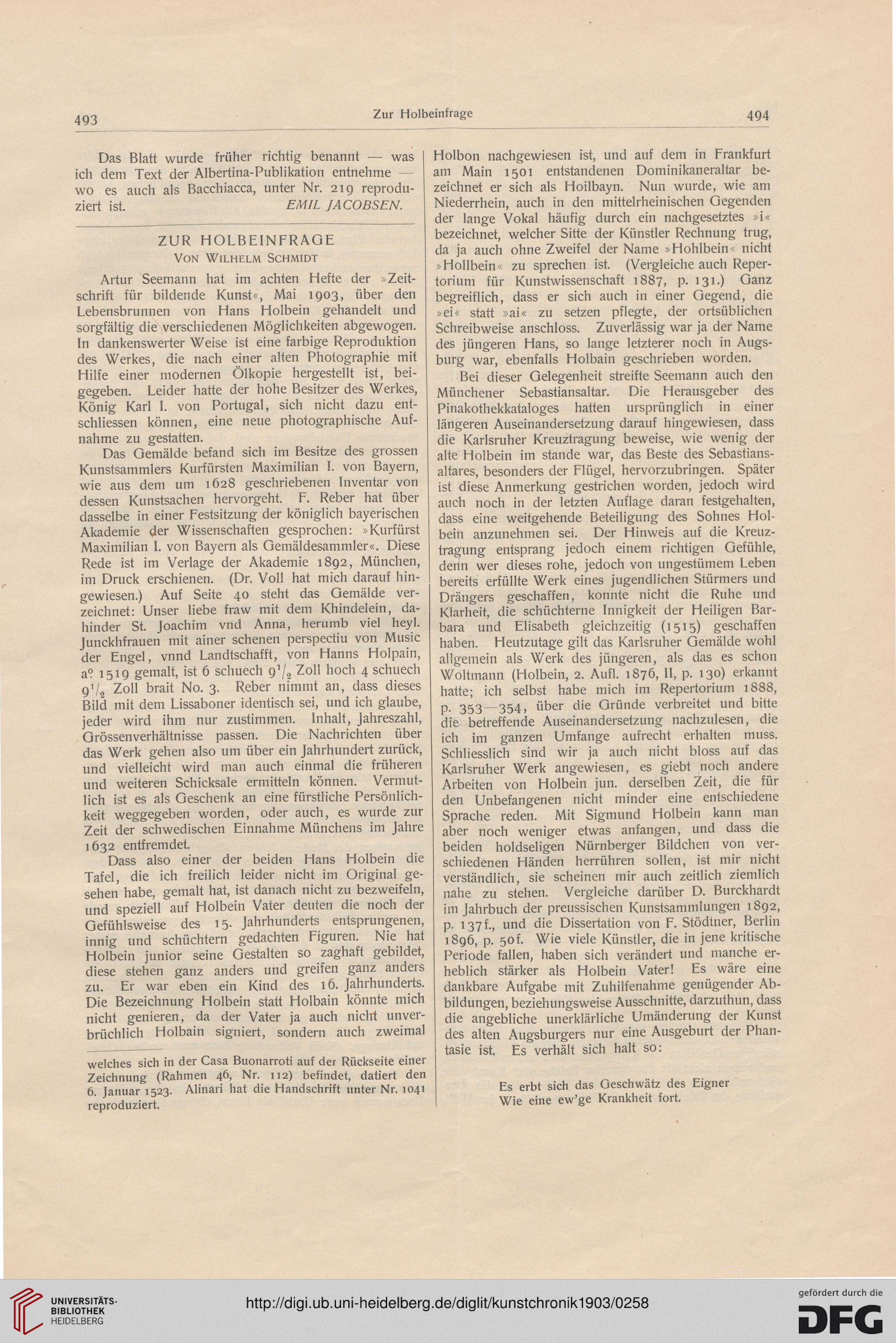493
494
Das Blatt wurde früher richtig benannt — was
ich dem Text der Albertina-Publikation entnehme -
wo es auch als Bacchiacca, unter Nr. 219 reprodu-
ziert ist. EMIL JACOBSEN.
ZUR HOLBEINFRAGE
Von Wilhelm Schmidt
Artur Seemann hat im achten Hefte der -Zeit-
schrift für bildende Kunst«, Mai 1903, über den
Lebensbrunnen von Hans Holbein gehandelt und
sorgfältig die verschiedenen Möglichkeiten abgewogen.
In dankenswerter Weise ist eine farbige Reproduktion
des Werkes, die nach einer alten Photographie mit
Hilfe einer modernen Ölkopie hergestellt ist, bei-
gegeben. Leider hatte der hohe Besitzer des Werkes,
König Karl I. von Portugal, sich nicht dazu ent-
schliessen können, eine neue photographische Auf-
nahme zu gestatten.
Das Gemälde befand sich im Besitze des grossen
Kunstsammlers Kurfürsten Maximilian I. von Bayern,
wie aus dem um 1628 geschriebenen Inventar von
dessen Kunstsachen hervorgeht. F. Reber hat über
dasselbe in einer Festsitzung der königlich bayerischen
Akademie der Wissenschaften gesprochen: »Kurfürst
Maximilian I. von Bayern als Gemäldesammler«. Diese
Rede ist im Verlage der Akademie 1892, München,
im Druck erschienen. (Dr. Voll hat mich darauf hin-
gewiesen.) Auf Seite 40 steht das Gemälde ver-
zeichnet: Unser liebe fraw mit dem Khindelein, da-
hinder St. Joachim vnd Anna, herumb viel heyl.
Junckhfrauen mit ainer schenen perspectiu von Music
der Engel, vnnd Landtschafft, von Hanns Holpain,
a° 1519 gemalt, ist 6 schuech 91/«, Zoll hoch 4 schuech
gVg Zoll brait No. 3. Reber nimmt an, dass dieses
Bild mit dem Lissaboner identisch sei, und ich glaube,
jeder wird ihm nur zustimmen. Inhalt, Jahreszahl,
Grössenverhältnisse passen. Die Nachrichten über
das Werk gehen also um über ein Jahrhundert zurück,
und vielleicht wird man auch einmal die früheren
und weiteren Schicksale ermitteln können. Vermut-
lich ist es als Geschenk an eine fürstliche Persönlich-
keit weggegeben worden, oder auch, es wurde zur
Zeit der schwedischen Einnahme Münchens im Jahre
1632 entfremdet.
Dass also einer der beiden Hans Holbein die
Tafel, die ich freilich leider nicht im Original ge-
sehen habe, gemalt hat, ist danach nicht zu bezweifeln,
und speziell auf Holbein Vater deuten die noch der
Gefühlsweise des 15. Jahrhunderts entsprungenen,
innig und schüchtern gedachten Figuren. Nie hat
Holbein junior seine Gestalten so zaghaft gebildet,
diese stehen ganz anders und greifen ganz anders
zu. Er war eben ein Kind des 16. Jahrhunderts.
Die Bezeichnung Holbein statt Holbain könnte mich
nicht genieren, da der Vater ja auch nicht unver-
brüchlich Holbain signiert, sondern auch zweimal
welches sich in der Casa Buonarroti auf der Rückseite einer
Zeichnung (Rahmen 46, Nr. 112) befindet, datiert den
6. Januar 1523. Alinaii hat die Handschrift unter Nr. 1041
reproduziert.
Holbon nachgewiesen ist, und auf dem in Frankfurt
am Main 1501 entstandenen Dominikaneraltar be-
zeichnet er sich als Hoilbayn. Nun wurde, wie am
Niederrhein, auch in den mittelrheinischen Gegenden
der lange Vokal häufig durch ein nachgesetztes »i«
bezeichnet, welcher Sitte der Künstler Rechnung trug,
da ja auch ohne Zweifel der Name »Hohlbein' nicht
»Hollbein« zu sprechen ist. (Vergleiche auch Reper-
torium für Kunstwissenschaft 1887, p. 131.) Ganz
begreiflich, dass er sich auch in einer Gegend, die
»ei« statt »ai« zu setzen pflegte, der ortsüblichen
Schreibweise anschloss. Zuverlässig war ja der Name
des jüngeren Hans, so lange letzterer noch in Augs-
burg war, ebenfalls Holbain geschrieben worden.
Bei dieser Gelegenheit streifte Seemann auch den
Münchener Sebastiansaltar. Die Herausgeber des
Pinakothekkataloges hatten ursprünglich in einer
längeren Auseinandersetzung darauf hingewiesen, dass
die Karlsruher Kreuztragung beweise, wie wenig der
alte Holbein im stände war, das Beste des Sebastians-
altares, besonders der Flügel, hervorzubringen. Später
ist diese Anmerkung gestrichen worden, jedoch wird
auch noch in der letzten Auflage daran festgehalten,
dass eine weitgehende Beteiligung des Sohnes Hol-
bein anzunehmen sei. Der Hinweis auf die Kreuz-
tragung entsprang jedoch einem richtigen Gefühle,
denn wer dieses rohe, jedoch von ungestümem Leben
bereits erfüllte Werk eines jugendlichen Stürmers und
Drängers geschaffen, konnte nicht die Ruhe und
Klarheit, die schüchterne Innigkeit der Heiligen Bar-
bara und Elisabeth gleichzeitig (1515) geschaffen
haben. Heutzutage gilt das Karlsruher Gemälde wohl
allgemein als Werk des jüngeren, als das es schon
Woltmann (Holbein, 2. Aufl. 1876, II, p. 130) erkannt
hatte; ich selbst habe mich im Repertorium 1888,
P- 353—354> über die Gründe verbreitet und bitte
die betreffende Auseinandersetzung nachzulesen, die
ich im ganzen Umfange aufrecht erhalten muss.
Schliesslich sind wir ja auch nicht bloss auf das
Karlsruher Werk angewiesen, es giebt noch andere
Arbeiten von Holbein jun. derselben Zeit, die für
den Unbefangenen nicht minder eine entschiedene
Sprache reden. Mit Sigmund Holbein kann man
aber noch weniger etwas anfangen, und dass die
beiden holdseligen Nürnberger Bildchen von ver-
schiedenen Händen herrühren sollen, ist mir nicht
verständlich, sie scheinen mir auch zeitlich ziemlich
nahe zu stehen. Vergleiche darüber D. Burckhardt
im Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 1892,
p. 137L, und die Dissertation von F. Stödtner, Berlin
1896, p. 50L Wie viele Künstler, die in jene kritische
Periode fallen, haben sich verändert und manche er-
heblich stärker als Holbein Vater! Es wäre eine
dankbare Aufgabe mit Zuhilfenahme genügender Ab-
bildungen, beziehungsweise Ausschnitte, darzuthun, dass
die angebliche unerklärliche Umänderung der Kunst
des alten Augsburgers nur eine Ausgeburt der Phan-
tasie ist. Es verhält sich halt so:
Es erbt sich das Geschwätz des Eigner
Wie eine ew'ge Krankheit fort.
494
Das Blatt wurde früher richtig benannt — was
ich dem Text der Albertina-Publikation entnehme -
wo es auch als Bacchiacca, unter Nr. 219 reprodu-
ziert ist. EMIL JACOBSEN.
ZUR HOLBEINFRAGE
Von Wilhelm Schmidt
Artur Seemann hat im achten Hefte der -Zeit-
schrift für bildende Kunst«, Mai 1903, über den
Lebensbrunnen von Hans Holbein gehandelt und
sorgfältig die verschiedenen Möglichkeiten abgewogen.
In dankenswerter Weise ist eine farbige Reproduktion
des Werkes, die nach einer alten Photographie mit
Hilfe einer modernen Ölkopie hergestellt ist, bei-
gegeben. Leider hatte der hohe Besitzer des Werkes,
König Karl I. von Portugal, sich nicht dazu ent-
schliessen können, eine neue photographische Auf-
nahme zu gestatten.
Das Gemälde befand sich im Besitze des grossen
Kunstsammlers Kurfürsten Maximilian I. von Bayern,
wie aus dem um 1628 geschriebenen Inventar von
dessen Kunstsachen hervorgeht. F. Reber hat über
dasselbe in einer Festsitzung der königlich bayerischen
Akademie der Wissenschaften gesprochen: »Kurfürst
Maximilian I. von Bayern als Gemäldesammler«. Diese
Rede ist im Verlage der Akademie 1892, München,
im Druck erschienen. (Dr. Voll hat mich darauf hin-
gewiesen.) Auf Seite 40 steht das Gemälde ver-
zeichnet: Unser liebe fraw mit dem Khindelein, da-
hinder St. Joachim vnd Anna, herumb viel heyl.
Junckhfrauen mit ainer schenen perspectiu von Music
der Engel, vnnd Landtschafft, von Hanns Holpain,
a° 1519 gemalt, ist 6 schuech 91/«, Zoll hoch 4 schuech
gVg Zoll brait No. 3. Reber nimmt an, dass dieses
Bild mit dem Lissaboner identisch sei, und ich glaube,
jeder wird ihm nur zustimmen. Inhalt, Jahreszahl,
Grössenverhältnisse passen. Die Nachrichten über
das Werk gehen also um über ein Jahrhundert zurück,
und vielleicht wird man auch einmal die früheren
und weiteren Schicksale ermitteln können. Vermut-
lich ist es als Geschenk an eine fürstliche Persönlich-
keit weggegeben worden, oder auch, es wurde zur
Zeit der schwedischen Einnahme Münchens im Jahre
1632 entfremdet.
Dass also einer der beiden Hans Holbein die
Tafel, die ich freilich leider nicht im Original ge-
sehen habe, gemalt hat, ist danach nicht zu bezweifeln,
und speziell auf Holbein Vater deuten die noch der
Gefühlsweise des 15. Jahrhunderts entsprungenen,
innig und schüchtern gedachten Figuren. Nie hat
Holbein junior seine Gestalten so zaghaft gebildet,
diese stehen ganz anders und greifen ganz anders
zu. Er war eben ein Kind des 16. Jahrhunderts.
Die Bezeichnung Holbein statt Holbain könnte mich
nicht genieren, da der Vater ja auch nicht unver-
brüchlich Holbain signiert, sondern auch zweimal
welches sich in der Casa Buonarroti auf der Rückseite einer
Zeichnung (Rahmen 46, Nr. 112) befindet, datiert den
6. Januar 1523. Alinaii hat die Handschrift unter Nr. 1041
reproduziert.
Holbon nachgewiesen ist, und auf dem in Frankfurt
am Main 1501 entstandenen Dominikaneraltar be-
zeichnet er sich als Hoilbayn. Nun wurde, wie am
Niederrhein, auch in den mittelrheinischen Gegenden
der lange Vokal häufig durch ein nachgesetztes »i«
bezeichnet, welcher Sitte der Künstler Rechnung trug,
da ja auch ohne Zweifel der Name »Hohlbein' nicht
»Hollbein« zu sprechen ist. (Vergleiche auch Reper-
torium für Kunstwissenschaft 1887, p. 131.) Ganz
begreiflich, dass er sich auch in einer Gegend, die
»ei« statt »ai« zu setzen pflegte, der ortsüblichen
Schreibweise anschloss. Zuverlässig war ja der Name
des jüngeren Hans, so lange letzterer noch in Augs-
burg war, ebenfalls Holbain geschrieben worden.
Bei dieser Gelegenheit streifte Seemann auch den
Münchener Sebastiansaltar. Die Herausgeber des
Pinakothekkataloges hatten ursprünglich in einer
längeren Auseinandersetzung darauf hingewiesen, dass
die Karlsruher Kreuztragung beweise, wie wenig der
alte Holbein im stände war, das Beste des Sebastians-
altares, besonders der Flügel, hervorzubringen. Später
ist diese Anmerkung gestrichen worden, jedoch wird
auch noch in der letzten Auflage daran festgehalten,
dass eine weitgehende Beteiligung des Sohnes Hol-
bein anzunehmen sei. Der Hinweis auf die Kreuz-
tragung entsprang jedoch einem richtigen Gefühle,
denn wer dieses rohe, jedoch von ungestümem Leben
bereits erfüllte Werk eines jugendlichen Stürmers und
Drängers geschaffen, konnte nicht die Ruhe und
Klarheit, die schüchterne Innigkeit der Heiligen Bar-
bara und Elisabeth gleichzeitig (1515) geschaffen
haben. Heutzutage gilt das Karlsruher Gemälde wohl
allgemein als Werk des jüngeren, als das es schon
Woltmann (Holbein, 2. Aufl. 1876, II, p. 130) erkannt
hatte; ich selbst habe mich im Repertorium 1888,
P- 353—354> über die Gründe verbreitet und bitte
die betreffende Auseinandersetzung nachzulesen, die
ich im ganzen Umfange aufrecht erhalten muss.
Schliesslich sind wir ja auch nicht bloss auf das
Karlsruher Werk angewiesen, es giebt noch andere
Arbeiten von Holbein jun. derselben Zeit, die für
den Unbefangenen nicht minder eine entschiedene
Sprache reden. Mit Sigmund Holbein kann man
aber noch weniger etwas anfangen, und dass die
beiden holdseligen Nürnberger Bildchen von ver-
schiedenen Händen herrühren sollen, ist mir nicht
verständlich, sie scheinen mir auch zeitlich ziemlich
nahe zu stehen. Vergleiche darüber D. Burckhardt
im Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 1892,
p. 137L, und die Dissertation von F. Stödtner, Berlin
1896, p. 50L Wie viele Künstler, die in jene kritische
Periode fallen, haben sich verändert und manche er-
heblich stärker als Holbein Vater! Es wäre eine
dankbare Aufgabe mit Zuhilfenahme genügender Ab-
bildungen, beziehungsweise Ausschnitte, darzuthun, dass
die angebliche unerklärliche Umänderung der Kunst
des alten Augsburgers nur eine Ausgeburt der Phan-
tasie ist. Es verhält sich halt so:
Es erbt sich das Geschwätz des Eigner
Wie eine ew'ge Krankheit fort.