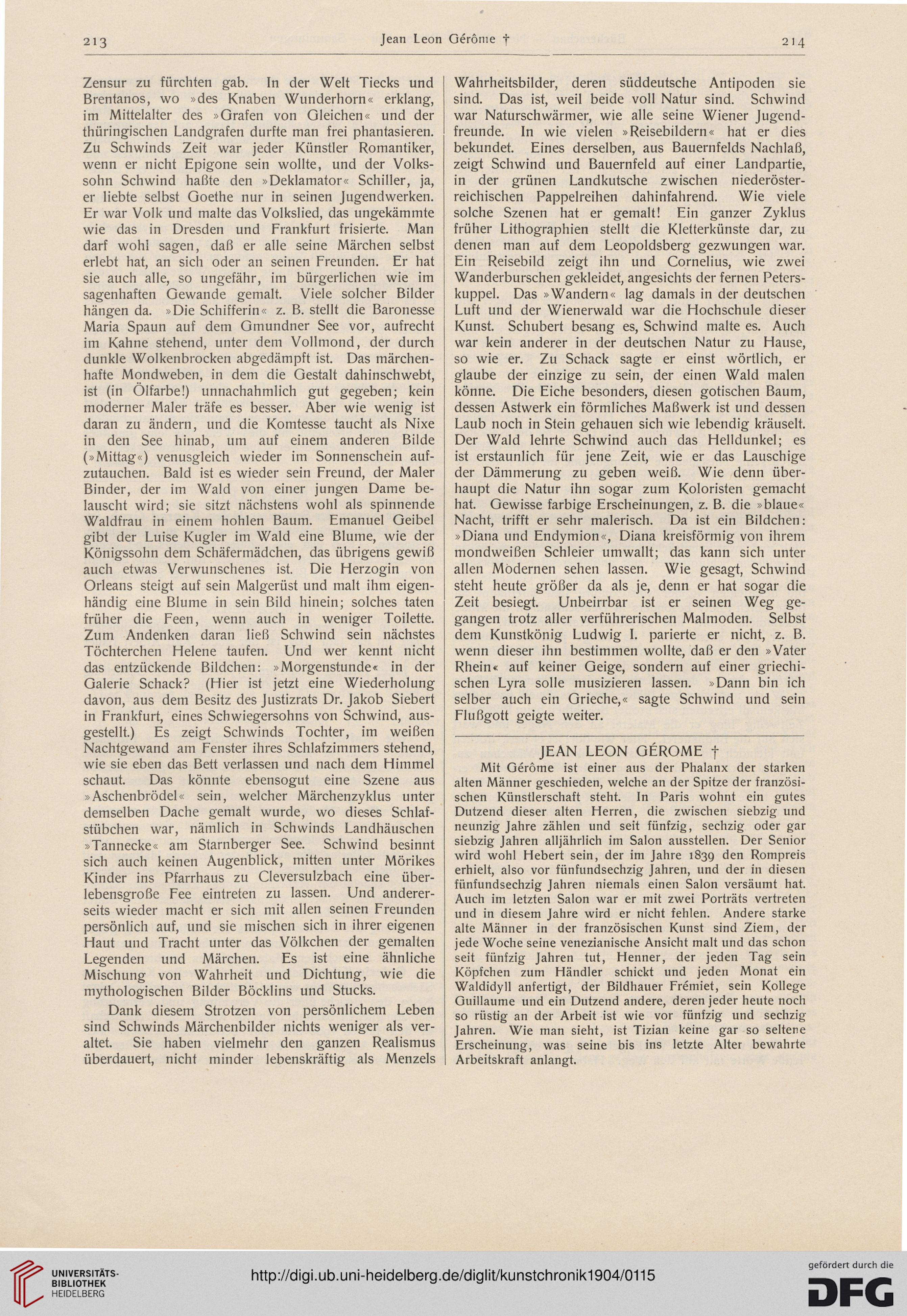213
Jean Leon
Gerome f
214
Zensur zu fürchten gab. In der Welt Tiecks und
Brentanos, wo »des Knaben Wunderhorn« erklang,
im Mittelalter des »Grafen von Gleichen« und der
thüringischen Landgrafen durfte man frei phantasieren.
Zu Schwinds Zeit war jeder Künstler Romantiker,
wenn er nicht Epigone sein wollte, und der Volks-
sohn Schwind haßte den »Deklamator« Schiller, ja,
er liebte selbst Goethe nur in seinen Jugendwerken.
Er war Volk und malte das Volkslied, das ungekämmte
wie das in Dresden und Frankfurt frisierte. Man
darf wohl sagen, daß er alle seine Märchen selbst
erlebt hat, an sich oder an seinen Freunden. Er hat
sie auch alle, so ungefähr, im bürgerlichen wie im
sagenhaften Gewände gemalt. Viele solcher Bilder
hängen da. »Die Schifferin« z. B. stellt die Baronesse
Maria Spaun auf dem Gmundner See vor, aufrecht
im Kahne stehend, unter dem Vollmond, der durch
dunkle Wolkenbrocken abgedämpft ist. Das märchen-
hafte Mondweben, in dem die Gestalt dahinschwebt,
ist (in Ölfarbe!) unnachahmlich gut gegeben; kein
moderner Maler träfe es besser. Aber wie wenig ist
daran zu ändern, und die Komtesse taucht als Nixe
in den See hinab, um auf einem anderen Bilde
(»Mittag«) venusgleich wieder im Sonnenschein auf-
zutauchen. Bald ist es wieder sein Freund, der Maler
Binder, der im Wald von einer jungen Dame be-
lauscht wird; sie sitzt nächstens wohl als spinnende
Waldfrau in einem hohlen Baum. Emanuel Geibel
gibt der Luise Kugler im Wald eine Blume, wie der
Königssohn dem Schäfermädchen, das übrigens gewiß
auch etwas Verwunschenes ist. Die Herzogin von
Orleans steigt auf sein Malgerüst und malt ihm eigen-
händig eine Blume in sein Bild hinein; solches taten
früher die Feen, wenn auch in weniger Toilette.
Zum Andenken daran ließ Schwind sein nächstes
Töchterchen Helene taufen. Und wer kennt nicht
das entzückende Bildchen: »Morgenstunde« in der
Galerie Schack? (Hier ist jetzt eine Wiederholung
davon, aus dem Besitz des Justizrats Dr. Jakob Siebert
in Frankfurt, eines Schwiegersohns von Schwind, aus-
gestellt.) Es zeigt Schwinds Tochter, im weißen
Nachtgewand am Fenster ihres Schlafzimmers stehend,
wie sie eben das Bett verlassen und nach dem Himmel
schaut. Das könnte ebensogut eine Szene aus
»Aschenbrödel« sein, welcher Märchenzyklus unter
demselben Dache gemalt wurde, wo dieses Schlaf -
stübchen war, nämlich in Schwinds Landhäuschen
»Tannecke« am Starnberger See. Schwind besinnt
sich auch keinen Augenblick, mitten unter Mörikes
Kinder ins Pfarrhaus zu Cleversulzbach eine über-
lebensgroße Fee eintreten zu lassen. Und anderer-
seits wieder macht er sich mit allen seinen Freunden
persönlich auf, und sie mischen sich in ihrer eigenen
Haut und Tracht unter das Völkchen der gemalten
Legenden und Märchen. Es ist eine ähnliche
Mischung von Wahrheit und Dichtung, wie die
mythologischen Bilder Böcklins und Stucks.
Dank diesem Strotzen von persönlichem Leben
sind Schwinds Märchenbilder nichts weniger als ver-
altet. Sie haben vielmehr den ganzen Realismus
überdauert, nicht minder lebenskräftig als Menzels
Wahrheitsbilder, deren süddeutsche Antipoden sie
sind. Das ist, weil beide voll Natur sind. Schwind
war Naturschwärmer, wie alle seine Wiener Jugend-
freunde. In wie vielen »Reisebildern« hat er dies
bekundet. Eines derselben, aus Bauernfelds Nachlaß,
zeigt Schwind und Bauernfeld auf einer Landpartie,
in der grünen Landkutsche zwischen niederöster-
reichischen Pappelreihen dahinfahrend. Wie viele
solche Szenen hat er gemalt! Ein ganzer Zyklus
früher Lithographien stellt die Kletterkünste dar, zu
denen man auf dem Leopoldsberg gezwungen war.
Ein Reisebild zeigt ihn und Cornelius, wie zwei
Wanderburschen gekleidet, angesichts der fernen Peters-
kuppel. Das »Wandern« lag damals in der deutschen
Luft und der Wienerwald war die Hochschule dieser
Kunst. Schubert besang es, Schwind malte es. Auch
war kein anderer in der deutschen Natur zu Hause,
so wie er. Zu Schack sagte er einst wörtlich, er
glaube der einzige zu sein, der einen Wald malen
könne. Die Eiche besonders, diesen gotischen Baum,
dessen Astwerk ein förmliches Maßwerk ist und dessen
Laub noch in Stein gehauen sich wie lebendig kräuselt.
Der Wald lehrte Schwind auch das Helldunkel; es
ist erstaunlich für jene Zeit, wie er das Lauschige
der Dämmerung zu geben weiß. Wie denn über-
haupt die Natur ihn sogar zum Koloristen gemacht
hat. Gewisse farbige Erscheinungen, z. B. die »blaue«
Nacht, trifft er sehr malerisch. Da ist ein Bildchen:
»Diana und Endymion«, Diana kreisförmig von ihrem
mondweißen Schleier umwallt; das kann sich unter
allen Modernen sehen lassen. Wie gesagt, Schwind
steht heute größer da als je, denn er hat sogar die
Zeit besiegt. Unbeirrbar ist er seinen Weg ge-
gangen trotz aller verführerischen Malmoden. Selbst
dem Kunstkönig Ludwig I. parierte er nicht, z. B.
wenn dieser ihn bestimmen wollte, daß er den »Vater
Rhein« auf keiner Geige, sondern auf einer griechi-
schen Lyra solle musizieren lassen. »Dann bin ich
selber auch ein Grieche,« sagte Schwind und sein
Flußgott geigte weiter.
JEAN LEON GEROME |
Mit Gerome ist einer aus der Phalanx der starken
alten Männer geschieden, welche an der Spitze der französi-
schen Künstlerschaft steht. In Paris wohnt ein gutes
Dutzend dieser alten Herren, die zwischen siebzig und
neunzig Jahre zählen und seit fünfzig, sechzig oder gar
siebzig Jahren alljährlich im Salon ausstellen. Der Senior
wird wohl Hebert sein, der im Jahre 1839 den Rompreis
erhielt, also vor fünfundsechzig Jahren, und der in diesen
fünfundsechzig Jahren niemals einen Salon versäumt hat.
Auch im letzten Salon war er mit zwei Porträts vertreten
und in diesem Jahre wird er nicht fehlen. Andere starke
alte Männer in der französischen Kunst sind Ziem, der
jede Woche seine venezianische Ansicht malt und das schon
seit fünfzig Jahren tut, Henner, der jeden Tag sein
Köpfchen zum Händler schickt und jeden Monat ein
Waldidyll anfertigt, der Bildhauer Fremiet, sein Kollege
Guillaume und ein Dutzend andere, deren jeder heute noch
so rüstig an der Arbeit ist wie vor fünfzig und sechzig
Jahren. Wie man sieht, ist Tizian keine gar so seltene
Erscheinung, was seine bis ins letzte Alter bewahrte
Arbeitskraft anlangt.
Jean Leon
Gerome f
214
Zensur zu fürchten gab. In der Welt Tiecks und
Brentanos, wo »des Knaben Wunderhorn« erklang,
im Mittelalter des »Grafen von Gleichen« und der
thüringischen Landgrafen durfte man frei phantasieren.
Zu Schwinds Zeit war jeder Künstler Romantiker,
wenn er nicht Epigone sein wollte, und der Volks-
sohn Schwind haßte den »Deklamator« Schiller, ja,
er liebte selbst Goethe nur in seinen Jugendwerken.
Er war Volk und malte das Volkslied, das ungekämmte
wie das in Dresden und Frankfurt frisierte. Man
darf wohl sagen, daß er alle seine Märchen selbst
erlebt hat, an sich oder an seinen Freunden. Er hat
sie auch alle, so ungefähr, im bürgerlichen wie im
sagenhaften Gewände gemalt. Viele solcher Bilder
hängen da. »Die Schifferin« z. B. stellt die Baronesse
Maria Spaun auf dem Gmundner See vor, aufrecht
im Kahne stehend, unter dem Vollmond, der durch
dunkle Wolkenbrocken abgedämpft ist. Das märchen-
hafte Mondweben, in dem die Gestalt dahinschwebt,
ist (in Ölfarbe!) unnachahmlich gut gegeben; kein
moderner Maler träfe es besser. Aber wie wenig ist
daran zu ändern, und die Komtesse taucht als Nixe
in den See hinab, um auf einem anderen Bilde
(»Mittag«) venusgleich wieder im Sonnenschein auf-
zutauchen. Bald ist es wieder sein Freund, der Maler
Binder, der im Wald von einer jungen Dame be-
lauscht wird; sie sitzt nächstens wohl als spinnende
Waldfrau in einem hohlen Baum. Emanuel Geibel
gibt der Luise Kugler im Wald eine Blume, wie der
Königssohn dem Schäfermädchen, das übrigens gewiß
auch etwas Verwunschenes ist. Die Herzogin von
Orleans steigt auf sein Malgerüst und malt ihm eigen-
händig eine Blume in sein Bild hinein; solches taten
früher die Feen, wenn auch in weniger Toilette.
Zum Andenken daran ließ Schwind sein nächstes
Töchterchen Helene taufen. Und wer kennt nicht
das entzückende Bildchen: »Morgenstunde« in der
Galerie Schack? (Hier ist jetzt eine Wiederholung
davon, aus dem Besitz des Justizrats Dr. Jakob Siebert
in Frankfurt, eines Schwiegersohns von Schwind, aus-
gestellt.) Es zeigt Schwinds Tochter, im weißen
Nachtgewand am Fenster ihres Schlafzimmers stehend,
wie sie eben das Bett verlassen und nach dem Himmel
schaut. Das könnte ebensogut eine Szene aus
»Aschenbrödel« sein, welcher Märchenzyklus unter
demselben Dache gemalt wurde, wo dieses Schlaf -
stübchen war, nämlich in Schwinds Landhäuschen
»Tannecke« am Starnberger See. Schwind besinnt
sich auch keinen Augenblick, mitten unter Mörikes
Kinder ins Pfarrhaus zu Cleversulzbach eine über-
lebensgroße Fee eintreten zu lassen. Und anderer-
seits wieder macht er sich mit allen seinen Freunden
persönlich auf, und sie mischen sich in ihrer eigenen
Haut und Tracht unter das Völkchen der gemalten
Legenden und Märchen. Es ist eine ähnliche
Mischung von Wahrheit und Dichtung, wie die
mythologischen Bilder Böcklins und Stucks.
Dank diesem Strotzen von persönlichem Leben
sind Schwinds Märchenbilder nichts weniger als ver-
altet. Sie haben vielmehr den ganzen Realismus
überdauert, nicht minder lebenskräftig als Menzels
Wahrheitsbilder, deren süddeutsche Antipoden sie
sind. Das ist, weil beide voll Natur sind. Schwind
war Naturschwärmer, wie alle seine Wiener Jugend-
freunde. In wie vielen »Reisebildern« hat er dies
bekundet. Eines derselben, aus Bauernfelds Nachlaß,
zeigt Schwind und Bauernfeld auf einer Landpartie,
in der grünen Landkutsche zwischen niederöster-
reichischen Pappelreihen dahinfahrend. Wie viele
solche Szenen hat er gemalt! Ein ganzer Zyklus
früher Lithographien stellt die Kletterkünste dar, zu
denen man auf dem Leopoldsberg gezwungen war.
Ein Reisebild zeigt ihn und Cornelius, wie zwei
Wanderburschen gekleidet, angesichts der fernen Peters-
kuppel. Das »Wandern« lag damals in der deutschen
Luft und der Wienerwald war die Hochschule dieser
Kunst. Schubert besang es, Schwind malte es. Auch
war kein anderer in der deutschen Natur zu Hause,
so wie er. Zu Schack sagte er einst wörtlich, er
glaube der einzige zu sein, der einen Wald malen
könne. Die Eiche besonders, diesen gotischen Baum,
dessen Astwerk ein förmliches Maßwerk ist und dessen
Laub noch in Stein gehauen sich wie lebendig kräuselt.
Der Wald lehrte Schwind auch das Helldunkel; es
ist erstaunlich für jene Zeit, wie er das Lauschige
der Dämmerung zu geben weiß. Wie denn über-
haupt die Natur ihn sogar zum Koloristen gemacht
hat. Gewisse farbige Erscheinungen, z. B. die »blaue«
Nacht, trifft er sehr malerisch. Da ist ein Bildchen:
»Diana und Endymion«, Diana kreisförmig von ihrem
mondweißen Schleier umwallt; das kann sich unter
allen Modernen sehen lassen. Wie gesagt, Schwind
steht heute größer da als je, denn er hat sogar die
Zeit besiegt. Unbeirrbar ist er seinen Weg ge-
gangen trotz aller verführerischen Malmoden. Selbst
dem Kunstkönig Ludwig I. parierte er nicht, z. B.
wenn dieser ihn bestimmen wollte, daß er den »Vater
Rhein« auf keiner Geige, sondern auf einer griechi-
schen Lyra solle musizieren lassen. »Dann bin ich
selber auch ein Grieche,« sagte Schwind und sein
Flußgott geigte weiter.
JEAN LEON GEROME |
Mit Gerome ist einer aus der Phalanx der starken
alten Männer geschieden, welche an der Spitze der französi-
schen Künstlerschaft steht. In Paris wohnt ein gutes
Dutzend dieser alten Herren, die zwischen siebzig und
neunzig Jahre zählen und seit fünfzig, sechzig oder gar
siebzig Jahren alljährlich im Salon ausstellen. Der Senior
wird wohl Hebert sein, der im Jahre 1839 den Rompreis
erhielt, also vor fünfundsechzig Jahren, und der in diesen
fünfundsechzig Jahren niemals einen Salon versäumt hat.
Auch im letzten Salon war er mit zwei Porträts vertreten
und in diesem Jahre wird er nicht fehlen. Andere starke
alte Männer in der französischen Kunst sind Ziem, der
jede Woche seine venezianische Ansicht malt und das schon
seit fünfzig Jahren tut, Henner, der jeden Tag sein
Köpfchen zum Händler schickt und jeden Monat ein
Waldidyll anfertigt, der Bildhauer Fremiet, sein Kollege
Guillaume und ein Dutzend andere, deren jeder heute noch
so rüstig an der Arbeit ist wie vor fünfzig und sechzig
Jahren. Wie man sieht, ist Tizian keine gar so seltene
Erscheinung, was seine bis ins letzte Alter bewahrte
Arbeitskraft anlangt.