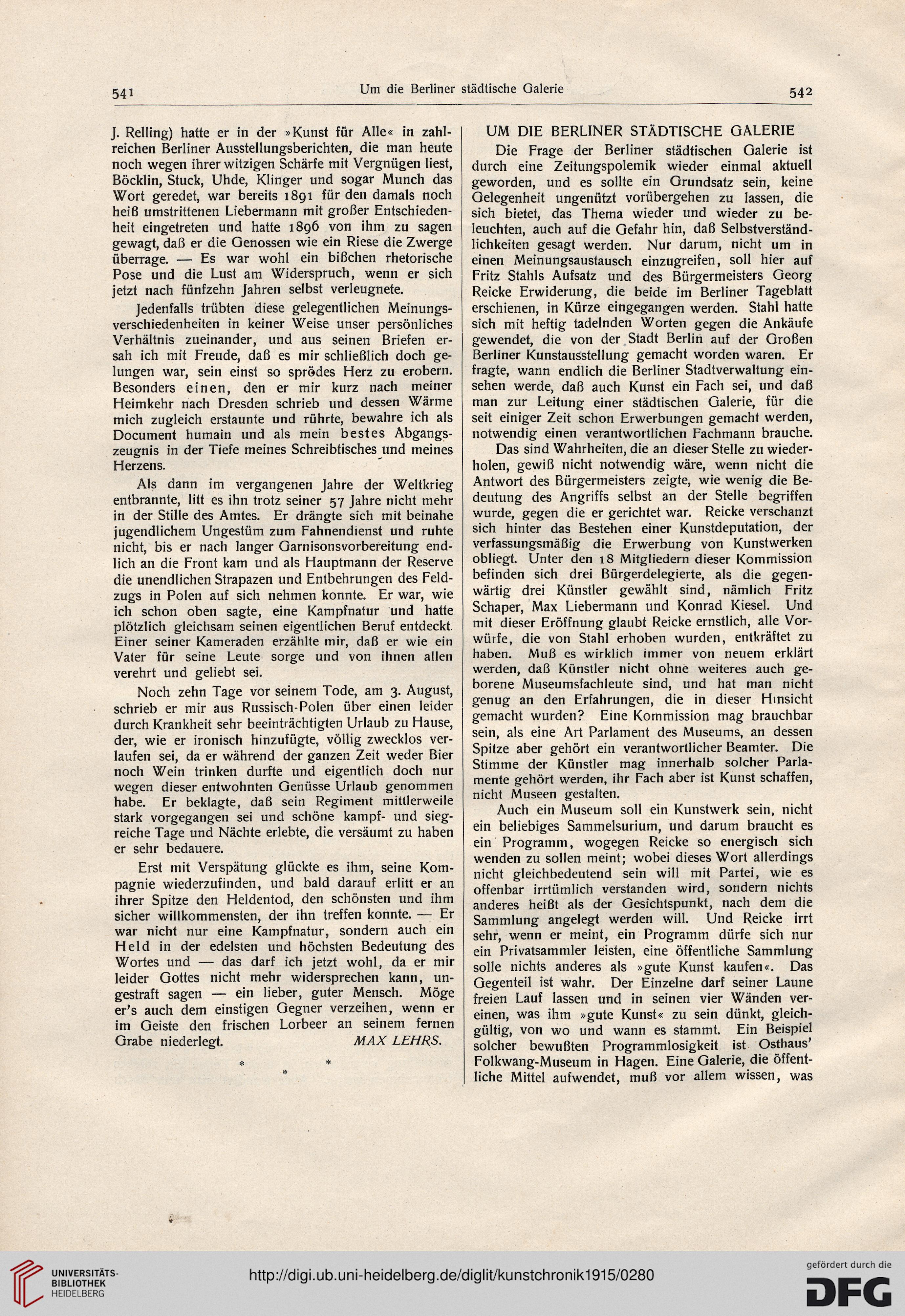541
Um die Berliner städtische Galerie
542
J. Relling) hatte er in der »Kunst für Alle« in zahl-
reichen Berliner Ausstellungsberichten, die man heute
noch wegen ihrer witzigen Schärfe mit Vergnügen liest,
Böcklin, Stuck, Uhde, Klinger und sogar Münch das
Wort geredet, war bereits 1891 für den damals noch
heiß umstrittenen Liebermann mit großer Entschieden-
heit eingetreten und hatte 1896 von ihm zu sagen
gewagt, daß er die Genossen wie ein Riese die Zwerge
überrage. — Es war wohl ein bißchen rhetorische
Pose und die Lust am Widerspruch, wenn er sich
jetzt nach fünfzehn Jahren selbst verleugnete.
Jedenfalls trübten diese gelegentlichen Meinungs-
verschiedenheiten in keiner Weise unser persönliches
Verhältnis zueinander, und aus seinen Briefen er-
sah ich mit Freude, daß es mir schließlich doch ge-
lungen war, sein einst so sprödes Herz zu erobern.
Besonders einen, den er mir kurz nach meiner
Heimkehr nach Dresden schrieb und dessen Wärme
mich zugleich erstaunte und rührte, bewahre ich als
Document humain und als mein bestes Abgangs-
zeugnis in der Tiefe meines Schreibtisches und meines
Herzens.
Als dann im vergangenen Jahre der Weltkrieg
entbrannte, litt es ihn trotz seiner 57 Jahre nicht mehr
in der Stille des Amtes. Er drängte sich mit beinahe
jugendlichem Ungestüm zum Fahnendienst und ruhte
nicht, bis er nach langer GarnisonsVorbereitung end-
lich an die Front kam und als Hauptmann der Reserve
die unendlichen Strapazen und Entbehrungen des Feld-
zugs in Polen auf sich nehmen konnte. Er war, wie
ich schon oben sagte, eine Kampfnatur und hatte
plötzlich gleichsam seinen eigentlichen Beruf entdeckt.
Einer seiner Kameraden erzählte mir, daß er wie ein
Vater für seine Leute sorge und von ihnen allen
verehrt und geliebt sei.
Noch zehn Tage vor seinem Tode, am 3. August,
schrieb er mir aus Russisch-Polen über einen leider
durch Krankheit sehr beeinträchtigten Urlaub zu Hause,
der, wie er ironisch hinzufügte, völlig zwecklos ver-
laufen sei, da er während der ganzen Zeit weder Bier
noch Wein trinken durfte und eigentlich doch nur
wegen dieser entwohnten Genüsse Urlaub genommen
habe. Er beklagte, daß sein Regiment mittlerweile
stark vorgegangen sei und schöne kämpf- und sieg-
reiche Tage und Nächte erlebte, die versäumt zu haben
er sehr bedauere.
Erst mit Verspätung glückte es ihm, seine Kom-
pagnie wiederzufinden, und bald darauf erlitt er an
ihrer Spitze den Heldentod, den schönsten und ihm
sicher willkommensten, der ihn treffen konnte. — Er
war nicht nur eine Kampfnatur, sondern auch ein
Held in der edelsten und höchsten Bedeutung des
Wortes und — das darf ich jetzt wohl, da er mir
leider Gottes nicht mehr widersprechen kann, un-
gestraft sagen — ein lieber, guter Mensch. Möge
er's auch dem einstigen Gegner verzeihen, wenn er
im Geiste den frischen Lorbeer an seinem fernen
Grabe niederlegt. MAX LEHRS.
* *
*
UM DIE BERLINER STÄDTISCHE GALERIE
Die Frage der Berliner städtischen Galerie ist
durch eine Zeitungspolemik wieder einmal aktuell
geworden, und es sollte ein Grundsatz sein, keine
Gelegenheit ungenützt vorübergehen zu lassen, die
sich bietet, das Thema wieder und wieder zu be-
leuchten, auch auf die Gefahr hin, daß Selbstverständ-
lichkeiten gesagt werden. Nur darum, nicht um in
einen Meinungsaustausch einzugreifen, soll hier auf
Fritz Stahls Aufsatz und des Bürgermeisters Georg
Reicke Erwiderung, die beide im Berliner Tageblatt
erschienen, in Kürze eingegangen werden. Stahl hatte
sich mit heftig tadelnden Worten gegen die Ankäufe
gewendet, die von der Stadt Berlin auf der Großen
Berliner Kunstausstellung gemacht worden waren. Er
fragte, wann endlich die Berliner Stadtverwaltung ein-
sehen werde, daß auch Kunst ein Fach sei, und daß
man zur Leitung einer städtischen Galerie, für die
seit einiger Zeit schon Erwerbungen gemacht werden,
notwendig einen verantwortlichen Fachmann brauche.
Das sind Wahrheiten, die an dieser Stelle zu wieder-
holen, gewiß nicht notwendig wäre, wenn nicht die
Antwort des Bürgermeisters zeigte, wie wenig die Be-
deutung des Angriffs selbst an der Stelle begriffen
wurde, gegen die er gerichtet war. Reicke verschanzt
sich hinter das Bestehen einer Kunstdeputation, der
verfassungsmäßig die Erwerbung von Kunstwerken
obliegt. Unter den 18 Mitgliedern dieser Kommission
befinden sich drei Bürgerdelegierte, als die gegen-
wärtig drei Künstler gewählt sind, nämlich Fritz
Schaper, Max Liebermann und Konrad Kiesel. Und
mit dieser Eröffnung glaubt Reicke ernstlich, alle Vor-
würfe, die von Stahl erhoben wurden, entkräftet zu
haben. Muß es wirklich immer von neuem erklärt
werden, daß Künstler nicht ohne weiteres auch ge-
borene Museumsfachleute sind, und hat man nicht
genug an den Erfahrungen, die in dieser Hinsicht
gemacht wurden? Eine Kommission mag brauchbar
sein, als eine Art Parlament des Museums, an dessen
Spitze aber gehört ein verantwortlicher Beamter. Die
Stimme der Künstler mag innerhalb solcher Parla-
mente gehört werden, ihr Fach aber ist Kunst schaffen,
nicht Museen gestalten.
Auch ein Museum soll ein Kunstwerk sein, nicht
ein beliebiges Sammelsurium, und darum braucht es
ein Programm, wogegen Reicke so energisch sich
wenden zu sollen meint; wobei dieses Wort allerdings
nicht gleichbedeutend sein will mit Partei, wie es
offenbar irrtümlich verstanden wird, sondern nichts
anderes heißt als der Gesichtspunkt, nach dem die
Sammlung angelegt werden will. Und Reicke irrt
sehr, wenn er meint, ein Programm dürfe sich nur
ein Privatsammler leisten, eine öffentliche Sammlung
solle nichts anderes als »gute Kunst kaufen«. Das
Gegenteil ist wahr. Der Einzelne darf seiner Laune
freien Lauf lassen und in seinen vier Wänden ver-
einen, was ihm »gute Kunst« zu sein dünkt, gleich-
gültig, von wo und wann es stammt. Ein Beispiel
solcher bewußten Programmlosigkeit ist Osthaus'
Folkwang-Museum in Hagen. Eine Galerie, die öffent-
liche Mittel aufwendet, muß vor allem wissen, was
Um die Berliner städtische Galerie
542
J. Relling) hatte er in der »Kunst für Alle« in zahl-
reichen Berliner Ausstellungsberichten, die man heute
noch wegen ihrer witzigen Schärfe mit Vergnügen liest,
Böcklin, Stuck, Uhde, Klinger und sogar Münch das
Wort geredet, war bereits 1891 für den damals noch
heiß umstrittenen Liebermann mit großer Entschieden-
heit eingetreten und hatte 1896 von ihm zu sagen
gewagt, daß er die Genossen wie ein Riese die Zwerge
überrage. — Es war wohl ein bißchen rhetorische
Pose und die Lust am Widerspruch, wenn er sich
jetzt nach fünfzehn Jahren selbst verleugnete.
Jedenfalls trübten diese gelegentlichen Meinungs-
verschiedenheiten in keiner Weise unser persönliches
Verhältnis zueinander, und aus seinen Briefen er-
sah ich mit Freude, daß es mir schließlich doch ge-
lungen war, sein einst so sprödes Herz zu erobern.
Besonders einen, den er mir kurz nach meiner
Heimkehr nach Dresden schrieb und dessen Wärme
mich zugleich erstaunte und rührte, bewahre ich als
Document humain und als mein bestes Abgangs-
zeugnis in der Tiefe meines Schreibtisches und meines
Herzens.
Als dann im vergangenen Jahre der Weltkrieg
entbrannte, litt es ihn trotz seiner 57 Jahre nicht mehr
in der Stille des Amtes. Er drängte sich mit beinahe
jugendlichem Ungestüm zum Fahnendienst und ruhte
nicht, bis er nach langer GarnisonsVorbereitung end-
lich an die Front kam und als Hauptmann der Reserve
die unendlichen Strapazen und Entbehrungen des Feld-
zugs in Polen auf sich nehmen konnte. Er war, wie
ich schon oben sagte, eine Kampfnatur und hatte
plötzlich gleichsam seinen eigentlichen Beruf entdeckt.
Einer seiner Kameraden erzählte mir, daß er wie ein
Vater für seine Leute sorge und von ihnen allen
verehrt und geliebt sei.
Noch zehn Tage vor seinem Tode, am 3. August,
schrieb er mir aus Russisch-Polen über einen leider
durch Krankheit sehr beeinträchtigten Urlaub zu Hause,
der, wie er ironisch hinzufügte, völlig zwecklos ver-
laufen sei, da er während der ganzen Zeit weder Bier
noch Wein trinken durfte und eigentlich doch nur
wegen dieser entwohnten Genüsse Urlaub genommen
habe. Er beklagte, daß sein Regiment mittlerweile
stark vorgegangen sei und schöne kämpf- und sieg-
reiche Tage und Nächte erlebte, die versäumt zu haben
er sehr bedauere.
Erst mit Verspätung glückte es ihm, seine Kom-
pagnie wiederzufinden, und bald darauf erlitt er an
ihrer Spitze den Heldentod, den schönsten und ihm
sicher willkommensten, der ihn treffen konnte. — Er
war nicht nur eine Kampfnatur, sondern auch ein
Held in der edelsten und höchsten Bedeutung des
Wortes und — das darf ich jetzt wohl, da er mir
leider Gottes nicht mehr widersprechen kann, un-
gestraft sagen — ein lieber, guter Mensch. Möge
er's auch dem einstigen Gegner verzeihen, wenn er
im Geiste den frischen Lorbeer an seinem fernen
Grabe niederlegt. MAX LEHRS.
* *
*
UM DIE BERLINER STÄDTISCHE GALERIE
Die Frage der Berliner städtischen Galerie ist
durch eine Zeitungspolemik wieder einmal aktuell
geworden, und es sollte ein Grundsatz sein, keine
Gelegenheit ungenützt vorübergehen zu lassen, die
sich bietet, das Thema wieder und wieder zu be-
leuchten, auch auf die Gefahr hin, daß Selbstverständ-
lichkeiten gesagt werden. Nur darum, nicht um in
einen Meinungsaustausch einzugreifen, soll hier auf
Fritz Stahls Aufsatz und des Bürgermeisters Georg
Reicke Erwiderung, die beide im Berliner Tageblatt
erschienen, in Kürze eingegangen werden. Stahl hatte
sich mit heftig tadelnden Worten gegen die Ankäufe
gewendet, die von der Stadt Berlin auf der Großen
Berliner Kunstausstellung gemacht worden waren. Er
fragte, wann endlich die Berliner Stadtverwaltung ein-
sehen werde, daß auch Kunst ein Fach sei, und daß
man zur Leitung einer städtischen Galerie, für die
seit einiger Zeit schon Erwerbungen gemacht werden,
notwendig einen verantwortlichen Fachmann brauche.
Das sind Wahrheiten, die an dieser Stelle zu wieder-
holen, gewiß nicht notwendig wäre, wenn nicht die
Antwort des Bürgermeisters zeigte, wie wenig die Be-
deutung des Angriffs selbst an der Stelle begriffen
wurde, gegen die er gerichtet war. Reicke verschanzt
sich hinter das Bestehen einer Kunstdeputation, der
verfassungsmäßig die Erwerbung von Kunstwerken
obliegt. Unter den 18 Mitgliedern dieser Kommission
befinden sich drei Bürgerdelegierte, als die gegen-
wärtig drei Künstler gewählt sind, nämlich Fritz
Schaper, Max Liebermann und Konrad Kiesel. Und
mit dieser Eröffnung glaubt Reicke ernstlich, alle Vor-
würfe, die von Stahl erhoben wurden, entkräftet zu
haben. Muß es wirklich immer von neuem erklärt
werden, daß Künstler nicht ohne weiteres auch ge-
borene Museumsfachleute sind, und hat man nicht
genug an den Erfahrungen, die in dieser Hinsicht
gemacht wurden? Eine Kommission mag brauchbar
sein, als eine Art Parlament des Museums, an dessen
Spitze aber gehört ein verantwortlicher Beamter. Die
Stimme der Künstler mag innerhalb solcher Parla-
mente gehört werden, ihr Fach aber ist Kunst schaffen,
nicht Museen gestalten.
Auch ein Museum soll ein Kunstwerk sein, nicht
ein beliebiges Sammelsurium, und darum braucht es
ein Programm, wogegen Reicke so energisch sich
wenden zu sollen meint; wobei dieses Wort allerdings
nicht gleichbedeutend sein will mit Partei, wie es
offenbar irrtümlich verstanden wird, sondern nichts
anderes heißt als der Gesichtspunkt, nach dem die
Sammlung angelegt werden will. Und Reicke irrt
sehr, wenn er meint, ein Programm dürfe sich nur
ein Privatsammler leisten, eine öffentliche Sammlung
solle nichts anderes als »gute Kunst kaufen«. Das
Gegenteil ist wahr. Der Einzelne darf seiner Laune
freien Lauf lassen und in seinen vier Wänden ver-
einen, was ihm »gute Kunst« zu sein dünkt, gleich-
gültig, von wo und wann es stammt. Ein Beispiel
solcher bewußten Programmlosigkeit ist Osthaus'
Folkwang-Museum in Hagen. Eine Galerie, die öffent-
liche Mittel aufwendet, muß vor allem wissen, was