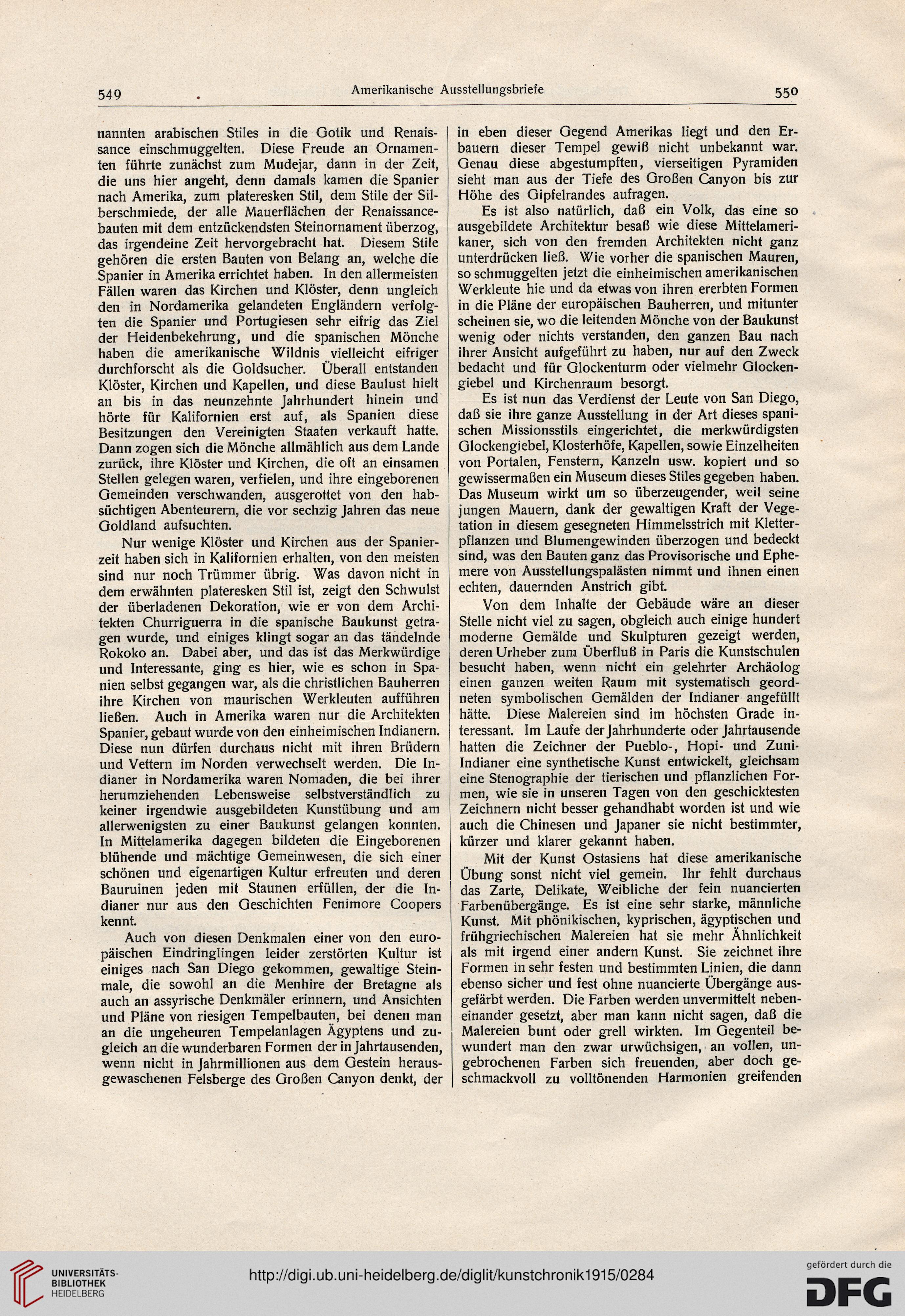549
Amerikanische Ausstellungsbriefe
550
nannten arabischen Stiles in die Gotik und Renais-
sance einschmuggelten. Diese Freude an Ornamen-
ten führte zunächst zum Mudejar, dann in der Zeit,
die uns hier angeht, denn damals kamen die Spanier
nach Amerika, zum plateresken Stil, dem Stile der Sil-
berschmiede, der alle Mauerflächen der Renaissance-
bauten mit dem entzückendsten Steinornament überzog,
das irgendeine Zeit hervorgebracht hat. Diesem Stile
gehören die ersten Bauten von Belang an, welche die
Spanier in Amerika errichtet haben. In den allermeisten
Fällen waren das Kirchen und Klöster, denn ungleich
den in Nordamerika gelandeten Engländern verfolg-
ten die Spanier und Portugiesen sehr eifrig das Ziel
der Heidenbekehrung, und die spanischen Mönche
haben die amerikanische Wildnis vielleicht eifriger
durchforscht als die Goldsucher. Überall entstanden
Klöster, Kirchen und Kapellen, und diese Baulust hielt
an bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein und
hörte für Kalifornien erst auf, als Spanien diese
Besitzungen den Vereinigten Staaten verkauft hatte.
Dann zogen sich die Mönche allmählich aus dem Lande
zurück, ihre Klöster und Kirchen, die oft an einsamen
Stellen gelegen waren, verfielen, und ihre eingeborenen
Gemeinden verschwanden, ausgerottet von den hab-
süchtigen Abenteurern, die vor sechzig Jahren das neue
Goldland aufsuchten.
Nur wenige Klöster und Kirchen aus der Spanier-
zeit haben sich in Kalifornien erhalten, von den meisten
sind nur noch Trümmer übrig. Was davon nicht in
dem erwähnten plateresken Stil ist, zeigt den Schwulst
der überladenen Dekoration, wie er von dem Archi-
tekten Churriguerra in die spanische Baukunst getra-
gen wurde, und einiges klingt sogar an das tändelnde
Rokoko an. Dabei aber, und das ist das Merkwürdige
und Interessante, ging es hier, wie es schon in Spa-
nien selbst gegangen war, als die christlichen Bauherren
ihre Kirchen von maurischen Werkleuten aufführen
ließen. Auch in Amerika waren nur die Architekten
Spanier, gebaut wurde von den einheimischen Indianern.
Diese nun dürfen durchaus nicht mit ihren Brüdern
und Vettern im Norden verwechselt werden. Die In-
dianer in Nordamerika waren Nomaden, die bei ihrer
herumziehenden Lebensweise selbstverständlich zu
keiner irgendwie ausgebildeten Kunstübung und am
allerwenigsten zu einer Baukunst gelangen konnten.
In Mittelamerika dagegen bildeten die Eingeborenen
blühende und mächtige Gemeinwesen, die sich einer
schönen und eigenartigen Kultur erfreuten und deren
Bauruinen jeden mit Staunen erfüllen, der die In-
dianer nur aus den Geschichten Fenimore Coopers
kennt.
Auch von diesen Denkmalen einer von den euro-
päischen Eindringlingen leider zerstörten Kultur ist
einiges nach San Diego gekommen, gewaltige Stein-
male, die sowohl an die Menhire der Bretagne als
auch an assyrische Denkmäler erinnern, und Ansichten
und Pläne von riesigen Tempelbauten, bei denen man
an die ungeheuren Tempelanlagen Ägyptens und zu-
gleich an die wunderbaren Formen der in Jahrtausenden,
wenn nicht in Jahrmillionen aus dem Gestein heraus-
gewaschenen Felsberge des Großen Canyon denkt, der
in eben dieser Gegend Amerikas liegt und den Er-
bauern dieser Tempel gewiß nicht unbekannt war.
Genau diese abgestumpften, vierseitigen Pyramiden
sieht man aus der Tiefe des Großen Canyon bis zur
Höhe des Gipfelrandes aufragen.
Es ist also natürlich, daß ein Volk, das eine so
ausgebildete Architektur besaß wie diese Mittelameri-
kaner, sich von den fremden Architekten nicht ganz
unterdrücken ließ. Wie vorher die spanischen Mauren,
so schmuggelten jetzt die einheimischen amerikanischen
Werkleute hie und da etwas von ihren ererbten Formen
in die Pläne der europäischen Bauherren, und mitunter
scheinen sie, wo die leitenden Mönche von der Baukunst
wenig oder nichts verstanden, den ganzen Bau nach
ihrer Ansicht aufgeführt zu haben, nur auf den Zweck
bedacht und für Glockenturm oder vielmehr Glocken-
giebel und Kirchenraum besorgt.
Es ist nun das Verdienst der Leute von San Diego,
daß sie ihre ganze Ausstellung in der Art dieses spani-
schen Missionsstils eingerichtet, die merkwürdigsten
Glockengiebel, Klosterhöfe, Kapellen, sowie Einzelheiten
von Portalen, Fenstern, Kanzeln usw. kopiert und so
gewissermaßen ein Museum dieses Stiles gegeben haben.
Das Museum wirkt um so überzeugender, weil seine
jungen Mauern, dank der gewaltigen Kraft der Vege-
tation in diesem gesegneten Himmelsstrich mit Kletter-
pflanzen und Blumengewinden überzogen und bedeckt
sind, was den Bauten ganz das Provisorische und Ephe-
mere von Ausstellungspalästen nimmt und ihnen einen
echten, dauernden Anstrich gibt.
Von dem Inhalte der Gebäude wäre an dieser
Stelle nicht viel zu sagen, obgleich auch einige hundert
moderne Gemälde und Skulpturen gezeigt werden,
deren Urheber zum Überfluß in Paris die Kunstschulen
besucht haben, wenn nicht ein gelehrter Archäolog
einen ganzen weiten Raum mit systematisch geord-
neten symbolischen Gemälden der Indianer angefüllt
hätte. Diese Malereien sind im höchsten Grade in-
teressant. Im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende
hatten die Zeichner der Pueblo-, Hopi- und Zuni-
Indianer eine synthetische Kunst entwickelt, gleichsam
eine Stenographie der tierischen und pflanzlichen For-
men, wie sie in unseren Tagen von den geschicktesten
Zeichnern nicht besser gehandhabt worden ist und wie
auch die Chinesen und Japaner sie nicht bestimmter,
kürzer und klarer gekannt haben.
Mit der Kunst Ostasiens hat diese amerikanische
Übung sonst nicht viel gemein. Ihr fehlt durchaus
das Zarte, Delikate, Weibliche der fein nuancierten
Farbenübergänge. Es ist eine sehr starke, männliche
Kunst. Mit phönikischen, kyprischen, ägyptischen und
frühgriechischen Malereien hat sie mehr Ähnlichkeit
als mit irgend einer andern Kunst. Sie zeichnet ihre
Formen in sehr festen und bestimmten Linien, die dann
ebenso sicher und fest ohne nuancierte Übergänge aus-
gefärbt werden. Die Farben werden unvermittelt neben-
einander gesetzt, aber man kann nicht sagen, daß die
Malereien bunt oder grell wirkten. Im Gegenteil be-
wundert man den zwar urwüchsigen, an vollen, un-
gebrochenen Farben sich freuenden, aber doch ge-
schmackvoll zu volltönenden Harmonien greifenden
Amerikanische Ausstellungsbriefe
550
nannten arabischen Stiles in die Gotik und Renais-
sance einschmuggelten. Diese Freude an Ornamen-
ten führte zunächst zum Mudejar, dann in der Zeit,
die uns hier angeht, denn damals kamen die Spanier
nach Amerika, zum plateresken Stil, dem Stile der Sil-
berschmiede, der alle Mauerflächen der Renaissance-
bauten mit dem entzückendsten Steinornament überzog,
das irgendeine Zeit hervorgebracht hat. Diesem Stile
gehören die ersten Bauten von Belang an, welche die
Spanier in Amerika errichtet haben. In den allermeisten
Fällen waren das Kirchen und Klöster, denn ungleich
den in Nordamerika gelandeten Engländern verfolg-
ten die Spanier und Portugiesen sehr eifrig das Ziel
der Heidenbekehrung, und die spanischen Mönche
haben die amerikanische Wildnis vielleicht eifriger
durchforscht als die Goldsucher. Überall entstanden
Klöster, Kirchen und Kapellen, und diese Baulust hielt
an bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein und
hörte für Kalifornien erst auf, als Spanien diese
Besitzungen den Vereinigten Staaten verkauft hatte.
Dann zogen sich die Mönche allmählich aus dem Lande
zurück, ihre Klöster und Kirchen, die oft an einsamen
Stellen gelegen waren, verfielen, und ihre eingeborenen
Gemeinden verschwanden, ausgerottet von den hab-
süchtigen Abenteurern, die vor sechzig Jahren das neue
Goldland aufsuchten.
Nur wenige Klöster und Kirchen aus der Spanier-
zeit haben sich in Kalifornien erhalten, von den meisten
sind nur noch Trümmer übrig. Was davon nicht in
dem erwähnten plateresken Stil ist, zeigt den Schwulst
der überladenen Dekoration, wie er von dem Archi-
tekten Churriguerra in die spanische Baukunst getra-
gen wurde, und einiges klingt sogar an das tändelnde
Rokoko an. Dabei aber, und das ist das Merkwürdige
und Interessante, ging es hier, wie es schon in Spa-
nien selbst gegangen war, als die christlichen Bauherren
ihre Kirchen von maurischen Werkleuten aufführen
ließen. Auch in Amerika waren nur die Architekten
Spanier, gebaut wurde von den einheimischen Indianern.
Diese nun dürfen durchaus nicht mit ihren Brüdern
und Vettern im Norden verwechselt werden. Die In-
dianer in Nordamerika waren Nomaden, die bei ihrer
herumziehenden Lebensweise selbstverständlich zu
keiner irgendwie ausgebildeten Kunstübung und am
allerwenigsten zu einer Baukunst gelangen konnten.
In Mittelamerika dagegen bildeten die Eingeborenen
blühende und mächtige Gemeinwesen, die sich einer
schönen und eigenartigen Kultur erfreuten und deren
Bauruinen jeden mit Staunen erfüllen, der die In-
dianer nur aus den Geschichten Fenimore Coopers
kennt.
Auch von diesen Denkmalen einer von den euro-
päischen Eindringlingen leider zerstörten Kultur ist
einiges nach San Diego gekommen, gewaltige Stein-
male, die sowohl an die Menhire der Bretagne als
auch an assyrische Denkmäler erinnern, und Ansichten
und Pläne von riesigen Tempelbauten, bei denen man
an die ungeheuren Tempelanlagen Ägyptens und zu-
gleich an die wunderbaren Formen der in Jahrtausenden,
wenn nicht in Jahrmillionen aus dem Gestein heraus-
gewaschenen Felsberge des Großen Canyon denkt, der
in eben dieser Gegend Amerikas liegt und den Er-
bauern dieser Tempel gewiß nicht unbekannt war.
Genau diese abgestumpften, vierseitigen Pyramiden
sieht man aus der Tiefe des Großen Canyon bis zur
Höhe des Gipfelrandes aufragen.
Es ist also natürlich, daß ein Volk, das eine so
ausgebildete Architektur besaß wie diese Mittelameri-
kaner, sich von den fremden Architekten nicht ganz
unterdrücken ließ. Wie vorher die spanischen Mauren,
so schmuggelten jetzt die einheimischen amerikanischen
Werkleute hie und da etwas von ihren ererbten Formen
in die Pläne der europäischen Bauherren, und mitunter
scheinen sie, wo die leitenden Mönche von der Baukunst
wenig oder nichts verstanden, den ganzen Bau nach
ihrer Ansicht aufgeführt zu haben, nur auf den Zweck
bedacht und für Glockenturm oder vielmehr Glocken-
giebel und Kirchenraum besorgt.
Es ist nun das Verdienst der Leute von San Diego,
daß sie ihre ganze Ausstellung in der Art dieses spani-
schen Missionsstils eingerichtet, die merkwürdigsten
Glockengiebel, Klosterhöfe, Kapellen, sowie Einzelheiten
von Portalen, Fenstern, Kanzeln usw. kopiert und so
gewissermaßen ein Museum dieses Stiles gegeben haben.
Das Museum wirkt um so überzeugender, weil seine
jungen Mauern, dank der gewaltigen Kraft der Vege-
tation in diesem gesegneten Himmelsstrich mit Kletter-
pflanzen und Blumengewinden überzogen und bedeckt
sind, was den Bauten ganz das Provisorische und Ephe-
mere von Ausstellungspalästen nimmt und ihnen einen
echten, dauernden Anstrich gibt.
Von dem Inhalte der Gebäude wäre an dieser
Stelle nicht viel zu sagen, obgleich auch einige hundert
moderne Gemälde und Skulpturen gezeigt werden,
deren Urheber zum Überfluß in Paris die Kunstschulen
besucht haben, wenn nicht ein gelehrter Archäolog
einen ganzen weiten Raum mit systematisch geord-
neten symbolischen Gemälden der Indianer angefüllt
hätte. Diese Malereien sind im höchsten Grade in-
teressant. Im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende
hatten die Zeichner der Pueblo-, Hopi- und Zuni-
Indianer eine synthetische Kunst entwickelt, gleichsam
eine Stenographie der tierischen und pflanzlichen For-
men, wie sie in unseren Tagen von den geschicktesten
Zeichnern nicht besser gehandhabt worden ist und wie
auch die Chinesen und Japaner sie nicht bestimmter,
kürzer und klarer gekannt haben.
Mit der Kunst Ostasiens hat diese amerikanische
Übung sonst nicht viel gemein. Ihr fehlt durchaus
das Zarte, Delikate, Weibliche der fein nuancierten
Farbenübergänge. Es ist eine sehr starke, männliche
Kunst. Mit phönikischen, kyprischen, ägyptischen und
frühgriechischen Malereien hat sie mehr Ähnlichkeit
als mit irgend einer andern Kunst. Sie zeichnet ihre
Formen in sehr festen und bestimmten Linien, die dann
ebenso sicher und fest ohne nuancierte Übergänge aus-
gefärbt werden. Die Farben werden unvermittelt neben-
einander gesetzt, aber man kann nicht sagen, daß die
Malereien bunt oder grell wirkten. Im Gegenteil be-
wundert man den zwar urwüchsigen, an vollen, un-
gebrochenen Farben sich freuenden, aber doch ge-
schmackvoll zu volltönenden Harmonien greifenden