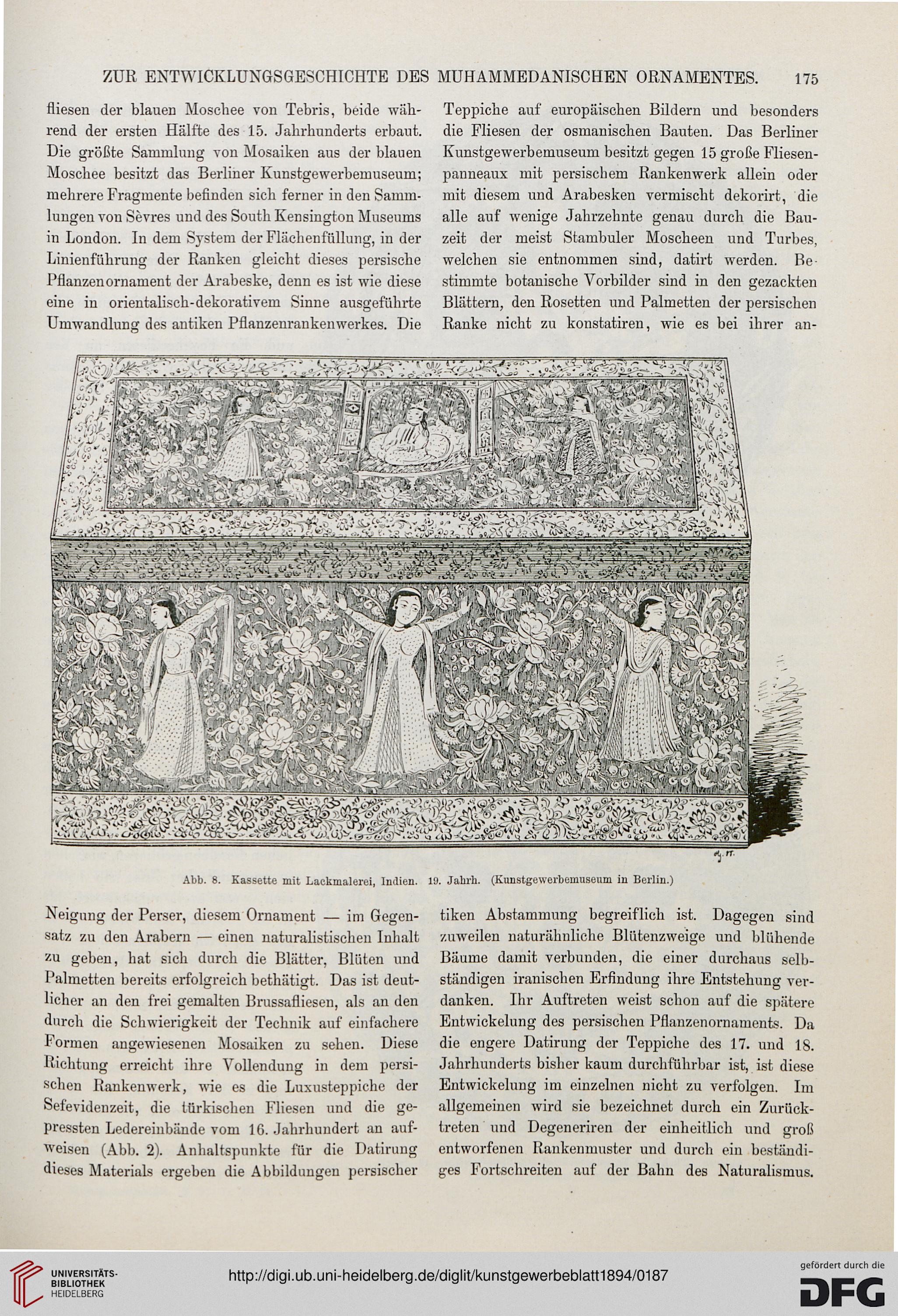ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES MUHAMMEDANISCHEN ORNAMENTES.
175
fliesen der blauen Moschee von Tebris, beide wäh-
rend der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut.
Die größte Sammlung von Mosaiken aus der blauen
Moschee besitzt das Berliner Kunstgewerbemuseum;
mehrere Fragmente befinden sich ferner in den Samm-
lungen von Sevres und des South Kensington Museums
in London. In dem System der Flächenfüllung, in der
Linienführung der Ranken gleicht dieses persische
Pflanzenornament der Arabeske, denn es ist wie diese
eine in orientalisch-dekorativem Sinne ausgeführte
Umwandlung des antiken Pflanzenrankenwerkes. Die
Teppiche auf europäischen Bildern und besonders
die Fliesen der osmanischen Bauten. Das Berliner
Kunstgewerbemuseum besitzt gegen 15 große Fliesen-
panneaux mit persischem Rankenwerk allein oder
mit diesem und Arabesken vermischt dekorirt, die
alle auf wenige Jahrzehnte genau durch die Bau-
zeit der meist Stambuler Moscheen und Turbes,
welchen sie entnommen sind, datirt werden. Be-
stimmte botanische Vorbilder sind in den gezackten
Blättern, den Rosetten und Palmetten der persischen
Ranke nicht zu konstatiren, wie es bei ihrer an-
Abb. 8. Kassette mit Lackmalerei, Indien. 19. Jabrh. (Kunstgewerbemuseum in Berlin.)
Neigung der Perser, diesem Ornament — im Gegen-
satz zu den Arabern — einen naturalistischen Inhalt
zu geben, hat sich durch die Blätter, Blüten und
Palmetten bereits erfolgreich bethätigt. Das ist deut-
licher an den frei gemalten Brussafliesen, als an den
durch die Schwierigkeit der Technik auf einfachere
Formen angewiesenen Mosaiken zu sehen. Diese
Richtung erreicht ihre Vollendung in dem persi-
schen Rankenwerk, wie es die Luxusteppiche der
Sefevidenzeit, die türkischen Fliesen und die ge-
pressten Ledereinbände vom 16. Jahrhundert an auf-
weisen (Abb. 2). Anhaltspunkte für die Datirung
dieses Materials ergeben die Abbildungen persischer
tiken Abstammung begreiflich ist. Dagegen sind
zuweilen naturähnliche Blütenzweige und blühende
Bäume damit verbunden, die einer durchaus selb-
ständigen iranischen Erfindung ihre Entstehung ver-
danken. Ihr Auftreten weist schon auf die spätere
Entwickelung des persischen Pflanzenornaments. Da
die engere Datirung der Teppiche des 17. und 18.
Jahrhunderts bisher kaum durchführbar ist, ist diese
Entwickelung im einzelnen nicht zu verfolgen. Im
allgemeinen wird sie bezeichnet durch ein Zurück-
treten und Degeneriren der einheitlich und groß
entworfenen Rankenmuster und durch ein beständi-
ges Fortschreiten auf der Bahn des Naturalismus.
175
fliesen der blauen Moschee von Tebris, beide wäh-
rend der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaut.
Die größte Sammlung von Mosaiken aus der blauen
Moschee besitzt das Berliner Kunstgewerbemuseum;
mehrere Fragmente befinden sich ferner in den Samm-
lungen von Sevres und des South Kensington Museums
in London. In dem System der Flächenfüllung, in der
Linienführung der Ranken gleicht dieses persische
Pflanzenornament der Arabeske, denn es ist wie diese
eine in orientalisch-dekorativem Sinne ausgeführte
Umwandlung des antiken Pflanzenrankenwerkes. Die
Teppiche auf europäischen Bildern und besonders
die Fliesen der osmanischen Bauten. Das Berliner
Kunstgewerbemuseum besitzt gegen 15 große Fliesen-
panneaux mit persischem Rankenwerk allein oder
mit diesem und Arabesken vermischt dekorirt, die
alle auf wenige Jahrzehnte genau durch die Bau-
zeit der meist Stambuler Moscheen und Turbes,
welchen sie entnommen sind, datirt werden. Be-
stimmte botanische Vorbilder sind in den gezackten
Blättern, den Rosetten und Palmetten der persischen
Ranke nicht zu konstatiren, wie es bei ihrer an-
Abb. 8. Kassette mit Lackmalerei, Indien. 19. Jabrh. (Kunstgewerbemuseum in Berlin.)
Neigung der Perser, diesem Ornament — im Gegen-
satz zu den Arabern — einen naturalistischen Inhalt
zu geben, hat sich durch die Blätter, Blüten und
Palmetten bereits erfolgreich bethätigt. Das ist deut-
licher an den frei gemalten Brussafliesen, als an den
durch die Schwierigkeit der Technik auf einfachere
Formen angewiesenen Mosaiken zu sehen. Diese
Richtung erreicht ihre Vollendung in dem persi-
schen Rankenwerk, wie es die Luxusteppiche der
Sefevidenzeit, die türkischen Fliesen und die ge-
pressten Ledereinbände vom 16. Jahrhundert an auf-
weisen (Abb. 2). Anhaltspunkte für die Datirung
dieses Materials ergeben die Abbildungen persischer
tiken Abstammung begreiflich ist. Dagegen sind
zuweilen naturähnliche Blütenzweige und blühende
Bäume damit verbunden, die einer durchaus selb-
ständigen iranischen Erfindung ihre Entstehung ver-
danken. Ihr Auftreten weist schon auf die spätere
Entwickelung des persischen Pflanzenornaments. Da
die engere Datirung der Teppiche des 17. und 18.
Jahrhunderts bisher kaum durchführbar ist, ist diese
Entwickelung im einzelnen nicht zu verfolgen. Im
allgemeinen wird sie bezeichnet durch ein Zurück-
treten und Degeneriren der einheitlich und groß
entworfenen Rankenmuster und durch ein beständi-
ges Fortschreiten auf der Bahn des Naturalismus.