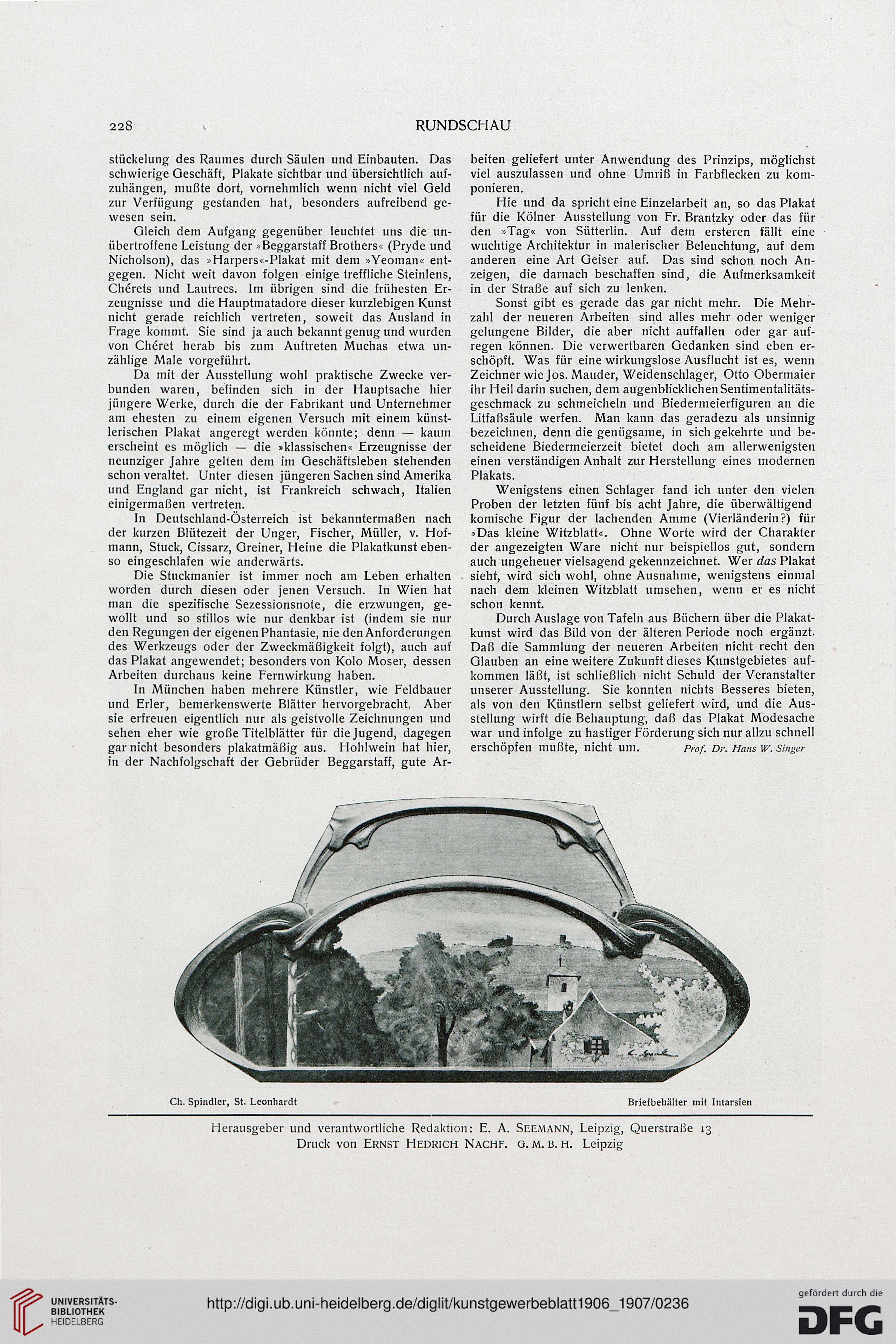228
RUNDSCHAU
Stückelung des Raumes durch Säulen und Einbauten. Das
schwierige Geschäft, Plakate sichtbar und übersichtlich auf-
zuhängen, mußte dort, vornehmlich wenn nicht viel Geld
zur Verfügung gestanden hat, besonders aufreibend ge-
wesen sein.
Gleich dem Aufgang gegenüber leuchtet uns die un-
übertroffene Leistung der »Beggarstaff Brothers« (Pryde und
Nicholson), das »Harpers«-Plakat mit dem »Yeoman« ent-
gegen. Nicht weit davon folgen einige treffliche Steinlens,
Cherets und Lautrecs. Im übrigen sind die frühesten Er-
zeugnisse und die Hauptmatadore dieser kurzlebigen Kunst
nicht gerade reichlich vertreten, soweit das Ausland in
Frage kommt. Sie sind ja auch bekannt genug und wurden
von Cheret herab bis zum Auftreten Muchas etwa un-
zählige Male vorgeführt.
Da mit der Ausstellung wohl praktische Zwecke ver-
bunden waren, befinden sich in der Hauptsache hier
jüngere Werke, durch die der Fabrikant und Unternehmer
am ehesten zu einem eigenen Versuch mit einem künst-
lerischen Plakat angeregt werden könnte; denn — kaum
erscheint es möglich — die »klassischen« Erzeugnisse der
neunziger Jahre gelten dem im Geschäftsleben stehenden
schon veraltet. Unter diesen jüngeren Sachen sind Amerika
und England gar nicht, ist Frankreich schwach, Italien
einigermaßen vertreten.
In Deutschland-Österreich ist bekanntermaßen nach
der kurzen Blütezeit der Unger, Fischer, Müller, v. Hof-
mann, Stuck, Cissarz, Greiner, Heine die Plakatkunst eben-
so eingeschlafen wie anderwärts.
Die Stuckmanier ist immer noch am Leben erhalten
worden durch diesen oder jenen Versuch. In Wien hat
man die spezifische Sezessionsnote, die erzwungen, ge-
wollt und so stillos wie nur denkbar ist (indem sie nur
den Regungen der eigenen Phantasie, nie den Anforderungen
des Werkzeugs oder der Zweckmäßigkeit folgt), auch auf
das Plakat angewendet; besonders von Kolo Moser, dessen
Arbeiten durchaus keine Fernwirkung haben.
In München haben mehrere Künstler, wie Feldbauer
und Erler, bemerkenswerte Blätter hervorgebracht. Aber
sie erfreuen eigentlich nur als geistvolle Zeichnungen und
sehen eher wie große Titelblätter für die Jugend, dagegen
gar nicht besonders plakatmäßig aus. Hohlwein hat hier,
in der Nachfolgschaft der Gebrüder Beggarstaff, gute Ar-
beiten geliefert unter Anwendung des Prinzips, möglichst
viel auszulassen und ohne Umriß in Farbflecken zu kom-
ponieren.
Hie und da spricht eine Einzelarbeit an, so das Plakat
für die Kölner Ausstellung von Fr. Brantzky oder das für
den »Tag« von Sütterlin. Auf dem ersteren fällt eine
wuchtige Architektur in malerischer Beleuchtung, auf dem
anderen eine Art Geiser auf. Das sind schon noch An-
zeigen, die darnach beschaffen sind, die Aufmerksamkeit
in der Straße auf sich zu lenken.
Sonst gibt es gerade das gar nicht mehr. Die Mehr-
zahl der neueren Arbeiten sind alles mehr oder weniger
gelungene Bilder, die aber nicht auffallen oder gar auf-
regen können. Die verwertbaren Gedanken sind eben er-
schöpft. Was für eine wirkungslose Ausflucht ist es, wenn
Zeichner wie Jos. Mauder, Weidenschlager, Otto Obermaier
ihr Heil darin suchen, dem augenblicklichenSentimentalitäts-
geschmack zu schmeicheln und Biedermeierfiguren an die
Litfaßsäule werfen. Man kann das geradezu als unsinnig
bezeichnen, denn die genügsame, in sich gekehrte und be-
scheidene Biedermeierzeit bietet doch am allerwenigsten
einen verständigen Anhalt zur Herstellung eines modernen
Plakats.
Wenigstens einen Schlager fand ich unter den vielen
Proben der letzten fünf bis acht Jahre, die überwältigend
komische Figur der lachenden Amme (Vierländerin?) für
»Das kleine Witzblatt«. Ohne Worte wird der Charakter
der angezeigten Ware nicht nur beispiellos gut, sondern
auch ungeheuer vielsagend gekennzeichnet. Wer das Plakat
sieht, wird sich wohl, ohne Ausnahme, wenigstens einmal
nach dem kleinen Witzblatt umsehen, wenn er es nicht
schon kennt.
Durch Auslage von Tafeln aus Büchern über die Plakat-
kunst wird das Bild von der älteren Periode noch ergänzt.
Daß die Sammlung der neueren Arbeiten nicht recht den
Glauben an eine weitere Zukunft dieses Kunstgebietes auf-
kommen läßt, ist schließlich nicht Schuld der Veranstalter
unserer Ausstellung. Sie konnten nichts Besseres bieten,
als von den Künstlern selbst geliefert wird, und die Aus-
stellung wirft die Behauptung, daß das Plakat Modesache
war und infolge zu hastiger Förderung sich nur allzu schnell
erschöpfen mußte, nicht Um. Prof. Dr. Hans W. Singer
Cli. Spindler, St. Leonhardt
Briefbehälter mit Intarsien
Herausgeber und verantwortliche Redaktion: E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13
Druck von Ernst Hedrich Nachf. o. m. b. h. Leipzig
RUNDSCHAU
Stückelung des Raumes durch Säulen und Einbauten. Das
schwierige Geschäft, Plakate sichtbar und übersichtlich auf-
zuhängen, mußte dort, vornehmlich wenn nicht viel Geld
zur Verfügung gestanden hat, besonders aufreibend ge-
wesen sein.
Gleich dem Aufgang gegenüber leuchtet uns die un-
übertroffene Leistung der »Beggarstaff Brothers« (Pryde und
Nicholson), das »Harpers«-Plakat mit dem »Yeoman« ent-
gegen. Nicht weit davon folgen einige treffliche Steinlens,
Cherets und Lautrecs. Im übrigen sind die frühesten Er-
zeugnisse und die Hauptmatadore dieser kurzlebigen Kunst
nicht gerade reichlich vertreten, soweit das Ausland in
Frage kommt. Sie sind ja auch bekannt genug und wurden
von Cheret herab bis zum Auftreten Muchas etwa un-
zählige Male vorgeführt.
Da mit der Ausstellung wohl praktische Zwecke ver-
bunden waren, befinden sich in der Hauptsache hier
jüngere Werke, durch die der Fabrikant und Unternehmer
am ehesten zu einem eigenen Versuch mit einem künst-
lerischen Plakat angeregt werden könnte; denn — kaum
erscheint es möglich — die »klassischen« Erzeugnisse der
neunziger Jahre gelten dem im Geschäftsleben stehenden
schon veraltet. Unter diesen jüngeren Sachen sind Amerika
und England gar nicht, ist Frankreich schwach, Italien
einigermaßen vertreten.
In Deutschland-Österreich ist bekanntermaßen nach
der kurzen Blütezeit der Unger, Fischer, Müller, v. Hof-
mann, Stuck, Cissarz, Greiner, Heine die Plakatkunst eben-
so eingeschlafen wie anderwärts.
Die Stuckmanier ist immer noch am Leben erhalten
worden durch diesen oder jenen Versuch. In Wien hat
man die spezifische Sezessionsnote, die erzwungen, ge-
wollt und so stillos wie nur denkbar ist (indem sie nur
den Regungen der eigenen Phantasie, nie den Anforderungen
des Werkzeugs oder der Zweckmäßigkeit folgt), auch auf
das Plakat angewendet; besonders von Kolo Moser, dessen
Arbeiten durchaus keine Fernwirkung haben.
In München haben mehrere Künstler, wie Feldbauer
und Erler, bemerkenswerte Blätter hervorgebracht. Aber
sie erfreuen eigentlich nur als geistvolle Zeichnungen und
sehen eher wie große Titelblätter für die Jugend, dagegen
gar nicht besonders plakatmäßig aus. Hohlwein hat hier,
in der Nachfolgschaft der Gebrüder Beggarstaff, gute Ar-
beiten geliefert unter Anwendung des Prinzips, möglichst
viel auszulassen und ohne Umriß in Farbflecken zu kom-
ponieren.
Hie und da spricht eine Einzelarbeit an, so das Plakat
für die Kölner Ausstellung von Fr. Brantzky oder das für
den »Tag« von Sütterlin. Auf dem ersteren fällt eine
wuchtige Architektur in malerischer Beleuchtung, auf dem
anderen eine Art Geiser auf. Das sind schon noch An-
zeigen, die darnach beschaffen sind, die Aufmerksamkeit
in der Straße auf sich zu lenken.
Sonst gibt es gerade das gar nicht mehr. Die Mehr-
zahl der neueren Arbeiten sind alles mehr oder weniger
gelungene Bilder, die aber nicht auffallen oder gar auf-
regen können. Die verwertbaren Gedanken sind eben er-
schöpft. Was für eine wirkungslose Ausflucht ist es, wenn
Zeichner wie Jos. Mauder, Weidenschlager, Otto Obermaier
ihr Heil darin suchen, dem augenblicklichenSentimentalitäts-
geschmack zu schmeicheln und Biedermeierfiguren an die
Litfaßsäule werfen. Man kann das geradezu als unsinnig
bezeichnen, denn die genügsame, in sich gekehrte und be-
scheidene Biedermeierzeit bietet doch am allerwenigsten
einen verständigen Anhalt zur Herstellung eines modernen
Plakats.
Wenigstens einen Schlager fand ich unter den vielen
Proben der letzten fünf bis acht Jahre, die überwältigend
komische Figur der lachenden Amme (Vierländerin?) für
»Das kleine Witzblatt«. Ohne Worte wird der Charakter
der angezeigten Ware nicht nur beispiellos gut, sondern
auch ungeheuer vielsagend gekennzeichnet. Wer das Plakat
sieht, wird sich wohl, ohne Ausnahme, wenigstens einmal
nach dem kleinen Witzblatt umsehen, wenn er es nicht
schon kennt.
Durch Auslage von Tafeln aus Büchern über die Plakat-
kunst wird das Bild von der älteren Periode noch ergänzt.
Daß die Sammlung der neueren Arbeiten nicht recht den
Glauben an eine weitere Zukunft dieses Kunstgebietes auf-
kommen läßt, ist schließlich nicht Schuld der Veranstalter
unserer Ausstellung. Sie konnten nichts Besseres bieten,
als von den Künstlern selbst geliefert wird, und die Aus-
stellung wirft die Behauptung, daß das Plakat Modesache
war und infolge zu hastiger Förderung sich nur allzu schnell
erschöpfen mußte, nicht Um. Prof. Dr. Hans W. Singer
Cli. Spindler, St. Leonhardt
Briefbehälter mit Intarsien
Herausgeber und verantwortliche Redaktion: E. A. Seemann, Leipzig, Querstraße 13
Druck von Ernst Hedrich Nachf. o. m. b. h. Leipzig