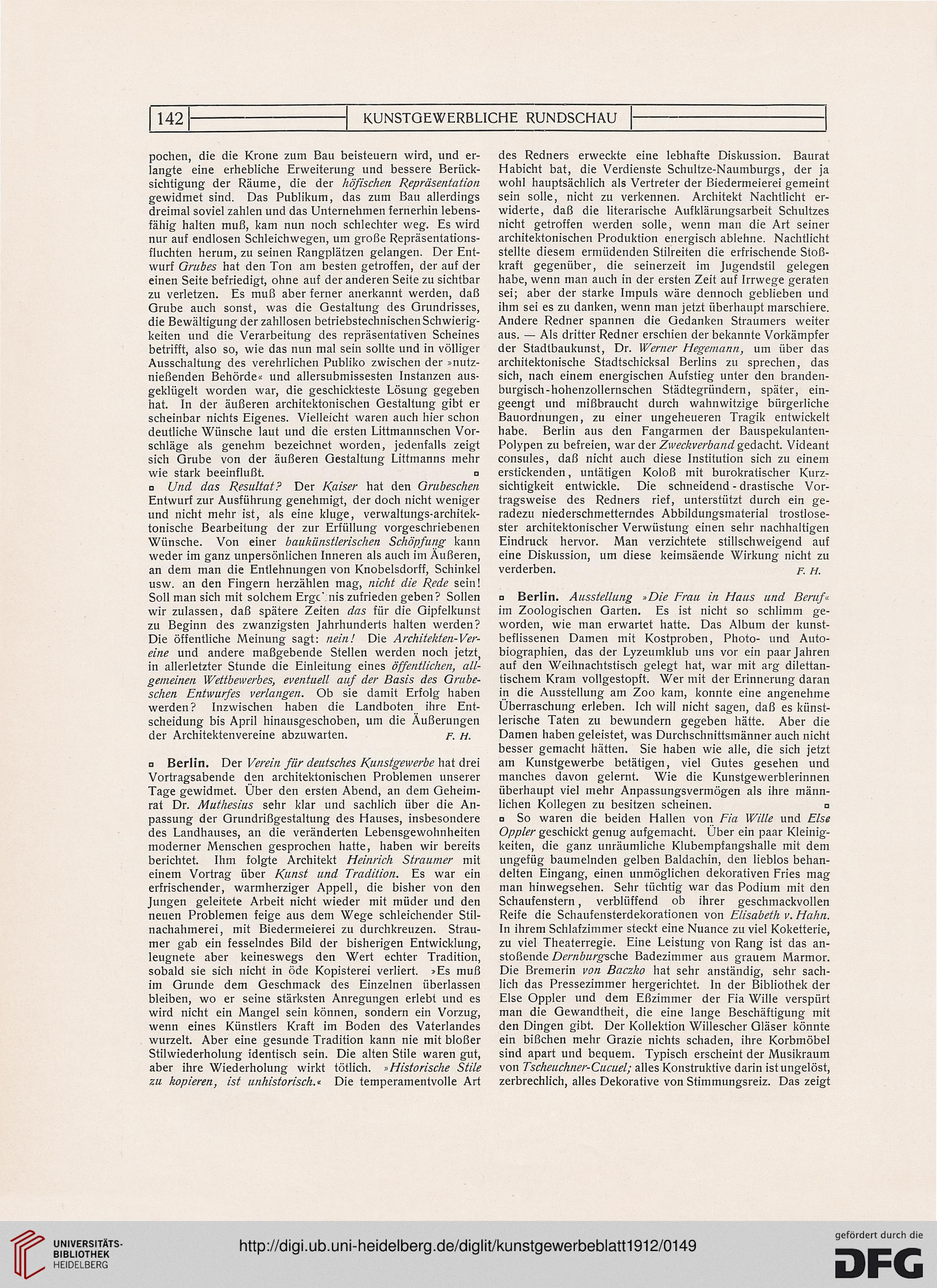KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
142
pochen, die die Krone zum Bau beisteuern wird, und er-
langte eine erhebliche Erweiterung und bessere Berück-
sichtigung der Räume, die der höfischen Repräsentation
gewidmet sind. Das Publikum, das zum Bau allerdings
dreimal soviel zahlen und das Unternehmen fernerhin lebens-
fähig halten muß, kam nun noch schlechter weg. Es wird
nur auf endlosen Schleichwegen, um große Repräsentations-
fluchten herum, zu seinen Rangplätzen gelangen. Der Ent-
wurf Grabes hat den Ton am besten getroffen, der auf der
einen Seite befriedigt, ohne auf der anderen Seite zu sichtbar
zu verletzen. Es muß aber ferner anerkannt werden, daß
Grube auch sonst, was die Gestaltung des Grundrisses,
die Bewältigung der zahllosen betriebstechnischen Schwierig-
keiten und die Verarbeitung des repräsentativen Scheines
betrifft, also so, wie das nun mal sein sollte und in völliger
Ausschaltung des verehrlichen Publiko zwischen der »nutz-
nießenden Behörde« und allersubmissesten Instanzen aus-
geklügelt worden war, die geschickteste Lösung gegeben
hat. In der äußeren architektonischen Gestaltung gibt er
scheinbar nichts Eigenes. Vielleicht waren auch hier schon
deutliche Wünsche laut und die ersten Littmannschen Vor-
schläge als genehm bezeichnet worden, jedenfalls zeigt
sich Grube von der äußeren Gestaltung Littmanns mehr
wie stark beeinflußt. □
n Und das Resultat? Der Kaiser hat den Grubeschen
Entwurf zur Ausführung genehmigt, der doch nicht weniger
und nicht mehr ist, als eine kluge, verwaltungs-architek-
tonische Bearbeitung der zur Erfüllung vorgeschriebenen
Wünsche. Von einer baukünstlerischen Schöpfung kann
weder im ganz unpersönlichen Inneren als auch im Äußeren,
an dem man die Entlehnungen von Knobelsdorff, Schinkel
usw. an den Fingern herzählen mag, nicht die Rede sein!
Soll man sich mit solchem Ergc' nis zufrieden geben? Sollen
wir zulassen, daß spätere Zeiten das für die Gipfelkunst
zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts halten werden?
Die öffentliche Meinung sagt: nein! Die Architekten-Ver-
eine und andere maßgebende Stellen werden noch jetzt,
in allerletzter Stunde die Einleitung eines öffentlichen, all-
gemeinen Wettbewerbes, eventuell auf der Basis des Grube-
schen Entwurfes verlangen. Ob sie damit Erfolg haben
werden? Inzwischen haben die Landboten ihre Ent-
scheidung bis April hinausgeschoben, um die Äußerungen
der Architektenvereine abzuwarten. p. h.
n Berlin. Der Verein für deutsches Kunstgewerbe hat drei
Vortragsabende den architektonischen Problemen unserer
Tage gewidmet. Über den ersten Abend, an dem Geheim-
rat Dr. Muthesius sehr klar und sachlich über die An-
passung der Grundrißgestaltung des Hauses, insbesondere
des Landhauses, an die veränderten Lebensgewohnheiten
moderner Menschen gesprochen hatte, haben wir bereits
berichtet. Ihm folgte Architekt Heinrich Straumer mit
einem Vortrag über Kunst und Tradition. Es war ein
erfrischender, warmherziger Appell, die bisher von den
Jungen geleitete Arbeit nicht wieder mit müder und den
neuen Problemen feige aus dem Wege schleichender Stil-
nachahmerei, mit Biedermeierei zu durchkreuzen. Strau-
mer gab ein fesselndes Bild der bisherigen Entwicklung,
leugnete aber keineswegs den Wert echter Tradition,
sobald sie sich nicht in öde Kopisterei verliert. »Es muß
im Grunde dem Geschmack des Einzelnen überlassen
bleiben, wo er seine stärksten Anregungen erlebt und es
wird nicht ein Mangel sein können, sondern ein Vorzug,
wenn eines Künstlers Kraft im Boden des Vaterlandes
wurzelt. Aber eine gesunde Tradition kann nie mit bloßer
Stilwiederholung identisch sein. Die alten Stile waren gut,
aber ihre Wiederholung wirkt tötlich. »Historische Stile
zu kopieren, ist unhistorisch.« Die temperamentvolle Art
des Redners erweckte eine lebhafte Diskussion. Baurat
Habicht bat, die Verdienste Schultze-Naumburgs, der ja
wohl hauptsächlich als Vertreter der Biedermeierei gemeint
sein solle, nicht zu verkennen. Architekt Nachtlicht er-
widerte, daß die literarische Aufklärungsarbeit Schultzes
nicht getroffen werden solle, wenn man die Art seiner
architektonischen Produktion energisch ablehne. Nachtlicht
stellte diesem ermüdenden Stilreiten die erfrischende Stoß-
kraft gegenüber, die seinerzeit im Jugendstil gelegen
habe, wenn man auch in der ersten Zeit auf Irrwege geraten
sei; aber der starke Impuls wäre dennoch geblieben und
ihm sei es zu danken, wenn man jetzt überhaupt marschiere.
Andere Redner spannen die Gedanken Straumers weiter
aus. — Als dritter Redner erschien der bekannte Vorkämpfer
der Stadtbaukunst, Dr. Werner Hegemann, um über das
architektonische Stadtschicksal Berlins zu sprechen, das
sich, nach einem energischen Aufstieg unter den branden-
burgisch-hohenzollernschen Städtegründern, später, ein-
geengt und mißbraucht durch wahnwitzige bürgerliche
Bauordnungen, zu einer ungeheueren Tragik entwickelt
habe. Berlin aus den Fangarmen der Bauspekulanten-
Polypen zu befreien, war der Zweckverband gedacht. Videant
consules, daß nicht auch diese Institution sich zu einem
erstickenden, untätigen Koloß mit bürokratischer Kurz-
sichtigkeit entwickle. Die schneidend - drastische Vor-
tragsweise des Redners rief, unterstützt durch ein ge-
radezu niederschmetterndes Abbildungsmaterial trostlose-
ster architektonischer Verwüstung einen sehr nachhaltigen
Eindruck hervor. Man verzichtete stillschweigend auf
eine Diskussion, um diese keimsäende Wirkung nicht zu
verderben. f. h.
□ Berlin. Ausstellung »Die Frau in Haus und Beruf«
im Zoologischen Garten. Es ist nicht so schlimm ge-
worden, wie man erwartet hatte. Das Album der kunst-
beflissenen Damen mit Kostproben, Photo- und Auto-
biographien, das der Lyzeumklub uns vor ein paar Jahren
auf den Weihnachtstisch gelegt hat, war mit arg dilettan-
tischem Kram vollgestopft. Wer mit der Erinnerung daran
in die Ausstellung am Zoo kam, konnte eine angenehme
Überraschung erleben. Ich will nicht sagen, daß es künst-
lerische Taten zu bewundern gegeben hätte. Aber die
Damen haben geleistet, was Durchschnittsmänner auch nicht
besser gemacht hätten. Sie haben wie alle, die sich jetzt
am Kunstgewerbe betätigen, viel Gutes gesehen und
manches davon gelernt. Wie die Kunstgewerblerinnen
überhaupt viel mehr Anpassungsvermögen als ihre männ-
lichen Kollegen zu besitzen scheinen. □
□ So waren die beiden Hallen von Fia Wille und Else
Oppler geschickt genug aufgemacht. Über ein paar Kleinig-
keiten, die ganz unräumliche Klubempfangshalle mit dem
ungefüg baumelnden gelben Baldachin, den lieblos behan-
delten Eingang, einen unmöglichen dekorativen Fries mag
man hinwegsehen. Sehr tüchtig war das Podium mit den
Schaufenstern, verblüffend ob ihrer geschmackvollen
Reife die Schaufensterdekorationen von Elisabeth v. Hahn.
In ihrem Schlafzimmer steckt eine Nuance zu viel Koketterie,
zu viel Theaterregie. Eine Leistung von Rang ist das an-
stoßende Dernburgsche Badezimmer aus grauem Marmor.
Die Bremerin von Baczko hat sehr anständig, sehr sach-
lich das Pressezimmer hergerichtet. In der Bibliothek der
Else Oppler und dem Eßzimmer der Fia Wille verspürt
man die Gewandtheit, die eine lange Beschäftigung mit
den Dingen gibt. Der Kollektion Willescher Gläser könnte
ein bißchen mehr Grazie nichts schaden, ihre Korbmöbel
sind apart und bequem. Typisch erscheint der Musikraum
von Tscheuchtier-Cucuel; alles Konstruktive darin ist ungelöst,
zerbrechlich, alles Dekorative von Stimmungsreiz. Das zeigt
142
pochen, die die Krone zum Bau beisteuern wird, und er-
langte eine erhebliche Erweiterung und bessere Berück-
sichtigung der Räume, die der höfischen Repräsentation
gewidmet sind. Das Publikum, das zum Bau allerdings
dreimal soviel zahlen und das Unternehmen fernerhin lebens-
fähig halten muß, kam nun noch schlechter weg. Es wird
nur auf endlosen Schleichwegen, um große Repräsentations-
fluchten herum, zu seinen Rangplätzen gelangen. Der Ent-
wurf Grabes hat den Ton am besten getroffen, der auf der
einen Seite befriedigt, ohne auf der anderen Seite zu sichtbar
zu verletzen. Es muß aber ferner anerkannt werden, daß
Grube auch sonst, was die Gestaltung des Grundrisses,
die Bewältigung der zahllosen betriebstechnischen Schwierig-
keiten und die Verarbeitung des repräsentativen Scheines
betrifft, also so, wie das nun mal sein sollte und in völliger
Ausschaltung des verehrlichen Publiko zwischen der »nutz-
nießenden Behörde« und allersubmissesten Instanzen aus-
geklügelt worden war, die geschickteste Lösung gegeben
hat. In der äußeren architektonischen Gestaltung gibt er
scheinbar nichts Eigenes. Vielleicht waren auch hier schon
deutliche Wünsche laut und die ersten Littmannschen Vor-
schläge als genehm bezeichnet worden, jedenfalls zeigt
sich Grube von der äußeren Gestaltung Littmanns mehr
wie stark beeinflußt. □
n Und das Resultat? Der Kaiser hat den Grubeschen
Entwurf zur Ausführung genehmigt, der doch nicht weniger
und nicht mehr ist, als eine kluge, verwaltungs-architek-
tonische Bearbeitung der zur Erfüllung vorgeschriebenen
Wünsche. Von einer baukünstlerischen Schöpfung kann
weder im ganz unpersönlichen Inneren als auch im Äußeren,
an dem man die Entlehnungen von Knobelsdorff, Schinkel
usw. an den Fingern herzählen mag, nicht die Rede sein!
Soll man sich mit solchem Ergc' nis zufrieden geben? Sollen
wir zulassen, daß spätere Zeiten das für die Gipfelkunst
zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts halten werden?
Die öffentliche Meinung sagt: nein! Die Architekten-Ver-
eine und andere maßgebende Stellen werden noch jetzt,
in allerletzter Stunde die Einleitung eines öffentlichen, all-
gemeinen Wettbewerbes, eventuell auf der Basis des Grube-
schen Entwurfes verlangen. Ob sie damit Erfolg haben
werden? Inzwischen haben die Landboten ihre Ent-
scheidung bis April hinausgeschoben, um die Äußerungen
der Architektenvereine abzuwarten. p. h.
n Berlin. Der Verein für deutsches Kunstgewerbe hat drei
Vortragsabende den architektonischen Problemen unserer
Tage gewidmet. Über den ersten Abend, an dem Geheim-
rat Dr. Muthesius sehr klar und sachlich über die An-
passung der Grundrißgestaltung des Hauses, insbesondere
des Landhauses, an die veränderten Lebensgewohnheiten
moderner Menschen gesprochen hatte, haben wir bereits
berichtet. Ihm folgte Architekt Heinrich Straumer mit
einem Vortrag über Kunst und Tradition. Es war ein
erfrischender, warmherziger Appell, die bisher von den
Jungen geleitete Arbeit nicht wieder mit müder und den
neuen Problemen feige aus dem Wege schleichender Stil-
nachahmerei, mit Biedermeierei zu durchkreuzen. Strau-
mer gab ein fesselndes Bild der bisherigen Entwicklung,
leugnete aber keineswegs den Wert echter Tradition,
sobald sie sich nicht in öde Kopisterei verliert. »Es muß
im Grunde dem Geschmack des Einzelnen überlassen
bleiben, wo er seine stärksten Anregungen erlebt und es
wird nicht ein Mangel sein können, sondern ein Vorzug,
wenn eines Künstlers Kraft im Boden des Vaterlandes
wurzelt. Aber eine gesunde Tradition kann nie mit bloßer
Stilwiederholung identisch sein. Die alten Stile waren gut,
aber ihre Wiederholung wirkt tötlich. »Historische Stile
zu kopieren, ist unhistorisch.« Die temperamentvolle Art
des Redners erweckte eine lebhafte Diskussion. Baurat
Habicht bat, die Verdienste Schultze-Naumburgs, der ja
wohl hauptsächlich als Vertreter der Biedermeierei gemeint
sein solle, nicht zu verkennen. Architekt Nachtlicht er-
widerte, daß die literarische Aufklärungsarbeit Schultzes
nicht getroffen werden solle, wenn man die Art seiner
architektonischen Produktion energisch ablehne. Nachtlicht
stellte diesem ermüdenden Stilreiten die erfrischende Stoß-
kraft gegenüber, die seinerzeit im Jugendstil gelegen
habe, wenn man auch in der ersten Zeit auf Irrwege geraten
sei; aber der starke Impuls wäre dennoch geblieben und
ihm sei es zu danken, wenn man jetzt überhaupt marschiere.
Andere Redner spannen die Gedanken Straumers weiter
aus. — Als dritter Redner erschien der bekannte Vorkämpfer
der Stadtbaukunst, Dr. Werner Hegemann, um über das
architektonische Stadtschicksal Berlins zu sprechen, das
sich, nach einem energischen Aufstieg unter den branden-
burgisch-hohenzollernschen Städtegründern, später, ein-
geengt und mißbraucht durch wahnwitzige bürgerliche
Bauordnungen, zu einer ungeheueren Tragik entwickelt
habe. Berlin aus den Fangarmen der Bauspekulanten-
Polypen zu befreien, war der Zweckverband gedacht. Videant
consules, daß nicht auch diese Institution sich zu einem
erstickenden, untätigen Koloß mit bürokratischer Kurz-
sichtigkeit entwickle. Die schneidend - drastische Vor-
tragsweise des Redners rief, unterstützt durch ein ge-
radezu niederschmetterndes Abbildungsmaterial trostlose-
ster architektonischer Verwüstung einen sehr nachhaltigen
Eindruck hervor. Man verzichtete stillschweigend auf
eine Diskussion, um diese keimsäende Wirkung nicht zu
verderben. f. h.
□ Berlin. Ausstellung »Die Frau in Haus und Beruf«
im Zoologischen Garten. Es ist nicht so schlimm ge-
worden, wie man erwartet hatte. Das Album der kunst-
beflissenen Damen mit Kostproben, Photo- und Auto-
biographien, das der Lyzeumklub uns vor ein paar Jahren
auf den Weihnachtstisch gelegt hat, war mit arg dilettan-
tischem Kram vollgestopft. Wer mit der Erinnerung daran
in die Ausstellung am Zoo kam, konnte eine angenehme
Überraschung erleben. Ich will nicht sagen, daß es künst-
lerische Taten zu bewundern gegeben hätte. Aber die
Damen haben geleistet, was Durchschnittsmänner auch nicht
besser gemacht hätten. Sie haben wie alle, die sich jetzt
am Kunstgewerbe betätigen, viel Gutes gesehen und
manches davon gelernt. Wie die Kunstgewerblerinnen
überhaupt viel mehr Anpassungsvermögen als ihre männ-
lichen Kollegen zu besitzen scheinen. □
□ So waren die beiden Hallen von Fia Wille und Else
Oppler geschickt genug aufgemacht. Über ein paar Kleinig-
keiten, die ganz unräumliche Klubempfangshalle mit dem
ungefüg baumelnden gelben Baldachin, den lieblos behan-
delten Eingang, einen unmöglichen dekorativen Fries mag
man hinwegsehen. Sehr tüchtig war das Podium mit den
Schaufenstern, verblüffend ob ihrer geschmackvollen
Reife die Schaufensterdekorationen von Elisabeth v. Hahn.
In ihrem Schlafzimmer steckt eine Nuance zu viel Koketterie,
zu viel Theaterregie. Eine Leistung von Rang ist das an-
stoßende Dernburgsche Badezimmer aus grauem Marmor.
Die Bremerin von Baczko hat sehr anständig, sehr sach-
lich das Pressezimmer hergerichtet. In der Bibliothek der
Else Oppler und dem Eßzimmer der Fia Wille verspürt
man die Gewandtheit, die eine lange Beschäftigung mit
den Dingen gibt. Der Kollektion Willescher Gläser könnte
ein bißchen mehr Grazie nichts schaden, ihre Korbmöbel
sind apart und bequem. Typisch erscheint der Musikraum
von Tscheuchtier-Cucuel; alles Konstruktive darin ist ungelöst,
zerbrechlich, alles Dekorative von Stimmungsreiz. Das zeigt