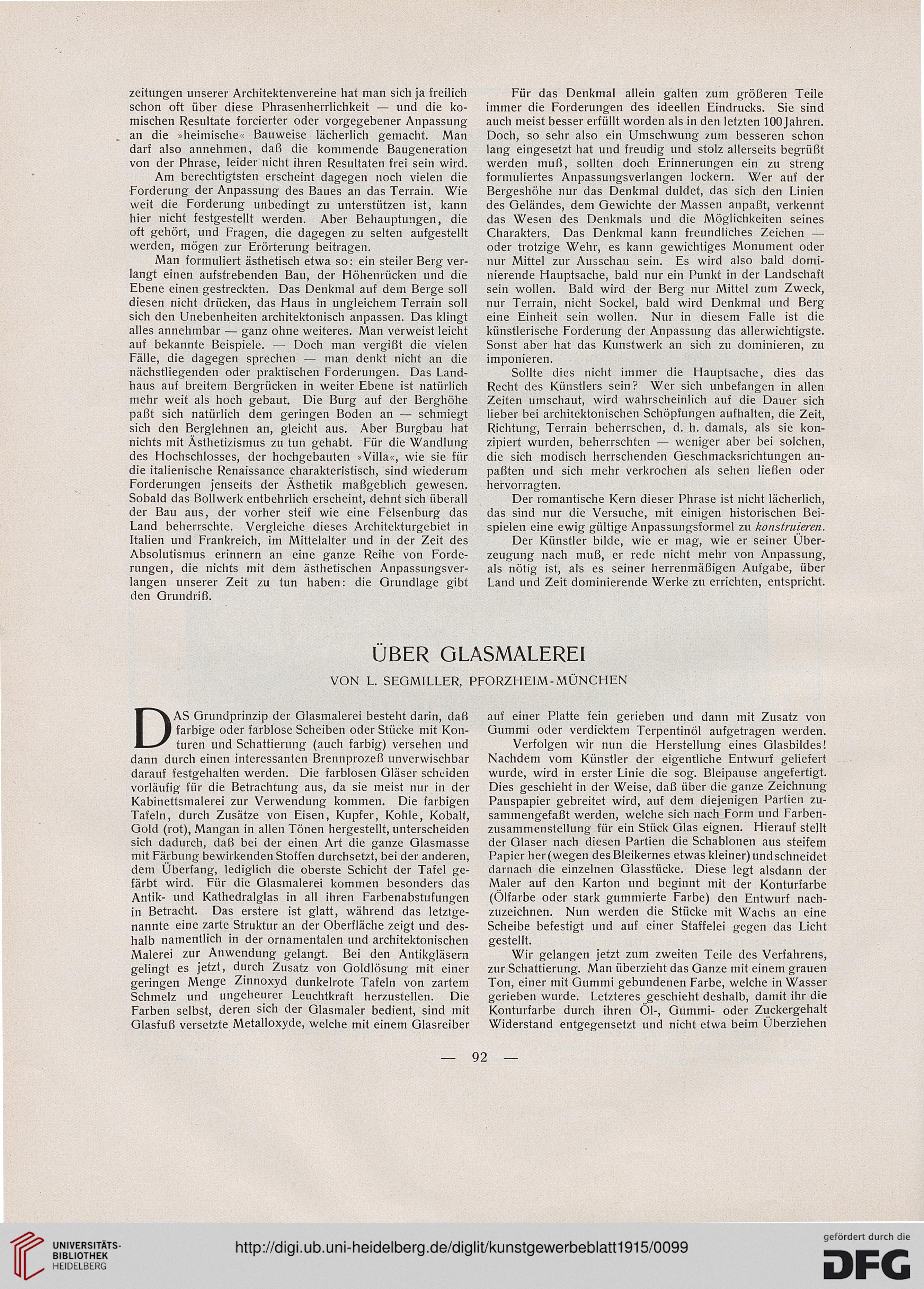Zeitungen unserer Architektenvereine hat man sich ja freilich
schon oft über diese Phrasenherrlichkeit — und die ko-
mischen Resultate forcierter oder vorgegebener Anpassung
an die »heimische« Bauweise lächerlich gemacht. Man
darf also annehmen, daß die kommende Baugeneration
von der Phrase, leider nicht ihren Resultaten frei sein wird.
Am berechtigtsten erscheint dagegen noch vielen die
Forderung der Anpassung des Baues an das Terrain. Wie
weit die Forderung unbedingt zu unterstützen ist, kann
hier nicht festgestellt werden. Aber Behauptungen, die
oft gehört, und Fragen, die dagegen zu selten aufgestellt
werden, mögen zur Erörterung beitragen.
Man formuliert ästhetisch etwa so: ein steiler Berg ver-
langt einen aufstrebenden Bau, der Höhenrücken und die
Ebene einen gestreckten. Das Denkmal auf dem Berge soll
diesen nicht drücken, das Haus in ungleichem Terrain soll
sich den Unebenheiten architektonisch anpassen. Das klingt
alles annehmbar — ganz ohne weiteres. Man verweist leicht
auf bekannte Beispiele. — Doch man vergißt die vielen
Fälle, die dagegen sprechen — man denkt nicht an die
nächstliegenden oder praktischen Forderungen. Das Land-
haus auf breitem Bergrücken in weiter Ebene ist natürlich
mehr weit als hoch gebaut. Die Burg auf der Berghöhe
paßt sich natürlich dem geringen Boden an — schmiegt
sich den Berglehnen an, gleicht aus. Aber Burgbau hat
nichts mit Ästhetizismus zu tun gehabt. Für die Wandlung
des Hochschlosses, der hochgebauten »Villa«, wie sie für
die italienische Renaissance charakteristisch, sind wiederum
Forderungen jenseits der Ästhetik maßgeblich gewesen.
Sobald das Bollwerk entbehrlich erscheint, dehnt sich überall
der Bau aus, der vorher steif wie eine Felsenburg das
Land beherrschte. Vergleiche dieses Architekturgebiet in
Italien und Frankreich, im Mittelalter und in der Zeit des
Absolutismus erinnern an eine ganze Reihe von Forde-
rungen, die nichts mit dem ästhetischen Anpassungsver-
langen unserer Zeit zu tun haben: die Grundlage gibt
den Grundriß.
Für das Denkmal allein galten zum größeren Teile
immer die Forderungen des ideellen Eindrucks. Sie sind
auch meist besser erfüllt worden als in den letzten 100Jahren.
Doch, so sehr also ein Umschwung zum besseren schon
lang eingesetzt hat und freudig und stolz allerseits begrüßt
werden muß, sollten doch Erinnerungen ein zu streng
formuliertes Anpassungsverlangen lockern. Wer auf der
Bergeshöhe nur das Denkmal duldet, das sich den Linien
des Geländes, dem Gewichte der Massen anpaßt, verkennt
das Wesen des Denkmals und die Möglichkeiten seines
Charakters. Das Denkmal kann freundliches Zeichen —
oder trotzige Wehr, es kann gewichtiges Monument oder
nur Mittel zur Ausschau sein. Es wird also bald domi-
nierende Hauptsache, bald nur ein Punkt in der Landschaft
sein wollen. Bald wird der Berg nur Mittel zum Zweck,
nur Terrain, nicht Sockel, bald wird Denkmal und Berg
eine Einheit sein wollen. Nur in diesem Falle ist die
künstlerische Forderung der Anpassung das allerwichtigste.
Sonst aber hat das Kunstwerk an sich zu dominieren, zu
imponieren.
Sollte dies nicht immer die Hauptsache, dies das
Recht des Künstlers sein? Wer sich unbefangen in allen
Zeiten umschaut, wird wahrscheinlich auf die Dauer sich
lieber bei architektonischen Schöpfungen aufhalten, die Zeit,
Richtung, Terrain beherrschen, d. h. damals, als sie kon-
zipiert wurden, beherrschten — weniger aber bei solchen,
die sich modisch herrschenden Geschmacksrichtungen an-
paßten und sich mehr verkrochen als sehen ließen oder
hervorragten.
Der romantische Kern dieser Phrase ist nicht lächerlich,
das sind nur die Versuche, mit einigen historischen Bei-
spielen eine ewig gültige Anpassungsformel zu konstruieren.
Der Künstler bilde, wie er mag, wie er seiner Über-
zeugung nach muß, er rede nicht mehr von Anpassung,
als nötig ist, als es seiner herrenmäßigen Aufgabe, über
Land und Zeit dominierende Werke zu errichten, entspricht.
ÜBER GLASMALEREI
VON L. SEGMILLER, PFORZHEIM-MÜNCHEN
DAS Grundprinzip der Glasmalerei besteht darin, daß
farbige oder farblose Scheiben oder Stücke mit Kon-
turen und Schattierung (auch farbig) versehen und
dann durch einen interessanten Brennprozeß unverwischbar
darauf festgehalten werden. Die farblosen Gläser scheiden
vorläufig für die Betrachtung aus, da sie meist nur in der
Kabinettsmalerei zur Verwendung kommen. Die farbigen
Tafeln, durch Zusätze von Eisen, Kupfer, Kohle, Kobalt,
Gold (rot), Mangan in allen Tönen hergestellt, unterscheiden
sich dadurch, daß bei der einen Art die ganze Glasmasse
mit Färbung bewirkenden Stoffen durchsetzt, bei der anderen,
dem Überfang, lediglich die oberste Schicht der Tafel ge-
färbt wird. Für die Glasmalerei kommen besonders das
Antik- und Kathedralglas in all ihren Farbenabstufungen
in Betracht. Das erstere ist glatt, während das letztge-
nannte eine zarte Struktur an der Oberfläche zeigt und des-
halb namentlich in der ornamentalen und architektonischen
Malerei zur Anwendung gelangt. Bei den Antikgläsern
gelingt es jetzt, durch Zusatz von Goldlösung mit einer
geringen Menge Zinnoxyd dunkelrote Tafeln von zartem
Schmelz und ungeheurer Leuchtkraft herzustellen. Die
Farben selbst, deren sich der Glasmaler bedient, sind mit
Glasfuß versetzte Metalloxyde, welche mit einem Glasreiber
auf einer Platte fein gerieben und dann mit Zusatz von
Gummi oder verdicktem Terpentinöl aufgetragen werden.
Verfolgen wir nun die Herstellung eines Glasbildes!
Nachdem vom Künstler der eigentliche Entwurf geliefert
wurde, wird in erster Linie die sog. Bleipause angefertigt.
Dies geschieht in der Weise, daß über die ganze Zeichnung
Pauspapier gebreitet wird, auf dem diejenigen Partien zu-
sammengefaßt werden, welche sich nach Form und Farben-
zusammenstellung für ein Stück Glas eignen. Hierauf stellt
der Glaser nach diesen Partien die Schablonen aus steifem
Papier her (wegen des Bleikernes etwas kleiner) und schneidet
darnach die einzelnen Glasstücke. Diese legt alsdann der
Maler auf den Karton und beginnt mit der Konturfarbe
(Ölfarbe oder stark gummierte Farbe) den Entwurf nach-
zuzeichnen. Nun werden die Stücke mit Wachs an eine
Scheibe befestigt und auf einer Staffelei gegen das Licht
gestellt.
Wir gelangen jetzt zum zweiten Teile des Verfahrens,
zur Schattierung. Man überzieht das Ganze mit einem grauen
Ton, einer mit Gummi gebundenen Farbe, welche in Wasser
gerieben wurde. Letzteres geschieht deshalb, damit ihr die
Konturfarbe durch ihren Öl-, Gummi- oder Zuckergehalt
Widerstand entgegensetzt und nicht etwa beim Überziehen
— 92 —
schon oft über diese Phrasenherrlichkeit — und die ko-
mischen Resultate forcierter oder vorgegebener Anpassung
an die »heimische« Bauweise lächerlich gemacht. Man
darf also annehmen, daß die kommende Baugeneration
von der Phrase, leider nicht ihren Resultaten frei sein wird.
Am berechtigtsten erscheint dagegen noch vielen die
Forderung der Anpassung des Baues an das Terrain. Wie
weit die Forderung unbedingt zu unterstützen ist, kann
hier nicht festgestellt werden. Aber Behauptungen, die
oft gehört, und Fragen, die dagegen zu selten aufgestellt
werden, mögen zur Erörterung beitragen.
Man formuliert ästhetisch etwa so: ein steiler Berg ver-
langt einen aufstrebenden Bau, der Höhenrücken und die
Ebene einen gestreckten. Das Denkmal auf dem Berge soll
diesen nicht drücken, das Haus in ungleichem Terrain soll
sich den Unebenheiten architektonisch anpassen. Das klingt
alles annehmbar — ganz ohne weiteres. Man verweist leicht
auf bekannte Beispiele. — Doch man vergißt die vielen
Fälle, die dagegen sprechen — man denkt nicht an die
nächstliegenden oder praktischen Forderungen. Das Land-
haus auf breitem Bergrücken in weiter Ebene ist natürlich
mehr weit als hoch gebaut. Die Burg auf der Berghöhe
paßt sich natürlich dem geringen Boden an — schmiegt
sich den Berglehnen an, gleicht aus. Aber Burgbau hat
nichts mit Ästhetizismus zu tun gehabt. Für die Wandlung
des Hochschlosses, der hochgebauten »Villa«, wie sie für
die italienische Renaissance charakteristisch, sind wiederum
Forderungen jenseits der Ästhetik maßgeblich gewesen.
Sobald das Bollwerk entbehrlich erscheint, dehnt sich überall
der Bau aus, der vorher steif wie eine Felsenburg das
Land beherrschte. Vergleiche dieses Architekturgebiet in
Italien und Frankreich, im Mittelalter und in der Zeit des
Absolutismus erinnern an eine ganze Reihe von Forde-
rungen, die nichts mit dem ästhetischen Anpassungsver-
langen unserer Zeit zu tun haben: die Grundlage gibt
den Grundriß.
Für das Denkmal allein galten zum größeren Teile
immer die Forderungen des ideellen Eindrucks. Sie sind
auch meist besser erfüllt worden als in den letzten 100Jahren.
Doch, so sehr also ein Umschwung zum besseren schon
lang eingesetzt hat und freudig und stolz allerseits begrüßt
werden muß, sollten doch Erinnerungen ein zu streng
formuliertes Anpassungsverlangen lockern. Wer auf der
Bergeshöhe nur das Denkmal duldet, das sich den Linien
des Geländes, dem Gewichte der Massen anpaßt, verkennt
das Wesen des Denkmals und die Möglichkeiten seines
Charakters. Das Denkmal kann freundliches Zeichen —
oder trotzige Wehr, es kann gewichtiges Monument oder
nur Mittel zur Ausschau sein. Es wird also bald domi-
nierende Hauptsache, bald nur ein Punkt in der Landschaft
sein wollen. Bald wird der Berg nur Mittel zum Zweck,
nur Terrain, nicht Sockel, bald wird Denkmal und Berg
eine Einheit sein wollen. Nur in diesem Falle ist die
künstlerische Forderung der Anpassung das allerwichtigste.
Sonst aber hat das Kunstwerk an sich zu dominieren, zu
imponieren.
Sollte dies nicht immer die Hauptsache, dies das
Recht des Künstlers sein? Wer sich unbefangen in allen
Zeiten umschaut, wird wahrscheinlich auf die Dauer sich
lieber bei architektonischen Schöpfungen aufhalten, die Zeit,
Richtung, Terrain beherrschen, d. h. damals, als sie kon-
zipiert wurden, beherrschten — weniger aber bei solchen,
die sich modisch herrschenden Geschmacksrichtungen an-
paßten und sich mehr verkrochen als sehen ließen oder
hervorragten.
Der romantische Kern dieser Phrase ist nicht lächerlich,
das sind nur die Versuche, mit einigen historischen Bei-
spielen eine ewig gültige Anpassungsformel zu konstruieren.
Der Künstler bilde, wie er mag, wie er seiner Über-
zeugung nach muß, er rede nicht mehr von Anpassung,
als nötig ist, als es seiner herrenmäßigen Aufgabe, über
Land und Zeit dominierende Werke zu errichten, entspricht.
ÜBER GLASMALEREI
VON L. SEGMILLER, PFORZHEIM-MÜNCHEN
DAS Grundprinzip der Glasmalerei besteht darin, daß
farbige oder farblose Scheiben oder Stücke mit Kon-
turen und Schattierung (auch farbig) versehen und
dann durch einen interessanten Brennprozeß unverwischbar
darauf festgehalten werden. Die farblosen Gläser scheiden
vorläufig für die Betrachtung aus, da sie meist nur in der
Kabinettsmalerei zur Verwendung kommen. Die farbigen
Tafeln, durch Zusätze von Eisen, Kupfer, Kohle, Kobalt,
Gold (rot), Mangan in allen Tönen hergestellt, unterscheiden
sich dadurch, daß bei der einen Art die ganze Glasmasse
mit Färbung bewirkenden Stoffen durchsetzt, bei der anderen,
dem Überfang, lediglich die oberste Schicht der Tafel ge-
färbt wird. Für die Glasmalerei kommen besonders das
Antik- und Kathedralglas in all ihren Farbenabstufungen
in Betracht. Das erstere ist glatt, während das letztge-
nannte eine zarte Struktur an der Oberfläche zeigt und des-
halb namentlich in der ornamentalen und architektonischen
Malerei zur Anwendung gelangt. Bei den Antikgläsern
gelingt es jetzt, durch Zusatz von Goldlösung mit einer
geringen Menge Zinnoxyd dunkelrote Tafeln von zartem
Schmelz und ungeheurer Leuchtkraft herzustellen. Die
Farben selbst, deren sich der Glasmaler bedient, sind mit
Glasfuß versetzte Metalloxyde, welche mit einem Glasreiber
auf einer Platte fein gerieben und dann mit Zusatz von
Gummi oder verdicktem Terpentinöl aufgetragen werden.
Verfolgen wir nun die Herstellung eines Glasbildes!
Nachdem vom Künstler der eigentliche Entwurf geliefert
wurde, wird in erster Linie die sog. Bleipause angefertigt.
Dies geschieht in der Weise, daß über die ganze Zeichnung
Pauspapier gebreitet wird, auf dem diejenigen Partien zu-
sammengefaßt werden, welche sich nach Form und Farben-
zusammenstellung für ein Stück Glas eignen. Hierauf stellt
der Glaser nach diesen Partien die Schablonen aus steifem
Papier her (wegen des Bleikernes etwas kleiner) und schneidet
darnach die einzelnen Glasstücke. Diese legt alsdann der
Maler auf den Karton und beginnt mit der Konturfarbe
(Ölfarbe oder stark gummierte Farbe) den Entwurf nach-
zuzeichnen. Nun werden die Stücke mit Wachs an eine
Scheibe befestigt und auf einer Staffelei gegen das Licht
gestellt.
Wir gelangen jetzt zum zweiten Teile des Verfahrens,
zur Schattierung. Man überzieht das Ganze mit einem grauen
Ton, einer mit Gummi gebundenen Farbe, welche in Wasser
gerieben wurde. Letzteres geschieht deshalb, damit ihr die
Konturfarbe durch ihren Öl-, Gummi- oder Zuckergehalt
Widerstand entgegensetzt und nicht etwa beim Überziehen
— 92 —