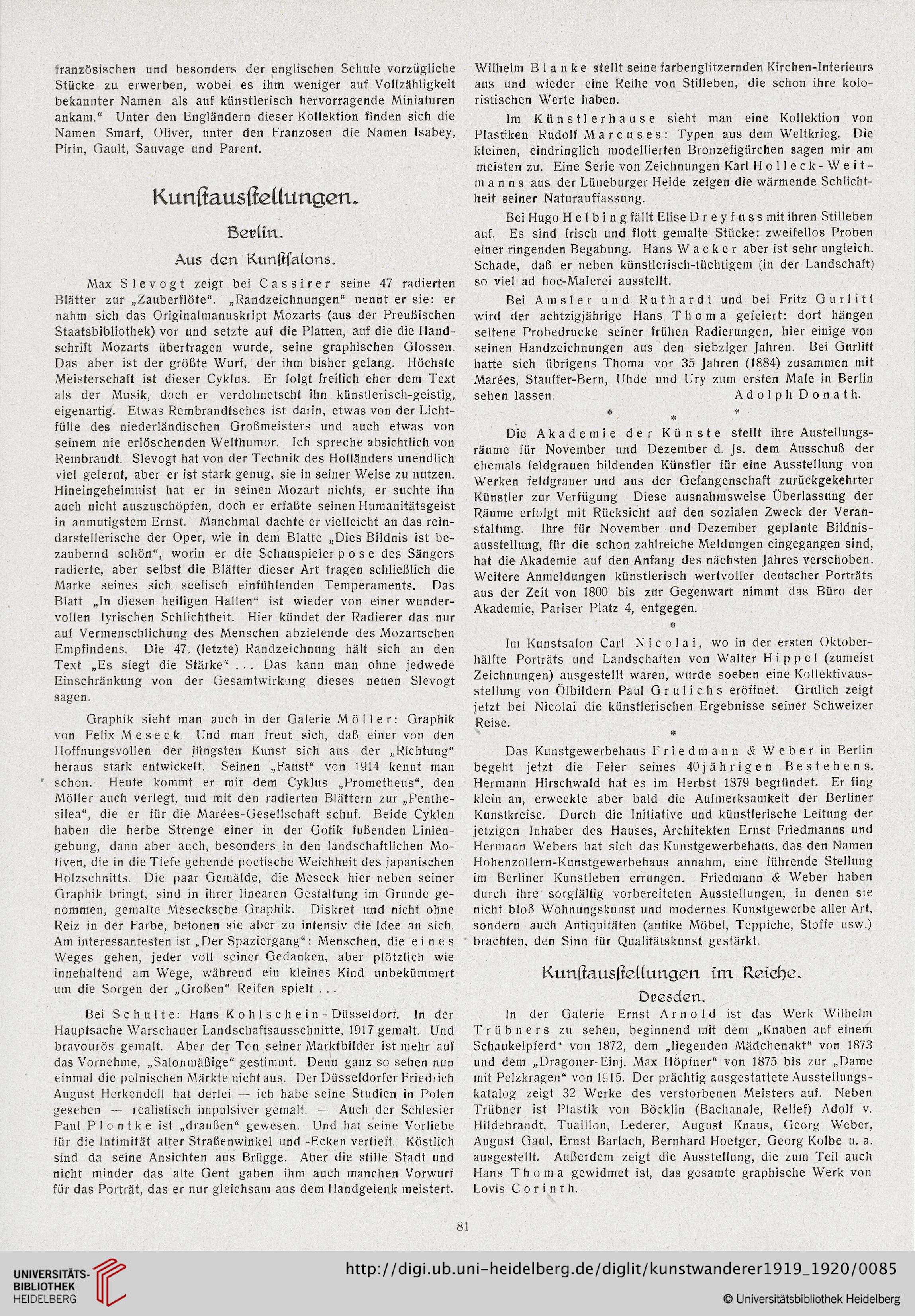französischen und besonders der englischen Schule vorzügliche
Stücke zu erwerben, wobei es ihm weniger auf Vollzähligkeit
bekannter Namen als auf künstlerisch hervorragende Miniaturen
ankam.“ Unter den Engländern dieser Kollektion finden sich die
Namen Smart, Oliver, unter den Franzosen die Namen Isabey,
Pirin, Gault, Sauvage und Parent.
Kun{laus{feUungeru
Becliru
Aus den Kunßfalons.
Max Slevogt zeigt bei Cassirer seine 47 radierten
Blätter zur „Zauberflöte“. „Randzeichnungen“ nennt er sie: er
nahm sich das Originalmanuskript Mozarts (aus der Preußischen
Staatsbibliothek) vor und setzte auf die Platten, auf die die Hand-
schrift Mozarts übertragen wurde, seine graphischen Glossen.
Das aber ist der größte Wurf, der ihm bisher gelang. Höchste
Meisterschaft ist dieser Cyklus. Er folgt freilich eher dem Text
als der Musik, doch er verdolmetscht ihn künstlerisch-geistig,
eigenartig. Etwas Rembrandtsches ist darin, etwas von der Licht-
fülle des niederländischen Großmeisters und auch etwas von
seinem nie erlöschenden Welthumor. Ich spreche absichtlich von
Rembrandt. Slevogt hat von der Technik des Holländers unendlich
viel gelernt, aber er ist stark genug, sie in seiner Weise zu nutzen.
Hineingeheimnist hat er in seinen Mozart nichts, er suchte ihn
auch nicht auszuschöpfen, doch er erfaßte seinen Humanitätsgeist
in anmutigstem Ernst. Manchmal dachte er vielleicht an das rein-
darstellerische der Oper, wie in dem Blatte „Dies Bildnis ist be-
zaubernd schön“, worin er die Schauspieler p o s e des Sängers
radierte, aber selbst die Blätter dieser Art tragen schließlich die
Marke seines sich seelisch einfühlenden Temperaments. Das
Blatt „In diesen heiligen Hallen“ ist wieder von einer wunder-
vollen lyrischen Schlichtheit. Hier kündet der Radierer das nur
auf Vermenschlichung des Menschen abzielende des Mozartschen
Empfindens. Die 47. (letzte) Randzeichnung hält sich an den
Text „Es siegt die Stärke“ . . . Das kann man ohne jedwede
Einschränkung von der Gesamtwirkung dieses neuen Slevogt
sagen.
Graphik sieht man auch in der Galerie Möller: Graphik
von Felix Meseck. Und man freut sich, daß einer von den
Hoffnungsvollen der jüngsten Kunst sich aus der „Richtung“
heraus stark entwickelt. Seinen „Faust“ von 1914 kennt man
' schon. Heute kommt er mit dem Cyklus „Prometheus“, den
Möller auch verlegt, und mit den radierten Blättern zur „Penthe-
silea“, die er für die Marües-Gesellschaft schuf. Beide Cyklen
haben die herbe Strenge einer in der Gotik fußenden Linien-
gebung, dann aber auch, besonders in den landschaftlichen Mo-
tiven, die in die Tiefe gehende poetische Weichheit des japanischen
Holzschnitts. Die paar Gemälde, die Meseck hier neben seiner
Graphik bringt, sind in ihrer linearen Gestaltung im Grunde ge-
nommen, gemalte Mesecksche Graphik. Diskret und nicht ohne
Reiz in der Farbe, betonen sie aber zu intensiv die Idee an sich.
Am interessantesten ist „Der Spaziergang“: Menschen, die eines
Weges gehen, jeder voll seiner Gedanken, aber plötzlich wie
innehaltend am Wege, während ein kleines Kind unbekümmert
um die Sorgen der „Großen“ Reifen spielt . . .
Bei Schulte: Hans K o h 1 s c h e i n - Düsseldorf. In der
Hauptsache Warschauer Landschaftsausschnitte, 1917 gemalt. Und
bravourös gemalt. Aber der Ton seiner Marktbilder ist mehr auf
das Vornehme, „Salonmäßige“ gestimmt. Denn ganz so sehen nun
einmal die polnischen Märkte nicht aus. Der Düsseldorfer Friedlich
August Herkendell hat derlei — ich habe seine Studien in Polen
gesehen — realistisch impulsiver gemalt. — Auch der Schlesier
Paul Plontke ist „draußen“ gewesen. Und hat seine Vorliebe
für die Intimität alter Straßenwinkel und -Ecken vertieft. Köstlich
sind da seine Ansichten aus Brügge. Aber die stille Stadt und
nicht minder das alte Gent gaben ihm auch manchen Vorwurf
für das Porträt, das er nur gleichsam aus dem Handgelenk meistert.
Wilhelm Blanke stellt seine farbenglitzernden Kirchen-Interieurs
aus und wieder eine Reihe von Stilleben, die schon ihre kolo-
ristischen Werte haben.
Im Künstlerhause sieht man eine Kollektion von
Plastiken Rudolf M a r c u s e s : Typen aus dem Weltkrieg. Die
kleinen, eindringlich modellierten Bronzefigürchen sagen mir am
meisten zu. Eine Serie von Zeichnungen Karl Holleck-Weit-
manns aus der Lüneburger Heide zeigen die wärmende Schlicht-
heit seiner Naturauffassung.
Bei Hugo H e 1 b i n g fällt Elise Dreyfussmit ihren Stilleben
auf. Es sind frisch und flott gemalte Stücke: zweifellos Proben
einer ringenden Begabung. Hans Wacker aber ist sehr ungleich.
Schade, daß er neben künstlerisch-tüchtigem (in der Landschaft)
so viel ad hoc-Malerei ausstellt.
Bei Amsler und Ruthardt und bei Fritz Gurlitt
wird der achtzigjährige Hans T h o m a gefeiert: dort hängen
seltene Probedrucke seiner frühen Radierungen, hier einige von
seinen Handzeichnungen aus den siebziger Jahren. Bei Gurlitt
hatte sich übrigens Thoma vor 35 Jahren (1884) zusammen mit
Maröes, Stauffer-Bern, Uhde und Ury zum ersten Male in Berlin
sehen lassen. Adolph Donath.
* *
*
Die Akademie der Künste stellt ihre Austellungs-
räume für November und Dezember d. Js. dem Ausschuß der
ehemals feldgrauen bildenden Künstler für eine Ausstellung von
Werken feldgrauer und aus der Gefangenschaft zurückgekehrter
Künstler zur Verfügung Diese ausnahmsweise Überlassung der
Räume erfolgt mit Rücksicht auf den sozialen Zweck der Veran-
staltung. Ihre für November und Dezember geplante Bildnis-
ausstellung, für die schon zahlreiche Meldungen eingegangen sind,
hat die Akademie auf den Anfang des nächsten Jahres verschoben.
Weitere Anmeldungen künstlerisch wertvoller deutscher Porträts
aus der Zeit von 1800 bis zur Gegenwart nimmt das Büro der
Akademie, Pariser Platz 4, entgegen.
*
Im Kunstsalon Carl Nicolai, wo in der ersten Oktober-
hälfte Porträts und Landschaften von Walter Hippel (zumeist
Zeichnungen) ausgestellt waren, wurde soeben eine Kollektivaus-
stellung von Ölbildern Paul G r u 1 i c h s eröffnet. Grulich zeigt
jetzt bei Nicolai die künstlerischen Ergebnisse seiner Schweizer
Reise.
*
Das Kunstgewerbehaus Friedmann & Weber in Berlin
begeht jetzt die Feier seines 40jährigen Bestehens.
Hermann Hirschwald hat es im Herbst 1879 begründet. Er fing
klein an, erweckte aber bald die Aufmerksamkeit der Berliner
Kunstkreise. Durch die Initiative und künstlerische Leitung der
jetzigen Inhaber des Hauses, Architekten Ernst Friedmanns und
Hermann Webers hat sich das Kunstgewerbehaus, das den Namen
Hohenzollern-Kunstgewerbehaus annahm, eine führende Stellung
im Berliner Kunstleben errungen. Friedmann & Weber haben
durch ihre sorgfältig vorbereiteten Ausstellungen, in denen sie
nicht bloß Wohnungskunst und modernes Kunstgewerbe aller Art,
sondern auch Antiquitäten (antike Möbel, Teppiche, Stoffe usw.)
brachten, den Sinn für Qualitätskunst gestärkt.
Kunffausfteüungen im Rcicbc-
Dcesdcn.
ln der Galerie Ernst Arnold ist das Werk Wilhelm
Trübners zu sehen, beginnend mit dem „Knaben auf einem
Schaukelpferd“ von 1872, dem „liegenden Mädchenakt“ von 1873
und dem „Dragoner-Einj. Max Höpfner“ von 1875 bis zur „Dame
mit Pelzkragen“ von 1915. Der prächtig ausgestattete Ausstellungs-
katalog zeigt 32 Werke des verstorbenen Meisters auf. Neben
Trübner ist Plastik von Böcklin (Bachanale, Relief) Adolf v.
Hildebrandt, Tuaillon, Lederer, August Knaus, Georg Weber,
August Gaul, Ernst Barlach, Bernhard Hoetger, Georg Kolbe u. a.
ausgestellt. Außerdem zeigt die Ausstellung, die zum Teil auch
Hans Thoma gewidmet ist, das gesamte graphische Werk von
Lovis C o r i n t h.
81
Stücke zu erwerben, wobei es ihm weniger auf Vollzähligkeit
bekannter Namen als auf künstlerisch hervorragende Miniaturen
ankam.“ Unter den Engländern dieser Kollektion finden sich die
Namen Smart, Oliver, unter den Franzosen die Namen Isabey,
Pirin, Gault, Sauvage und Parent.
Kun{laus{feUungeru
Becliru
Aus den Kunßfalons.
Max Slevogt zeigt bei Cassirer seine 47 radierten
Blätter zur „Zauberflöte“. „Randzeichnungen“ nennt er sie: er
nahm sich das Originalmanuskript Mozarts (aus der Preußischen
Staatsbibliothek) vor und setzte auf die Platten, auf die die Hand-
schrift Mozarts übertragen wurde, seine graphischen Glossen.
Das aber ist der größte Wurf, der ihm bisher gelang. Höchste
Meisterschaft ist dieser Cyklus. Er folgt freilich eher dem Text
als der Musik, doch er verdolmetscht ihn künstlerisch-geistig,
eigenartig. Etwas Rembrandtsches ist darin, etwas von der Licht-
fülle des niederländischen Großmeisters und auch etwas von
seinem nie erlöschenden Welthumor. Ich spreche absichtlich von
Rembrandt. Slevogt hat von der Technik des Holländers unendlich
viel gelernt, aber er ist stark genug, sie in seiner Weise zu nutzen.
Hineingeheimnist hat er in seinen Mozart nichts, er suchte ihn
auch nicht auszuschöpfen, doch er erfaßte seinen Humanitätsgeist
in anmutigstem Ernst. Manchmal dachte er vielleicht an das rein-
darstellerische der Oper, wie in dem Blatte „Dies Bildnis ist be-
zaubernd schön“, worin er die Schauspieler p o s e des Sängers
radierte, aber selbst die Blätter dieser Art tragen schließlich die
Marke seines sich seelisch einfühlenden Temperaments. Das
Blatt „In diesen heiligen Hallen“ ist wieder von einer wunder-
vollen lyrischen Schlichtheit. Hier kündet der Radierer das nur
auf Vermenschlichung des Menschen abzielende des Mozartschen
Empfindens. Die 47. (letzte) Randzeichnung hält sich an den
Text „Es siegt die Stärke“ . . . Das kann man ohne jedwede
Einschränkung von der Gesamtwirkung dieses neuen Slevogt
sagen.
Graphik sieht man auch in der Galerie Möller: Graphik
von Felix Meseck. Und man freut sich, daß einer von den
Hoffnungsvollen der jüngsten Kunst sich aus der „Richtung“
heraus stark entwickelt. Seinen „Faust“ von 1914 kennt man
' schon. Heute kommt er mit dem Cyklus „Prometheus“, den
Möller auch verlegt, und mit den radierten Blättern zur „Penthe-
silea“, die er für die Marües-Gesellschaft schuf. Beide Cyklen
haben die herbe Strenge einer in der Gotik fußenden Linien-
gebung, dann aber auch, besonders in den landschaftlichen Mo-
tiven, die in die Tiefe gehende poetische Weichheit des japanischen
Holzschnitts. Die paar Gemälde, die Meseck hier neben seiner
Graphik bringt, sind in ihrer linearen Gestaltung im Grunde ge-
nommen, gemalte Mesecksche Graphik. Diskret und nicht ohne
Reiz in der Farbe, betonen sie aber zu intensiv die Idee an sich.
Am interessantesten ist „Der Spaziergang“: Menschen, die eines
Weges gehen, jeder voll seiner Gedanken, aber plötzlich wie
innehaltend am Wege, während ein kleines Kind unbekümmert
um die Sorgen der „Großen“ Reifen spielt . . .
Bei Schulte: Hans K o h 1 s c h e i n - Düsseldorf. In der
Hauptsache Warschauer Landschaftsausschnitte, 1917 gemalt. Und
bravourös gemalt. Aber der Ton seiner Marktbilder ist mehr auf
das Vornehme, „Salonmäßige“ gestimmt. Denn ganz so sehen nun
einmal die polnischen Märkte nicht aus. Der Düsseldorfer Friedlich
August Herkendell hat derlei — ich habe seine Studien in Polen
gesehen — realistisch impulsiver gemalt. — Auch der Schlesier
Paul Plontke ist „draußen“ gewesen. Und hat seine Vorliebe
für die Intimität alter Straßenwinkel und -Ecken vertieft. Köstlich
sind da seine Ansichten aus Brügge. Aber die stille Stadt und
nicht minder das alte Gent gaben ihm auch manchen Vorwurf
für das Porträt, das er nur gleichsam aus dem Handgelenk meistert.
Wilhelm Blanke stellt seine farbenglitzernden Kirchen-Interieurs
aus und wieder eine Reihe von Stilleben, die schon ihre kolo-
ristischen Werte haben.
Im Künstlerhause sieht man eine Kollektion von
Plastiken Rudolf M a r c u s e s : Typen aus dem Weltkrieg. Die
kleinen, eindringlich modellierten Bronzefigürchen sagen mir am
meisten zu. Eine Serie von Zeichnungen Karl Holleck-Weit-
manns aus der Lüneburger Heide zeigen die wärmende Schlicht-
heit seiner Naturauffassung.
Bei Hugo H e 1 b i n g fällt Elise Dreyfussmit ihren Stilleben
auf. Es sind frisch und flott gemalte Stücke: zweifellos Proben
einer ringenden Begabung. Hans Wacker aber ist sehr ungleich.
Schade, daß er neben künstlerisch-tüchtigem (in der Landschaft)
so viel ad hoc-Malerei ausstellt.
Bei Amsler und Ruthardt und bei Fritz Gurlitt
wird der achtzigjährige Hans T h o m a gefeiert: dort hängen
seltene Probedrucke seiner frühen Radierungen, hier einige von
seinen Handzeichnungen aus den siebziger Jahren. Bei Gurlitt
hatte sich übrigens Thoma vor 35 Jahren (1884) zusammen mit
Maröes, Stauffer-Bern, Uhde und Ury zum ersten Male in Berlin
sehen lassen. Adolph Donath.
* *
*
Die Akademie der Künste stellt ihre Austellungs-
räume für November und Dezember d. Js. dem Ausschuß der
ehemals feldgrauen bildenden Künstler für eine Ausstellung von
Werken feldgrauer und aus der Gefangenschaft zurückgekehrter
Künstler zur Verfügung Diese ausnahmsweise Überlassung der
Räume erfolgt mit Rücksicht auf den sozialen Zweck der Veran-
staltung. Ihre für November und Dezember geplante Bildnis-
ausstellung, für die schon zahlreiche Meldungen eingegangen sind,
hat die Akademie auf den Anfang des nächsten Jahres verschoben.
Weitere Anmeldungen künstlerisch wertvoller deutscher Porträts
aus der Zeit von 1800 bis zur Gegenwart nimmt das Büro der
Akademie, Pariser Platz 4, entgegen.
*
Im Kunstsalon Carl Nicolai, wo in der ersten Oktober-
hälfte Porträts und Landschaften von Walter Hippel (zumeist
Zeichnungen) ausgestellt waren, wurde soeben eine Kollektivaus-
stellung von Ölbildern Paul G r u 1 i c h s eröffnet. Grulich zeigt
jetzt bei Nicolai die künstlerischen Ergebnisse seiner Schweizer
Reise.
*
Das Kunstgewerbehaus Friedmann & Weber in Berlin
begeht jetzt die Feier seines 40jährigen Bestehens.
Hermann Hirschwald hat es im Herbst 1879 begründet. Er fing
klein an, erweckte aber bald die Aufmerksamkeit der Berliner
Kunstkreise. Durch die Initiative und künstlerische Leitung der
jetzigen Inhaber des Hauses, Architekten Ernst Friedmanns und
Hermann Webers hat sich das Kunstgewerbehaus, das den Namen
Hohenzollern-Kunstgewerbehaus annahm, eine führende Stellung
im Berliner Kunstleben errungen. Friedmann & Weber haben
durch ihre sorgfältig vorbereiteten Ausstellungen, in denen sie
nicht bloß Wohnungskunst und modernes Kunstgewerbe aller Art,
sondern auch Antiquitäten (antike Möbel, Teppiche, Stoffe usw.)
brachten, den Sinn für Qualitätskunst gestärkt.
Kunffausfteüungen im Rcicbc-
Dcesdcn.
ln der Galerie Ernst Arnold ist das Werk Wilhelm
Trübners zu sehen, beginnend mit dem „Knaben auf einem
Schaukelpferd“ von 1872, dem „liegenden Mädchenakt“ von 1873
und dem „Dragoner-Einj. Max Höpfner“ von 1875 bis zur „Dame
mit Pelzkragen“ von 1915. Der prächtig ausgestattete Ausstellungs-
katalog zeigt 32 Werke des verstorbenen Meisters auf. Neben
Trübner ist Plastik von Böcklin (Bachanale, Relief) Adolf v.
Hildebrandt, Tuaillon, Lederer, August Knaus, Georg Weber,
August Gaul, Ernst Barlach, Bernhard Hoetger, Georg Kolbe u. a.
ausgestellt. Außerdem zeigt die Ausstellung, die zum Teil auch
Hans Thoma gewidmet ist, das gesamte graphische Werk von
Lovis C o r i n t h.
81