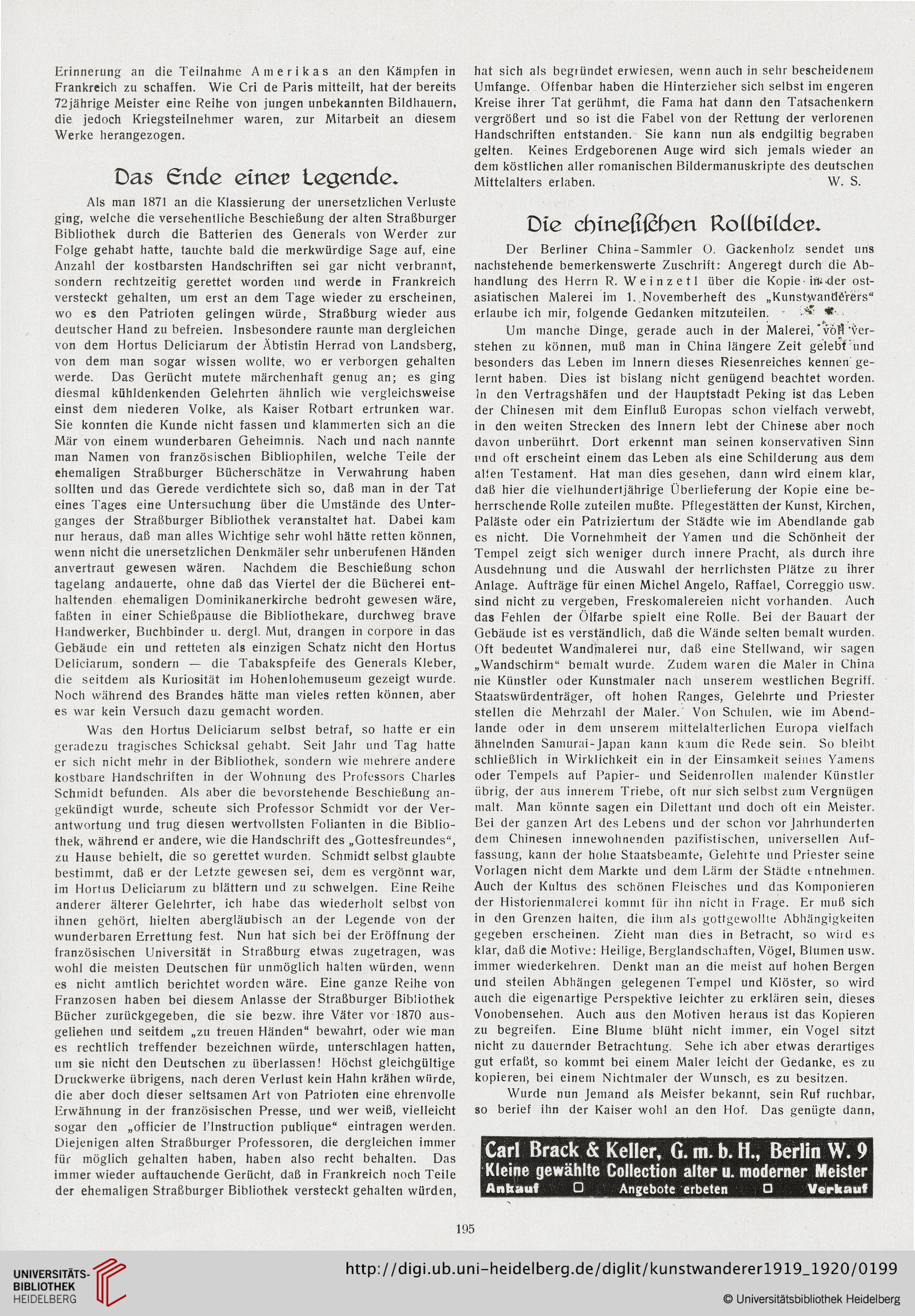Erinnerung an die Teilnahme Amerikas an den Kämpfen in
Frankreich zu schaffen. Wie Cri de Paris mitteilt, hat der bereits
72jährige Meister eine Reihe von jungen unbekannten Bildhauern,
die jedoch Kriegsteilnehmer waren, zur Mitarbeit an diesem
Werke herangezogen.
Das Snde einet legende.
Als man 1871 an die Klassierung der unersetzlichen Verluste
ging, welche die versehentliche Beschießung der alten Straßburger
Bibliothek durch die Batterien des Generals von Werder zur
Folge gehabt hatte, tauchte bald die merkwürdige Sage auf, eine
Anzahl der kostbarsten Handschriften sei gar nicht verbrannt,
sondern rechtzeitig gerettet worden und werde in Frankreich
versteckt gehalten, um erst an dem Tage wieder zu erscheinen,
wo es den Patrioten gelingen würde, Straßburg wieder aus
deutscher Hand zu befreien. Insbesondere raunte man dergleichen
von dem Hortus Deliciarum der Äbtistin Herrad von Landsberg,
von dem man sogar wissen wollte, wo er verborgen gehalten
werde. Das Gerücht mutete märchenhaft genug an; es ging
diesmal kühldenkenden Gelehrten ähnlich wie vergleichsweise
einst dem niederen Volke, als Kaiser Rotbart ertrunken war.
Sie konnten die Kunde nicht fassen und klammerten sich an die
Mär von einem wunderbaren Geheimnis. Nach und nach nannte
man Namen von französischen Bibliophilen, welche Teile der
ehemaligen Straßburger Bücherschätze in Verwahrung haben
sollten und das Gerede verdichtete sich so, daß man in der Tat
eines Tages eine Untersuchung über die Umstände des Unter-
ganges der Straßburger Bibliothek veranstaltet hat. Dabei kam
nur heraus, daß man alles Wichtige sehr wohl hätte retten können,
wenn nicht die unersetzlichen Denkmäler sehr unberufenen Händen
anvertraut gewesen wären. Nachdem die Beschießung schon
tagelang andauerte, ohne daß das Viertel der die Bücherei ent-
haltenden ehemaligen Dominikanerkirche bedroht gewesen wäre,
faßten in einer Schießpause die Bibliothekare, durchweg brave
Handwerker, Buchbinder u. dergl. Mut, drangen in corpore in das
Gebäude ein und retteten als einzigen Schatz nicht den Hortus
Deliciarum, sondern — die Tabakspfeife des Generals Kleber,
die seitdem als Kuriosität im Hohenlohemuseuni gezeigt wurde.
Noch während des Brandes hätte man vieles retten können, aber
es war kein Versuch dazu gemacht worden.
Was den Hortus Deliciarum selbst betraf, so hatte er ein
geradezu tragisches Schicksal gehabt. Seit Jahr und Tag hatte
er sich nicht mehr in der Bibliothek, sondern wie mehrere andere
kostbare Handschriften in der Wohnung des Professors Charles
Schmidt befunden. Als aber die bevorstehende Beschießung an-
gekündigt wurde, scheute sich Professor Schmidt vor der Ver-
antwortung und trug diesen wertvollsten Folianten in die Biblio-
thek, während er andere, wie die Handschrift des „Gottesfreundes“,
zu Hause behielt, die so gerettet wurden. Schmidt selbst glaubte
bestimmt, daß er der Letzte gewesen sei, dem es vergönnt war,
im Hortus Deliciarum zu blättern und zu schwelgen. Eine Reihe
anderer älterer Gelehrter, ich habe das wiederholt selbst von
ihnen gehört, hielten abergläubisch an der Legende von der
wunderbaren Errettung fest. Nun hat sich bei der Eröffnung der
französischen Universität in Straßburg etwas zugetragen, was
wohl die meisten Deutschen für unmöglich halten würden, wenn
es nicht amtlich berichtet worden wäre. Eine ganze Reihe von
Franzosen haben bei diesem Anlasse der Straßburger Bibliothek
Bücher zurückgegeben, die sie bezw. ihre Väter vor 1870 aus-
geliehen und seitdem „zu treuen Händen“ bewahrt, oder wie man
es rechtlich treffender bezeichnen würde, unterschlagen hatten,
um sie nicht den Deutschen zu überlassen! Höchst gleichgültige
Druckwerke übrigens, nach deren Verlust kein Hahn krähen würde,
die aber doch dieser seltsamen Art von Patrioten eine ehrenvolle
Erwähnung in der französischen Presse, und wer weiß, vielleicht
sogar den „officier de l’lnstruction publique“ eintragen werden.
Diejenigen alten Straßburger Professoren, die dergleichen immer
für möglich gehalten haben, haben also recht behalten. Das
immer wieder auftauchende Gerücht, daß in Frankreich noch Teile
der ehemaligen Straßburger Bibliothek versteckt gehalten würden,
hat sich als begründet erwiesen, wenn auch in sehr bescheidenem
Umfange. Offenbar haben die Hinterzieher sich selbst im engeren
Kreise ihrer Tat gerühmt, die Fama hat dann den Tatsachenkern
vergrößert und so ist die Fabel von der Rettung der verlorenen
Handschriften entstanden. Sie kann nun als endgiltig begraben
gelten. Keines Erdgeborenen Auge wird sich jemals wieder an
dem köstlichen aller romanischen Bildermanuskripte des deutschen
Mittelalters erlaben. W. S.
Die cbincdfcbcn RollbÜdeü*
Der Berliner China-Sammler 0. Gackenholz sendet uns
nachstehende bemerkenswerte Zuschrift: Angeregt durch die Ab-
handlung des Herrn R. Weinzetl über die Kopie ifuder ost-
asiatischen Malerei im 1. Novemberheft des „Kunsthändlers“
erlaube ich mir, folgende Gedanken mitzuteilen. ■ ’*' *
Um manche Dinge, gerade auch in der Malerei, ‘vötf Ver-
stehen zu können, muß man in China längere Zeit gelebt Und
besonders das Leben im Innern dieses Riesenreiches kennen ge-
lernt haben. Dies ist bislang nicht genügend beachtet worden.
In den Vertragshäfen und der Hauptstadt Peking ist das Leben
der Chinesen mit dem Einfluß Europas schon vielfach verwebt,
in den weiten Strecken des Innern lebt der Chinese aber noch
davon unberührt. Dort erkennt man seinen konservativen Sinn
und oft erscheint einem das Leben als eine Schilderung aus dem
allen Testament. Hat man dies gesehen, dann wird einem klar,
daß hier die vielhunderljährige Überlieferung der Kopie eine be-
herrschende Rolle zuteilen mußte. Pflegestätten der Kunst, Kirchen,
Paläste oder ein Patriziertum der Städte wie im Abendlande gab
es nicht. Die Vornehmheit der Yamen und die Schönheit der
Tempel zeigt sich weniger durch innere Pracht, als durch ihre
Ausdehnung und die Auswahl der herrlichsten Plätze zu ihrer
Anlage. Aufträge für einen Michel Angelo, Raffael, Correggio usw.
sind nicht zu vergeben, Freskomalereien nicht vorhanden. Auch
das Fehlen der Ölfarbe spielt eine Rolle. Bei der Bauart der
Gebäude ist es verständlich, daß die Wände selten bemalt wurden.
Oft bedeutet Wandmalerei nur, daß eine Stellwand, wir sagen
„Wandschirm“ bemalt wurde. Zudem waren die Ataler in China
nie Künstler oder Kunstmaler nach unserem westlichen Begriff.
Staatswürdenträger, oft hohen Ranges, Gelehrte und Priester
stellen die Mehrzahl der Maler. Von Schulen, wie im Abend-
lande oder in dem unserem mittelalterlichen Europa vielfach
ähnelnden Samurai-Japan kann kaum die Rede sein. So bleibt
schließlich in Wirklichkeit ein in der Einsamkeit seines Yamens
oder Tempels auf Papier- und Seidenrollen malender Künstler
übrig, der aus innerem Triebe, oft nur sich selbst zum Vergnügen
malt. Man könnte sagen ein Dilettant und doch oft ein Meister.
Bei der ganzen Art des Lebens und der schon vorjahrhunderten
dem Chinesen innewohnenden pazifistischen, universellen Auf-
fassung, kann der hohe Staatsbeamte, Gelehrte und Priester seine
Vorlagen nicht dem Markte und dem Lärm der Städte entnehmen.
Auch der Kultus des schönen Fleisches und das Komponieren
der Historienmalerei kommt für ihn nicht in Frage. Er muß sich
in den Grenzen halten, die ihm als gottgewollte Abhängigkeiten
gegeben erscheinen. Zieht man dies in Betracht, so wird es
klar, daß die Motive: Heilige, Berglandschaften, Vögel, Blumen usw.
immer wiederkehren. Denkt man an die meist auf hohen Bergen
und steilen Abhängen gelegenen Tempel und Klöster, so wird
auch die eigenartige Perspektive leichter zu erklären sein, dieses
Vonobensehen. Auch aus den Motiven heraus ist das Kopieren
zu begreifen. Eine Blume blüht nicht immer, ein Vogel sitzt
nicht zu dauernder Betrachtung. Sehe ich aber etwas derartiges
gut erfaßt, so kommt bei einem Maler leicht der Gedanke, es zu
kopieren, bei einem Nichtmaler der Wunsch, es zu besitzen.
Wurde nun Jemand als Meister bekannt, sein Ruf ruchbar,
so berief ihn der Kaiser wohl an den Hof. Das genügte dann,
Carl Brack & Keller, G. m. b. H„ Berlin W. 9
Kleine gewählte Collection alter u. moderner Meister
Ankauf □ Angebote erbeten □ Verkauf
195
Frankreich zu schaffen. Wie Cri de Paris mitteilt, hat der bereits
72jährige Meister eine Reihe von jungen unbekannten Bildhauern,
die jedoch Kriegsteilnehmer waren, zur Mitarbeit an diesem
Werke herangezogen.
Das Snde einet legende.
Als man 1871 an die Klassierung der unersetzlichen Verluste
ging, welche die versehentliche Beschießung der alten Straßburger
Bibliothek durch die Batterien des Generals von Werder zur
Folge gehabt hatte, tauchte bald die merkwürdige Sage auf, eine
Anzahl der kostbarsten Handschriften sei gar nicht verbrannt,
sondern rechtzeitig gerettet worden und werde in Frankreich
versteckt gehalten, um erst an dem Tage wieder zu erscheinen,
wo es den Patrioten gelingen würde, Straßburg wieder aus
deutscher Hand zu befreien. Insbesondere raunte man dergleichen
von dem Hortus Deliciarum der Äbtistin Herrad von Landsberg,
von dem man sogar wissen wollte, wo er verborgen gehalten
werde. Das Gerücht mutete märchenhaft genug an; es ging
diesmal kühldenkenden Gelehrten ähnlich wie vergleichsweise
einst dem niederen Volke, als Kaiser Rotbart ertrunken war.
Sie konnten die Kunde nicht fassen und klammerten sich an die
Mär von einem wunderbaren Geheimnis. Nach und nach nannte
man Namen von französischen Bibliophilen, welche Teile der
ehemaligen Straßburger Bücherschätze in Verwahrung haben
sollten und das Gerede verdichtete sich so, daß man in der Tat
eines Tages eine Untersuchung über die Umstände des Unter-
ganges der Straßburger Bibliothek veranstaltet hat. Dabei kam
nur heraus, daß man alles Wichtige sehr wohl hätte retten können,
wenn nicht die unersetzlichen Denkmäler sehr unberufenen Händen
anvertraut gewesen wären. Nachdem die Beschießung schon
tagelang andauerte, ohne daß das Viertel der die Bücherei ent-
haltenden ehemaligen Dominikanerkirche bedroht gewesen wäre,
faßten in einer Schießpause die Bibliothekare, durchweg brave
Handwerker, Buchbinder u. dergl. Mut, drangen in corpore in das
Gebäude ein und retteten als einzigen Schatz nicht den Hortus
Deliciarum, sondern — die Tabakspfeife des Generals Kleber,
die seitdem als Kuriosität im Hohenlohemuseuni gezeigt wurde.
Noch während des Brandes hätte man vieles retten können, aber
es war kein Versuch dazu gemacht worden.
Was den Hortus Deliciarum selbst betraf, so hatte er ein
geradezu tragisches Schicksal gehabt. Seit Jahr und Tag hatte
er sich nicht mehr in der Bibliothek, sondern wie mehrere andere
kostbare Handschriften in der Wohnung des Professors Charles
Schmidt befunden. Als aber die bevorstehende Beschießung an-
gekündigt wurde, scheute sich Professor Schmidt vor der Ver-
antwortung und trug diesen wertvollsten Folianten in die Biblio-
thek, während er andere, wie die Handschrift des „Gottesfreundes“,
zu Hause behielt, die so gerettet wurden. Schmidt selbst glaubte
bestimmt, daß er der Letzte gewesen sei, dem es vergönnt war,
im Hortus Deliciarum zu blättern und zu schwelgen. Eine Reihe
anderer älterer Gelehrter, ich habe das wiederholt selbst von
ihnen gehört, hielten abergläubisch an der Legende von der
wunderbaren Errettung fest. Nun hat sich bei der Eröffnung der
französischen Universität in Straßburg etwas zugetragen, was
wohl die meisten Deutschen für unmöglich halten würden, wenn
es nicht amtlich berichtet worden wäre. Eine ganze Reihe von
Franzosen haben bei diesem Anlasse der Straßburger Bibliothek
Bücher zurückgegeben, die sie bezw. ihre Väter vor 1870 aus-
geliehen und seitdem „zu treuen Händen“ bewahrt, oder wie man
es rechtlich treffender bezeichnen würde, unterschlagen hatten,
um sie nicht den Deutschen zu überlassen! Höchst gleichgültige
Druckwerke übrigens, nach deren Verlust kein Hahn krähen würde,
die aber doch dieser seltsamen Art von Patrioten eine ehrenvolle
Erwähnung in der französischen Presse, und wer weiß, vielleicht
sogar den „officier de l’lnstruction publique“ eintragen werden.
Diejenigen alten Straßburger Professoren, die dergleichen immer
für möglich gehalten haben, haben also recht behalten. Das
immer wieder auftauchende Gerücht, daß in Frankreich noch Teile
der ehemaligen Straßburger Bibliothek versteckt gehalten würden,
hat sich als begründet erwiesen, wenn auch in sehr bescheidenem
Umfange. Offenbar haben die Hinterzieher sich selbst im engeren
Kreise ihrer Tat gerühmt, die Fama hat dann den Tatsachenkern
vergrößert und so ist die Fabel von der Rettung der verlorenen
Handschriften entstanden. Sie kann nun als endgiltig begraben
gelten. Keines Erdgeborenen Auge wird sich jemals wieder an
dem köstlichen aller romanischen Bildermanuskripte des deutschen
Mittelalters erlaben. W. S.
Die cbincdfcbcn RollbÜdeü*
Der Berliner China-Sammler 0. Gackenholz sendet uns
nachstehende bemerkenswerte Zuschrift: Angeregt durch die Ab-
handlung des Herrn R. Weinzetl über die Kopie ifuder ost-
asiatischen Malerei im 1. Novemberheft des „Kunsthändlers“
erlaube ich mir, folgende Gedanken mitzuteilen. ■ ’*' *
Um manche Dinge, gerade auch in der Malerei, ‘vötf Ver-
stehen zu können, muß man in China längere Zeit gelebt Und
besonders das Leben im Innern dieses Riesenreiches kennen ge-
lernt haben. Dies ist bislang nicht genügend beachtet worden.
In den Vertragshäfen und der Hauptstadt Peking ist das Leben
der Chinesen mit dem Einfluß Europas schon vielfach verwebt,
in den weiten Strecken des Innern lebt der Chinese aber noch
davon unberührt. Dort erkennt man seinen konservativen Sinn
und oft erscheint einem das Leben als eine Schilderung aus dem
allen Testament. Hat man dies gesehen, dann wird einem klar,
daß hier die vielhunderljährige Überlieferung der Kopie eine be-
herrschende Rolle zuteilen mußte. Pflegestätten der Kunst, Kirchen,
Paläste oder ein Patriziertum der Städte wie im Abendlande gab
es nicht. Die Vornehmheit der Yamen und die Schönheit der
Tempel zeigt sich weniger durch innere Pracht, als durch ihre
Ausdehnung und die Auswahl der herrlichsten Plätze zu ihrer
Anlage. Aufträge für einen Michel Angelo, Raffael, Correggio usw.
sind nicht zu vergeben, Freskomalereien nicht vorhanden. Auch
das Fehlen der Ölfarbe spielt eine Rolle. Bei der Bauart der
Gebäude ist es verständlich, daß die Wände selten bemalt wurden.
Oft bedeutet Wandmalerei nur, daß eine Stellwand, wir sagen
„Wandschirm“ bemalt wurde. Zudem waren die Ataler in China
nie Künstler oder Kunstmaler nach unserem westlichen Begriff.
Staatswürdenträger, oft hohen Ranges, Gelehrte und Priester
stellen die Mehrzahl der Maler. Von Schulen, wie im Abend-
lande oder in dem unserem mittelalterlichen Europa vielfach
ähnelnden Samurai-Japan kann kaum die Rede sein. So bleibt
schließlich in Wirklichkeit ein in der Einsamkeit seines Yamens
oder Tempels auf Papier- und Seidenrollen malender Künstler
übrig, der aus innerem Triebe, oft nur sich selbst zum Vergnügen
malt. Man könnte sagen ein Dilettant und doch oft ein Meister.
Bei der ganzen Art des Lebens und der schon vorjahrhunderten
dem Chinesen innewohnenden pazifistischen, universellen Auf-
fassung, kann der hohe Staatsbeamte, Gelehrte und Priester seine
Vorlagen nicht dem Markte und dem Lärm der Städte entnehmen.
Auch der Kultus des schönen Fleisches und das Komponieren
der Historienmalerei kommt für ihn nicht in Frage. Er muß sich
in den Grenzen halten, die ihm als gottgewollte Abhängigkeiten
gegeben erscheinen. Zieht man dies in Betracht, so wird es
klar, daß die Motive: Heilige, Berglandschaften, Vögel, Blumen usw.
immer wiederkehren. Denkt man an die meist auf hohen Bergen
und steilen Abhängen gelegenen Tempel und Klöster, so wird
auch die eigenartige Perspektive leichter zu erklären sein, dieses
Vonobensehen. Auch aus den Motiven heraus ist das Kopieren
zu begreifen. Eine Blume blüht nicht immer, ein Vogel sitzt
nicht zu dauernder Betrachtung. Sehe ich aber etwas derartiges
gut erfaßt, so kommt bei einem Maler leicht der Gedanke, es zu
kopieren, bei einem Nichtmaler der Wunsch, es zu besitzen.
Wurde nun Jemand als Meister bekannt, sein Ruf ruchbar,
so berief ihn der Kaiser wohl an den Hof. Das genügte dann,
Carl Brack & Keller, G. m. b. H„ Berlin W. 9
Kleine gewählte Collection alter u. moderner Meister
Ankauf □ Angebote erbeten □ Verkauf
195