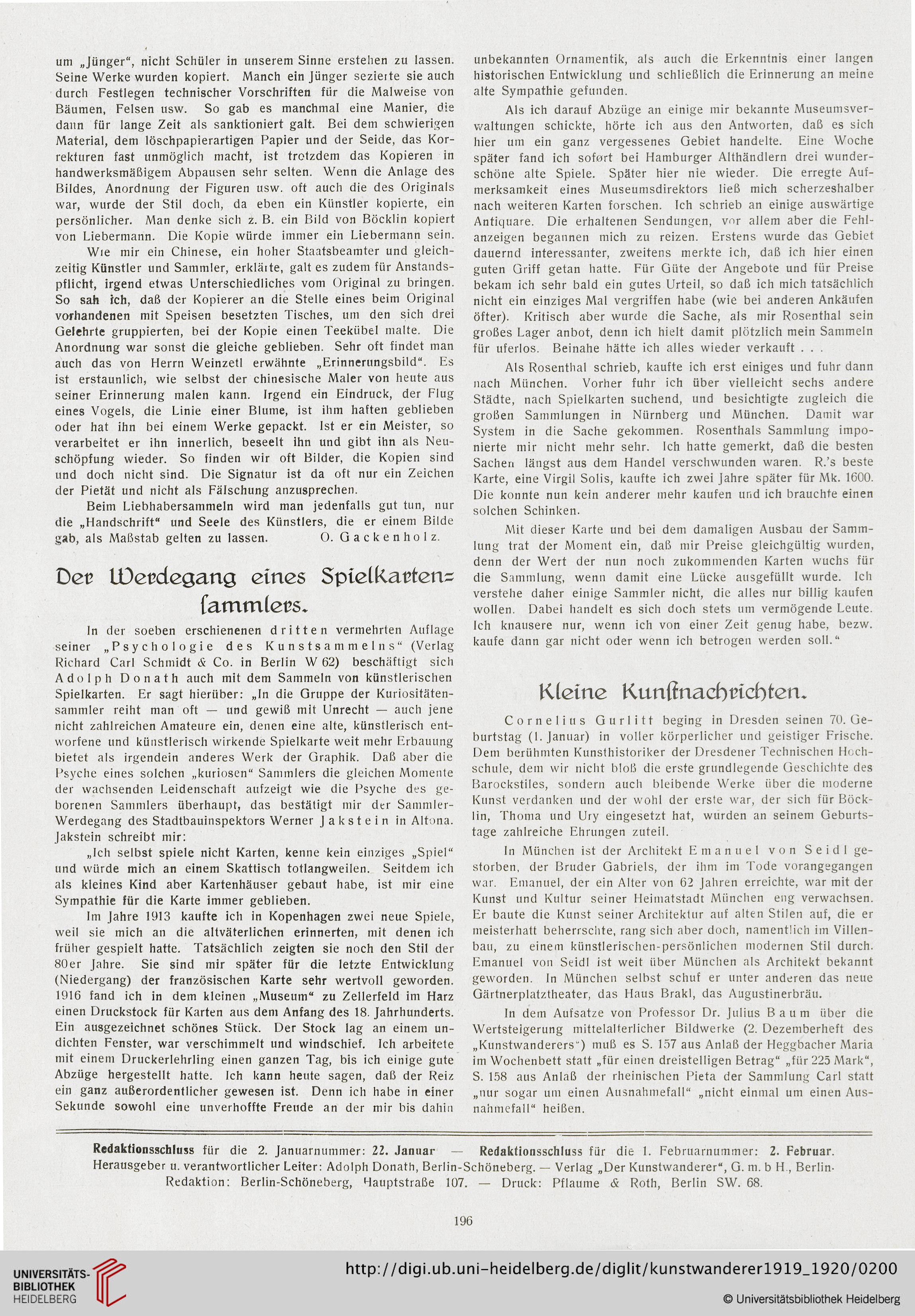um „Jünger“, nicht Schüler in unserem Sinne erstehen zu lassen.
Seine Werke wurden kopiert. Manch ein Jünger sezierte sie auch
durch Festlegen technischer Vorschriften für die Malweise von
Bäumen, Felsen usw. So gab es manchmal eine Manier, die
dann für lange Zeit als sanktioniert galt. Bei dem schwierigen
Material, dem löschpapierartigen Papier und der Seide, das Kor-
rekturen fast unmöglich macht, ist trotzdem das Kopieren in
handwerksmäßigem Abpausen sehr selten. Wenn die Anlage des
Bildes, Anordnung der Figuren usw. oft auch die des Originals
war, wurde der Stil doch, da eben ein Künstler kopierte, ein
persönlicher. Man denke sich z. B. ein Bild von Böcklin kopiert
von Liebermann. Die Kopie würde immer ein Liebermann sein.
Wie mir ein Chinese, ein hoher Staatsbeamter und gleich-
zeitig Künstler und Sammler, erkläite, galt es zudem für Anstands-
pflicht, irgend etwas Unterschiedliches vom Original zu bringen.
So sah ich, daß der Kopierer an die Stelle eines beim Original
vorhandenen mit Speisen besetzten Tisches, um den sich drei
Gelehrte gruppierten, bei der Kopie einen Teekübel malte. Die
Anordnung war sonst die gleiche geblieben. Sehr oft findet man
auch das von Herrn Weinzetl erwähnte „Erinnerungsbild“. Es
ist erstaunlich, wie selbst der chinesische Maler von heute aus
seiner Erinnerung malen kann. Irgend ein Eindruck, der Flug
eines Vogels, die Linie einer Blume, ist ihm haften geblieben
oder hat ihn bei einem Werke gepackt. Ist er ein Meister, so
verarbeitet er ihn innerlich, beseelt ihn und gibt ihn als Neu-
schöpfung wieder. So finden wir oft Bilder, die Kopien sind
und doch nicht sind. Die Signatur ist da oft nur ein Zeichen
der Pietät und nicht als Fälschung anzusprechen.
Beim Liebhabersammeln wird man jedenfalls gut tun, nur
die „Handschrift“ und Seele des Künstlers, die er einem Bilde
gab, als Maßstab gelten zu lassen. O. Gackenholz.
Det? IDeüdegang eines Spielkarten-
fammlet’s.
ln der soeben erschienenen dritten vermehrten Auflage
seiner „Psychologie des Kunstsammelns“ (Verlag
Richard Carl Schmidt & Co. in Berlin W 62) beschäftigt sich
Adolph Donath auch mit dem Sammeln von künstlerischen
Spielkarten. Er sagt hierüber: „In die Gruppe der Kuriositäten-
sammler reiht man oft — und gewiß mit Unrecht — auch jene
nicht zahlreichen Amateure ein, denen eine alte, künstlerisch ent-
worfene und künstlerisch wirkende Spielkarte weit mehr Erbauung
bietet als irgendein anderes Werk der Graphik. Daß aber die
Psyche eines solchen „kuriosen“ Sammlers die gleichen Momente
der wachsenden Leidenschaft aufzeigt wie die Psyche des ge-
borenen Sammlers überhaupt, das bestätigt mir der Sammler-
Werdegang des Stadtbauinspektors Werner J a k s t e i n in Altona.
Jakstein schreibt mir:
„Ich selbst spiele nicht Karten, kenne kein einziges „Spiel“
und würde mich an einem Skattisch totlangweilen. Seitdem ich
als kleines Kind aber Kartenhäuser gebaut habe, ist mir eine
Sympathie für die Karte immer geblieben.
Im Jahre 1913 kaufte ich in Kopenhagen zwei neue Spiele,
weil sie mich an die altväterlichen erinnerten, mit denen ich
früher gespielt hatte. Tatsächlich zeigten sie noch den Stil der
80er Jahre. Sie sind mir später für die letzte Entwicklung
(Niedergang) der französischen Karte sehr wertvoll geworden.
1916 fand ich in dem kleinen „Museum“ zu Zellerfeld im Harz
einen Druckstock für Karten aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts.
Ein ausgezeichnet schönes Stück. Der Stock lag an einem un-
dichten Fenster, war verschimmelt und windschief. Ich arbeitete
mit einem Druckerlehrling einen ganzen Tag, bis ich einige gute
Abzüge hergestellt hatte. Ich kann heute sagen, daß der Reiz
ein ganz außerordentlicher gewesen ist. Denn ich habe in einer
Sekunde sowohl eine unverhoffte Freude an der mir bis dahin
unbekannten Ornamentik, als auch die Erkenntnis einer langen
historischen Entwicklung und schließlich die Erinnerung an meine
alte Sympathie gefunden.
Als ich darauf Abzüge an einige mir bekannte Museumsver-
waltungen schickte, hörte ich aus den Antworten, daß es sich
hier um ein ganz vergessenes Gebiet handelte. Eine Woche
später fand ich sofort bei Hamburger Althändlern drei wunder-
schöne alte Spiele. Später hier nie wieder. Die erregte Auf-
merksamkeit eines Museumsdirektors ließ mich scherzeshalber
nach weiteren Karten forschen. Ich schrieb an einige auswärtige
Antiquare. Die erhaltenen Sendungen, vor allem aber die Fehl-
anzeigen begannen mich zu reizen. Erstens wurde das Gebiet
dauernd interessanter, zweitens merkte ich, daß ich hier einen
guten Griff getan hatte. Für Güte der Angebote und für Preise
bekam ich sehr bald ein gutes Urteil, so daß ich mich tatsächlich
nicht ein einziges Mal vergriffen habe (wie bei anderen Ankäufen
öfter). Kritisch aber wurde die Sache, als mir Rosenthal sein
großes Lager anbot, denn ich hielt damit plötzlich mein Sammeln
für uferlos. Beinahe hätte ich alles wieder verkauft . . .
Als Rosenthal schrieb, kaufte ich erst einiges und fuhr dann
nach München. Vorher fuhr ich über vielleicht sechs andere
Städte, nach Spielkarten suchend, und besichtigte zugleich die
großen Sammlungen in Nürnberg und München. Damit war
System in die Sache gekommen. Rosenthals Sammlung impo-
nierte mir nicht mehr sehr. Ich hatte gemerkt, daß die besten
Sachen längst aus dem Handel verschwunden waren. R.’s beste
Karte, eine Virgil Solis, kaufte ich zwei Jahre später für Mk. 1600.
Die konnte nun kein anderer mehr kaufen und ich brauchte einen
solchen Schinken.
Mit dieser Karte und bei dem damaligen Ausbau der Samm-
lung trat der Moment ein, daß mir Preise gleichgültig wurden,
denn der Wert der nun noch zukommenden Karten wuchs für
die Sammlung, wenn damit eine Lücke ausgefüllt wurde. Ich
verstehe daher einige Sammler nicht, die alles nur billig kaufen
wollen. Dabei handelt es sich doch stets um vermögende Leute.
Ich knausere nur, wenn ich von einer Zeit genug habe, bezw.
kaufe dann gar nicht oder wenn ich betrogen werden soll.“
Kleine Kun{inacf)rtcf)ten.
Cornelius Gurlitt beging in Dresden seinen 70. Ge-
burtstag (1. Januar) in voller körperlicher und geistiger Frische.
Dem berühmten Kunsthistoriker der Dresdener Technischen Hoch-
schule, dem wir nicht bloß die erste grundlegende Geschichte des
Barockstiles, sondern auch bleibende Werke über die moderne
Kunst verdanken und der wohl der erste war, der sich für Böck-
lin, Thoma und Ury eingesetzt hat, wurden an seinem Geburts-
tage zahlreiche Ehrungen zuteil.
In München ist der Architekt Emanuel von Seidl ge-
storben, der Bruder Gabriels, der ihm im Tode vorangegangen
war. Emanuel, der ein Alter von 62 Jahren erreichte, war mit der
Kunst und Kultur seiner Heimatstadt München eng verwachsen.
Er baute die Kunst seiner Architektur auf alten Stilen auf, die er
meisterhaft beherrschte, rang sich aber doch, namentlich im Villen-
bau, zu einem künstlerischen-persönlichen modernen Stil durch.
Emanuel von Seidl ist weit über München als Architekt bekannt
geworden, ln München selbst schuf er unter anderen das neue
Gärtnerplatztheater, das Haus Brak!, das Augustinerbräu.
In dem Aufsatze von Professor Dr. Julius Baum über die
Wertsteigerung mittelalterlicher Bildwerke (2. Dezemberheft des
„Kunstwanderers“) muß es S. 157 aus Anlaß der Heggbacher Maria
im Wochenbett statt „für einen dreistelligen Betrag“ „für 225 Mark“,
S. 158 aus Anlaß der rheinischen Pieta der Sammlung Carl statt
„nur sogar um einen Ausnahmefall“ „nicht einmal um einen Aus-
nahmefall“ heißen.
Redaktionsschluss für die 2. Januarnummer: 22. Januar — Redaktionsschluss für die 1. Februarnummer: 2. Februar.
Herausgeber u. verantwortlicher Leiter: Adolph Donath, Berlin-Schöneberg. — Verlag „Der Kunstwanderer“, G. m. b H , Berlin-
Redaktion: Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 107. — Druck: Pflaume & Roth, Berlin SW. 68.
196
Seine Werke wurden kopiert. Manch ein Jünger sezierte sie auch
durch Festlegen technischer Vorschriften für die Malweise von
Bäumen, Felsen usw. So gab es manchmal eine Manier, die
dann für lange Zeit als sanktioniert galt. Bei dem schwierigen
Material, dem löschpapierartigen Papier und der Seide, das Kor-
rekturen fast unmöglich macht, ist trotzdem das Kopieren in
handwerksmäßigem Abpausen sehr selten. Wenn die Anlage des
Bildes, Anordnung der Figuren usw. oft auch die des Originals
war, wurde der Stil doch, da eben ein Künstler kopierte, ein
persönlicher. Man denke sich z. B. ein Bild von Böcklin kopiert
von Liebermann. Die Kopie würde immer ein Liebermann sein.
Wie mir ein Chinese, ein hoher Staatsbeamter und gleich-
zeitig Künstler und Sammler, erkläite, galt es zudem für Anstands-
pflicht, irgend etwas Unterschiedliches vom Original zu bringen.
So sah ich, daß der Kopierer an die Stelle eines beim Original
vorhandenen mit Speisen besetzten Tisches, um den sich drei
Gelehrte gruppierten, bei der Kopie einen Teekübel malte. Die
Anordnung war sonst die gleiche geblieben. Sehr oft findet man
auch das von Herrn Weinzetl erwähnte „Erinnerungsbild“. Es
ist erstaunlich, wie selbst der chinesische Maler von heute aus
seiner Erinnerung malen kann. Irgend ein Eindruck, der Flug
eines Vogels, die Linie einer Blume, ist ihm haften geblieben
oder hat ihn bei einem Werke gepackt. Ist er ein Meister, so
verarbeitet er ihn innerlich, beseelt ihn und gibt ihn als Neu-
schöpfung wieder. So finden wir oft Bilder, die Kopien sind
und doch nicht sind. Die Signatur ist da oft nur ein Zeichen
der Pietät und nicht als Fälschung anzusprechen.
Beim Liebhabersammeln wird man jedenfalls gut tun, nur
die „Handschrift“ und Seele des Künstlers, die er einem Bilde
gab, als Maßstab gelten zu lassen. O. Gackenholz.
Det? IDeüdegang eines Spielkarten-
fammlet’s.
ln der soeben erschienenen dritten vermehrten Auflage
seiner „Psychologie des Kunstsammelns“ (Verlag
Richard Carl Schmidt & Co. in Berlin W 62) beschäftigt sich
Adolph Donath auch mit dem Sammeln von künstlerischen
Spielkarten. Er sagt hierüber: „In die Gruppe der Kuriositäten-
sammler reiht man oft — und gewiß mit Unrecht — auch jene
nicht zahlreichen Amateure ein, denen eine alte, künstlerisch ent-
worfene und künstlerisch wirkende Spielkarte weit mehr Erbauung
bietet als irgendein anderes Werk der Graphik. Daß aber die
Psyche eines solchen „kuriosen“ Sammlers die gleichen Momente
der wachsenden Leidenschaft aufzeigt wie die Psyche des ge-
borenen Sammlers überhaupt, das bestätigt mir der Sammler-
Werdegang des Stadtbauinspektors Werner J a k s t e i n in Altona.
Jakstein schreibt mir:
„Ich selbst spiele nicht Karten, kenne kein einziges „Spiel“
und würde mich an einem Skattisch totlangweilen. Seitdem ich
als kleines Kind aber Kartenhäuser gebaut habe, ist mir eine
Sympathie für die Karte immer geblieben.
Im Jahre 1913 kaufte ich in Kopenhagen zwei neue Spiele,
weil sie mich an die altväterlichen erinnerten, mit denen ich
früher gespielt hatte. Tatsächlich zeigten sie noch den Stil der
80er Jahre. Sie sind mir später für die letzte Entwicklung
(Niedergang) der französischen Karte sehr wertvoll geworden.
1916 fand ich in dem kleinen „Museum“ zu Zellerfeld im Harz
einen Druckstock für Karten aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts.
Ein ausgezeichnet schönes Stück. Der Stock lag an einem un-
dichten Fenster, war verschimmelt und windschief. Ich arbeitete
mit einem Druckerlehrling einen ganzen Tag, bis ich einige gute
Abzüge hergestellt hatte. Ich kann heute sagen, daß der Reiz
ein ganz außerordentlicher gewesen ist. Denn ich habe in einer
Sekunde sowohl eine unverhoffte Freude an der mir bis dahin
unbekannten Ornamentik, als auch die Erkenntnis einer langen
historischen Entwicklung und schließlich die Erinnerung an meine
alte Sympathie gefunden.
Als ich darauf Abzüge an einige mir bekannte Museumsver-
waltungen schickte, hörte ich aus den Antworten, daß es sich
hier um ein ganz vergessenes Gebiet handelte. Eine Woche
später fand ich sofort bei Hamburger Althändlern drei wunder-
schöne alte Spiele. Später hier nie wieder. Die erregte Auf-
merksamkeit eines Museumsdirektors ließ mich scherzeshalber
nach weiteren Karten forschen. Ich schrieb an einige auswärtige
Antiquare. Die erhaltenen Sendungen, vor allem aber die Fehl-
anzeigen begannen mich zu reizen. Erstens wurde das Gebiet
dauernd interessanter, zweitens merkte ich, daß ich hier einen
guten Griff getan hatte. Für Güte der Angebote und für Preise
bekam ich sehr bald ein gutes Urteil, so daß ich mich tatsächlich
nicht ein einziges Mal vergriffen habe (wie bei anderen Ankäufen
öfter). Kritisch aber wurde die Sache, als mir Rosenthal sein
großes Lager anbot, denn ich hielt damit plötzlich mein Sammeln
für uferlos. Beinahe hätte ich alles wieder verkauft . . .
Als Rosenthal schrieb, kaufte ich erst einiges und fuhr dann
nach München. Vorher fuhr ich über vielleicht sechs andere
Städte, nach Spielkarten suchend, und besichtigte zugleich die
großen Sammlungen in Nürnberg und München. Damit war
System in die Sache gekommen. Rosenthals Sammlung impo-
nierte mir nicht mehr sehr. Ich hatte gemerkt, daß die besten
Sachen längst aus dem Handel verschwunden waren. R.’s beste
Karte, eine Virgil Solis, kaufte ich zwei Jahre später für Mk. 1600.
Die konnte nun kein anderer mehr kaufen und ich brauchte einen
solchen Schinken.
Mit dieser Karte und bei dem damaligen Ausbau der Samm-
lung trat der Moment ein, daß mir Preise gleichgültig wurden,
denn der Wert der nun noch zukommenden Karten wuchs für
die Sammlung, wenn damit eine Lücke ausgefüllt wurde. Ich
verstehe daher einige Sammler nicht, die alles nur billig kaufen
wollen. Dabei handelt es sich doch stets um vermögende Leute.
Ich knausere nur, wenn ich von einer Zeit genug habe, bezw.
kaufe dann gar nicht oder wenn ich betrogen werden soll.“
Kleine Kun{inacf)rtcf)ten.
Cornelius Gurlitt beging in Dresden seinen 70. Ge-
burtstag (1. Januar) in voller körperlicher und geistiger Frische.
Dem berühmten Kunsthistoriker der Dresdener Technischen Hoch-
schule, dem wir nicht bloß die erste grundlegende Geschichte des
Barockstiles, sondern auch bleibende Werke über die moderne
Kunst verdanken und der wohl der erste war, der sich für Böck-
lin, Thoma und Ury eingesetzt hat, wurden an seinem Geburts-
tage zahlreiche Ehrungen zuteil.
In München ist der Architekt Emanuel von Seidl ge-
storben, der Bruder Gabriels, der ihm im Tode vorangegangen
war. Emanuel, der ein Alter von 62 Jahren erreichte, war mit der
Kunst und Kultur seiner Heimatstadt München eng verwachsen.
Er baute die Kunst seiner Architektur auf alten Stilen auf, die er
meisterhaft beherrschte, rang sich aber doch, namentlich im Villen-
bau, zu einem künstlerischen-persönlichen modernen Stil durch.
Emanuel von Seidl ist weit über München als Architekt bekannt
geworden, ln München selbst schuf er unter anderen das neue
Gärtnerplatztheater, das Haus Brak!, das Augustinerbräu.
In dem Aufsatze von Professor Dr. Julius Baum über die
Wertsteigerung mittelalterlicher Bildwerke (2. Dezemberheft des
„Kunstwanderers“) muß es S. 157 aus Anlaß der Heggbacher Maria
im Wochenbett statt „für einen dreistelligen Betrag“ „für 225 Mark“,
S. 158 aus Anlaß der rheinischen Pieta der Sammlung Carl statt
„nur sogar um einen Ausnahmefall“ „nicht einmal um einen Aus-
nahmefall“ heißen.
Redaktionsschluss für die 2. Januarnummer: 22. Januar — Redaktionsschluss für die 1. Februarnummer: 2. Februar.
Herausgeber u. verantwortlicher Leiter: Adolph Donath, Berlin-Schöneberg. — Verlag „Der Kunstwanderer“, G. m. b H , Berlin-
Redaktion: Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 107. — Druck: Pflaume & Roth, Berlin SW. 68.
196