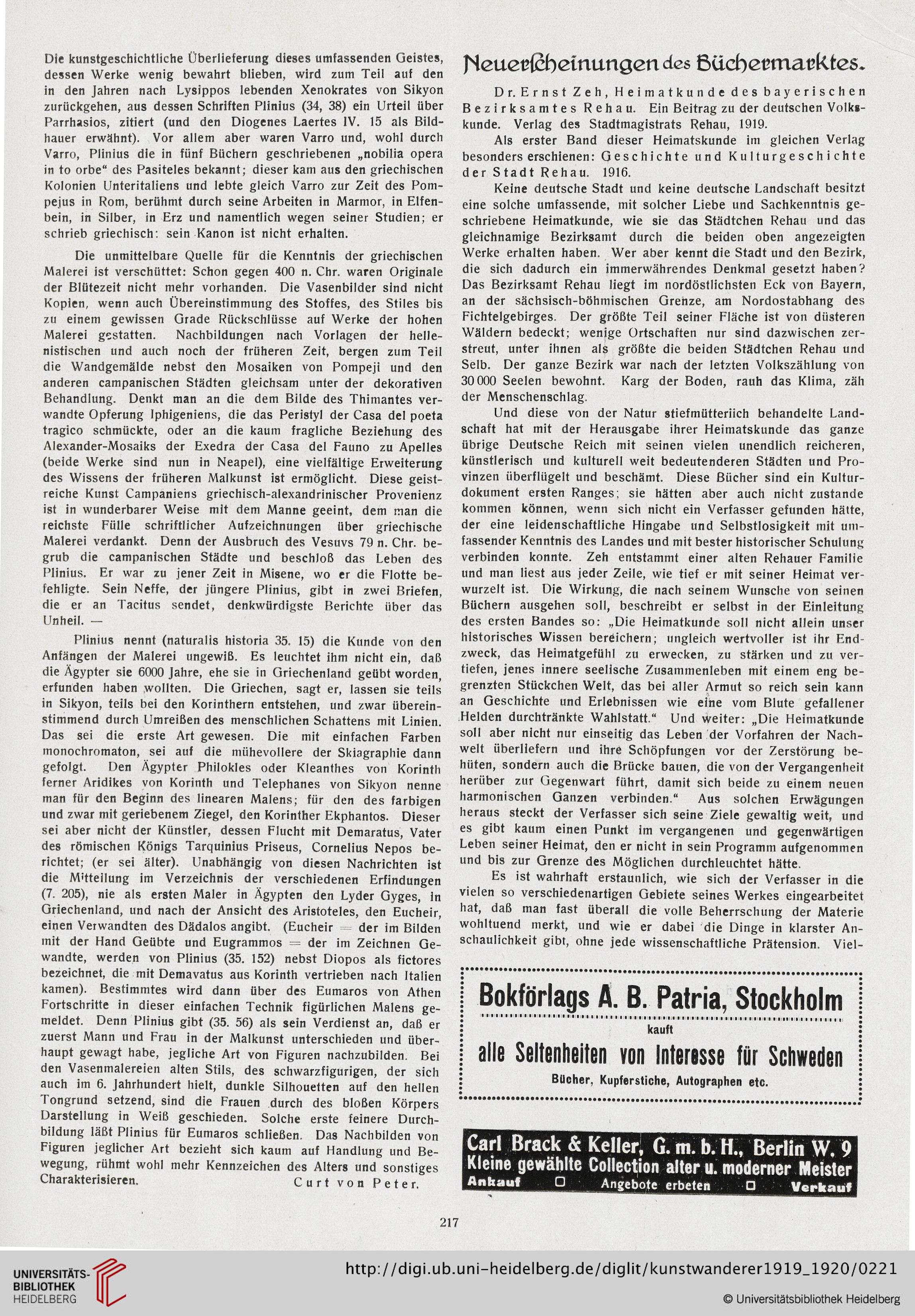Die kunstgeschichtliche Überlieferung dieses umfassenden Geistes,
dessen Werke wenig bewahrt blieben, wird zum Teil auf den
in den Jahren nach Lysippos lebenden Xenokrates von Sikyon
zurückgehen, aus dessen Schriften Plinius (34, 38) ein Urteil über
Parrhasios, zitiert (und den Diogenes Laertes IV. 15 als Bild-
hauer erwähnt). Vor allem aber waren Varro und, wohl durch
Varro, Plinius die in fünf Büchern geschriebenen „nobilia opera
in to orbe“ des Pasiteles bekannt; dieser kam aus den griechischen
Kolonien Unteritaliens und lebte gleich Varro zur Zeit des Pom-
pejus in Rom, berühmt durch seine Arbeiten in Marmor, in Elfen-
bein, in Silber, in Erz und namentlich wegen seiner Studien; er
schrieb griechisch; sein Kanon ist nicht erhalten.
Die unmittelbare Quelle für die Kenntnis der griechischen
Malerei ist verschüttet: Schon gegen 400 n. Chr. waren Originale
der Blütezeit nicht mehr vorhanden. Die Vasenbilder sind nicht
Kopien, wenn auch Übereinstimmung des Stoffes, des Stiles bis
zu einem gewissen Grade Rückschlüsse auf Werke der hohen
Malerei gestatten. Nachbildungen nach Vorlagen der helle-
nistischen und auch noch der früheren Zeit, bergen zum Teil
die Wandgemälde nebst den Mosaiken von Pompeji und den
anderen campanischen Städten gleichsam unter der dekorativen
Behandlung. Denkt man an die dem Bilde des Thimantes ver-
wandte Opferung Iphigeniens, die das Peristy! der Casa del poeta
tragico schmückte, oder an die kaum fragliche Beziehung des
Alexander-Mosaiks der Exedra der Casa del Fauno zu Apelles
(beide Werke sind nun in Neapel), eine vielfältige Erweiterung
des Wissens der früheren Malkunst ist ermöglicht. Diese geist-
reiche Kunst Campaniens griechisch-alexandrinischer Provenienz
ist in wunderbarer Weise mit dem Manne geeint, dem man die
reichste Fülle schriftlicher Aufzeichnungen Uber griechische
Malerei verdankt. Denn der Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. be-
grub die campanischen Städte und beschloß das Leben des
Plinius. Er war zu jener Zeit in Misene, wo er die Flotte be-
fehligte. Sein Neffe, der jüngere Plinius, gibt in zwei Briefen,
die er an Tacitus sendet, denkwürdigste Berichte über das
Unheil. —
Plinius nennt (naturalis historia 35. 15) die Kunde von den
Anfängen der Malerei ungewiß. Es leuchtet ihm nicht ein, daß
die Ägypter sie 6000 Jahre, ehe sie in Griechenland geübt worden,
erfunden haben wollten. Die Griechen, sagt er, lassen sie teils
in Sikyon, teils bei den Korinthern entstehen, und zwar überein-
stimmend durch Umreißen des menschlichen Schattens mit Linien.
Das sei die erste Art gewesen. Die mit einfachen Farben
monochromaton, sei auf die mühevollere der Skiagraphie dann
gefolgt. Den Ägypter Philokles oder Kleanthes von Korinth
ferner Aridikes von Korinth und Telephanes von Sikyon nenne
man für den Beginn des linearen Malens; für den des farbigen
und zwar mit geriebenem Ziegel, den Korinther Ekphantos. Dieser
sei aber nicht der Künstler, dessen Flucht mit Demaratus, Vater
des römischen Königs Tarquinius Priseus, Cornelius Nepos be-
richtet; (er sei älter). Unabhängig von diesen Nachrichten ist
die M'tteilung im Verzeichnis der verschiedenen Erfindungen
(7. 205), nie als ersten Maler in Ägypten den Lyder Gyges, in
Griechenland, und nach der Ansicht des Aristoteles, den Eucheir,
einen Verwandten des Dädalos angibt. (Eucheir der im Bilden
mit der Hand Geübte und Eugrammos = der im Zeichnen Ge-
wandte, werden von Plinius (35. 152) nebst Diopos als fictores
bezeichnet, die mit Demavatus aus Korinth vertrieben nach Italien
kamen). Bestimmtes wird dann über des Eumaros von Athen
Fortschritte in dieser einfachen Technik figürlichen Malens ge-
meldet. Denn Plinius gibt (35. 56) als sein Verdienst an, daß er
zuerst Mann und Frau in der Malkunst unterschieden und über-
haupt gewagt habe, jegliche Art von Figuren nachzubilden. Bei
den Vasenmalereien alten Stils, des schwarzfigurigen, der sich
auch im 6. Jahrhundert hielt, dunkle Silhouetten auf den hellen
Tongrund setzend, sind die Frauen durch des bloßen Körpers
Darstellung in Weiß geschieden. Solche erste feinere Durch-
bildung läßt Plinius für Eumaros schließen. Das Nachbilden von
Figuren jeglicher Art bezieht sich kaum auf Handlung und Be-
wegung, rühmt wohl mehr Kennzeichen des Alters und sonstiges
Charakterisieren. Curt von Peter.
JHeuct?{cbetnungcn des BücbetnnarKtes.
Dr. Ernst Zeh, Heimatkunde des bayerischen
Bezirksamtes Reha u. Ein Beitrag zu der deutschen Volks-
kunde. Verlag des Stadtmagistrats Rehau, 1919.
Als erster Band dieser Heimatskunde im gleichen Verlag
besonders erschienen: Geschichte und Kulturgeschichte
der Stadt Rehau. 1916.
Keine deutsche Stadt und keine deutsche Landschaft besitzt
eine solche umfassende, mit solcher Liebe und Sachkenntnis ge-
schriebene Heimatkunde, wie sie das Städtchen Rehau und das
gleichnamige Bezirksamt durch die beiden oben angezeigten
Werke erhalten haben. Wer aber kennt die Stadt und den Bezirk,
die sich dadurch ein immerwährendes Denkmal gesetzt haben?
Das Bezirksamt Rehau liegt im nordöstlichsten Eck von Bayern,
an der sächsisch-böhmischen Grenze, am Nordostabhang des
Fichtelgebirges. Der größte Teil seiner Fläche ist von düsteren
Wäldern bedeckt; wenige Ortschaften nur sind dazwischen zer-
streut, unter ihnen als größte die beiden Städtchen Rehau und
Selb. Der ganze Bezirk war nach der letzten Volkszählung von
30000 Seelen bewohnt. Karg der Boden, rauh das Klima, zäh
der Menschenschlag.
Und diese von der Natur stiefmütterlich behandelte Land-
schaft hat mit der Herausgabe ihrer Heimatskunde das ganze
übrige Deutsche Reich mit seinen vielen unendlich reicheren,
künstlerisch und kulturell weit bedeutenderen Städten und Pro-
vinzen überflügelt und beschämt. Diese Bücher sind ein Kultur-
dokument ersten Ranges; sie hätten aber auch nicht zustande
kommen können, wenn sich nicht ein Verfasser gefunden hätte,
der eine leidenschaftliche Hingabe und Selbstlosigkeit mit um-
fassender Kenntnis des Landes und mit bester historischer Schulung
verbinden konnte. Zeh entstammt einer alten Rehauer Familie
und man liest aus jeder Zeile, wie tief er mit seiner Heimat ver-
wurzelt ist. Die Wirkung, die nach seinem Wunsche von seinen
Büchern ausgehen soll, beschreibt er selbst in der Einleitung
des ersten Bandes so: „Die Heimatkunde soll nicht allein unser
historisches Wissen bereichern; ungleich wertvoller ist ihr End-
zweck, das Heimatgefühl zu erwecken, zu stärken und zu ver-
tiefen, jenes innere seelische Zusammenleben mit einem eng be-
grenzten Stückchen Welt, das bei aller Armut so reich sein kann
an Geschichte und Erlebnissen wie eine vom Blute gefallener
Helden durchtränkte Wahlstatt.“ Und weiter: „Die Heimatkunde
soll aber nicht nur einseitig das Leben der Vorfahren der Nach-
welt überliefern und ihre Schöpfungen vor der Zerstörung be-
hüten, sondern auch die Brücke bauen, die von der Vergangenheit
herüber zur Gegenwart führt, damit sich beide zu einem neuen
harmonischen Ganzen verbinden.“ Aus solchen Erwägungen
heraus steckt der Verfasser sich seine Ziele gewaltig weit, und
es gibt kaum einen Punkt im vergangenen und gegenwärtigen
Leben seiner Heimat, den er nicht in sein Programm aufgenommen
und bis zur Grenze des Möglichen durchleuchtet hätte.
Es ist wahrhaft erstaunlich, wie sich der Verfasser in die
vielen so verschiedenartigen Gebiete seines Werkes eingearbeitet
hat, daß man fast überall die volle Beherrschung der Materie
wohltuend merkt, und wie er dabei die Dinge in klarster An-
schaulichkeit gibt, ohne jede wissenschaftliche Prätension. Viel-
Bokförlags A. B. Patria, Stockholm
kauft
alle Seltenheiten von Interesse für Schweden
Bücher. Kupferstiche, Autographen etc.
Carl Brack & Keller, G. m. b. H., Berlin W. 9
Kleine gewählte Collection alter u. moderner Meister
Ankauf □ Angebote erbeten □ Verkauf
217
dessen Werke wenig bewahrt blieben, wird zum Teil auf den
in den Jahren nach Lysippos lebenden Xenokrates von Sikyon
zurückgehen, aus dessen Schriften Plinius (34, 38) ein Urteil über
Parrhasios, zitiert (und den Diogenes Laertes IV. 15 als Bild-
hauer erwähnt). Vor allem aber waren Varro und, wohl durch
Varro, Plinius die in fünf Büchern geschriebenen „nobilia opera
in to orbe“ des Pasiteles bekannt; dieser kam aus den griechischen
Kolonien Unteritaliens und lebte gleich Varro zur Zeit des Pom-
pejus in Rom, berühmt durch seine Arbeiten in Marmor, in Elfen-
bein, in Silber, in Erz und namentlich wegen seiner Studien; er
schrieb griechisch; sein Kanon ist nicht erhalten.
Die unmittelbare Quelle für die Kenntnis der griechischen
Malerei ist verschüttet: Schon gegen 400 n. Chr. waren Originale
der Blütezeit nicht mehr vorhanden. Die Vasenbilder sind nicht
Kopien, wenn auch Übereinstimmung des Stoffes, des Stiles bis
zu einem gewissen Grade Rückschlüsse auf Werke der hohen
Malerei gestatten. Nachbildungen nach Vorlagen der helle-
nistischen und auch noch der früheren Zeit, bergen zum Teil
die Wandgemälde nebst den Mosaiken von Pompeji und den
anderen campanischen Städten gleichsam unter der dekorativen
Behandlung. Denkt man an die dem Bilde des Thimantes ver-
wandte Opferung Iphigeniens, die das Peristy! der Casa del poeta
tragico schmückte, oder an die kaum fragliche Beziehung des
Alexander-Mosaiks der Exedra der Casa del Fauno zu Apelles
(beide Werke sind nun in Neapel), eine vielfältige Erweiterung
des Wissens der früheren Malkunst ist ermöglicht. Diese geist-
reiche Kunst Campaniens griechisch-alexandrinischer Provenienz
ist in wunderbarer Weise mit dem Manne geeint, dem man die
reichste Fülle schriftlicher Aufzeichnungen Uber griechische
Malerei verdankt. Denn der Ausbruch des Vesuvs 79 n. Chr. be-
grub die campanischen Städte und beschloß das Leben des
Plinius. Er war zu jener Zeit in Misene, wo er die Flotte be-
fehligte. Sein Neffe, der jüngere Plinius, gibt in zwei Briefen,
die er an Tacitus sendet, denkwürdigste Berichte über das
Unheil. —
Plinius nennt (naturalis historia 35. 15) die Kunde von den
Anfängen der Malerei ungewiß. Es leuchtet ihm nicht ein, daß
die Ägypter sie 6000 Jahre, ehe sie in Griechenland geübt worden,
erfunden haben wollten. Die Griechen, sagt er, lassen sie teils
in Sikyon, teils bei den Korinthern entstehen, und zwar überein-
stimmend durch Umreißen des menschlichen Schattens mit Linien.
Das sei die erste Art gewesen. Die mit einfachen Farben
monochromaton, sei auf die mühevollere der Skiagraphie dann
gefolgt. Den Ägypter Philokles oder Kleanthes von Korinth
ferner Aridikes von Korinth und Telephanes von Sikyon nenne
man für den Beginn des linearen Malens; für den des farbigen
und zwar mit geriebenem Ziegel, den Korinther Ekphantos. Dieser
sei aber nicht der Künstler, dessen Flucht mit Demaratus, Vater
des römischen Königs Tarquinius Priseus, Cornelius Nepos be-
richtet; (er sei älter). Unabhängig von diesen Nachrichten ist
die M'tteilung im Verzeichnis der verschiedenen Erfindungen
(7. 205), nie als ersten Maler in Ägypten den Lyder Gyges, in
Griechenland, und nach der Ansicht des Aristoteles, den Eucheir,
einen Verwandten des Dädalos angibt. (Eucheir der im Bilden
mit der Hand Geübte und Eugrammos = der im Zeichnen Ge-
wandte, werden von Plinius (35. 152) nebst Diopos als fictores
bezeichnet, die mit Demavatus aus Korinth vertrieben nach Italien
kamen). Bestimmtes wird dann über des Eumaros von Athen
Fortschritte in dieser einfachen Technik figürlichen Malens ge-
meldet. Denn Plinius gibt (35. 56) als sein Verdienst an, daß er
zuerst Mann und Frau in der Malkunst unterschieden und über-
haupt gewagt habe, jegliche Art von Figuren nachzubilden. Bei
den Vasenmalereien alten Stils, des schwarzfigurigen, der sich
auch im 6. Jahrhundert hielt, dunkle Silhouetten auf den hellen
Tongrund setzend, sind die Frauen durch des bloßen Körpers
Darstellung in Weiß geschieden. Solche erste feinere Durch-
bildung läßt Plinius für Eumaros schließen. Das Nachbilden von
Figuren jeglicher Art bezieht sich kaum auf Handlung und Be-
wegung, rühmt wohl mehr Kennzeichen des Alters und sonstiges
Charakterisieren. Curt von Peter.
JHeuct?{cbetnungcn des BücbetnnarKtes.
Dr. Ernst Zeh, Heimatkunde des bayerischen
Bezirksamtes Reha u. Ein Beitrag zu der deutschen Volks-
kunde. Verlag des Stadtmagistrats Rehau, 1919.
Als erster Band dieser Heimatskunde im gleichen Verlag
besonders erschienen: Geschichte und Kulturgeschichte
der Stadt Rehau. 1916.
Keine deutsche Stadt und keine deutsche Landschaft besitzt
eine solche umfassende, mit solcher Liebe und Sachkenntnis ge-
schriebene Heimatkunde, wie sie das Städtchen Rehau und das
gleichnamige Bezirksamt durch die beiden oben angezeigten
Werke erhalten haben. Wer aber kennt die Stadt und den Bezirk,
die sich dadurch ein immerwährendes Denkmal gesetzt haben?
Das Bezirksamt Rehau liegt im nordöstlichsten Eck von Bayern,
an der sächsisch-böhmischen Grenze, am Nordostabhang des
Fichtelgebirges. Der größte Teil seiner Fläche ist von düsteren
Wäldern bedeckt; wenige Ortschaften nur sind dazwischen zer-
streut, unter ihnen als größte die beiden Städtchen Rehau und
Selb. Der ganze Bezirk war nach der letzten Volkszählung von
30000 Seelen bewohnt. Karg der Boden, rauh das Klima, zäh
der Menschenschlag.
Und diese von der Natur stiefmütterlich behandelte Land-
schaft hat mit der Herausgabe ihrer Heimatskunde das ganze
übrige Deutsche Reich mit seinen vielen unendlich reicheren,
künstlerisch und kulturell weit bedeutenderen Städten und Pro-
vinzen überflügelt und beschämt. Diese Bücher sind ein Kultur-
dokument ersten Ranges; sie hätten aber auch nicht zustande
kommen können, wenn sich nicht ein Verfasser gefunden hätte,
der eine leidenschaftliche Hingabe und Selbstlosigkeit mit um-
fassender Kenntnis des Landes und mit bester historischer Schulung
verbinden konnte. Zeh entstammt einer alten Rehauer Familie
und man liest aus jeder Zeile, wie tief er mit seiner Heimat ver-
wurzelt ist. Die Wirkung, die nach seinem Wunsche von seinen
Büchern ausgehen soll, beschreibt er selbst in der Einleitung
des ersten Bandes so: „Die Heimatkunde soll nicht allein unser
historisches Wissen bereichern; ungleich wertvoller ist ihr End-
zweck, das Heimatgefühl zu erwecken, zu stärken und zu ver-
tiefen, jenes innere seelische Zusammenleben mit einem eng be-
grenzten Stückchen Welt, das bei aller Armut so reich sein kann
an Geschichte und Erlebnissen wie eine vom Blute gefallener
Helden durchtränkte Wahlstatt.“ Und weiter: „Die Heimatkunde
soll aber nicht nur einseitig das Leben der Vorfahren der Nach-
welt überliefern und ihre Schöpfungen vor der Zerstörung be-
hüten, sondern auch die Brücke bauen, die von der Vergangenheit
herüber zur Gegenwart führt, damit sich beide zu einem neuen
harmonischen Ganzen verbinden.“ Aus solchen Erwägungen
heraus steckt der Verfasser sich seine Ziele gewaltig weit, und
es gibt kaum einen Punkt im vergangenen und gegenwärtigen
Leben seiner Heimat, den er nicht in sein Programm aufgenommen
und bis zur Grenze des Möglichen durchleuchtet hätte.
Es ist wahrhaft erstaunlich, wie sich der Verfasser in die
vielen so verschiedenartigen Gebiete seines Werkes eingearbeitet
hat, daß man fast überall die volle Beherrschung der Materie
wohltuend merkt, und wie er dabei die Dinge in klarster An-
schaulichkeit gibt, ohne jede wissenschaftliche Prätension. Viel-
Bokförlags A. B. Patria, Stockholm
kauft
alle Seltenheiten von Interesse für Schweden
Bücher. Kupferstiche, Autographen etc.
Carl Brack & Keller, G. m. b. H., Berlin W. 9
Kleine gewählte Collection alter u. moderner Meister
Ankauf □ Angebote erbeten □ Verkauf
217