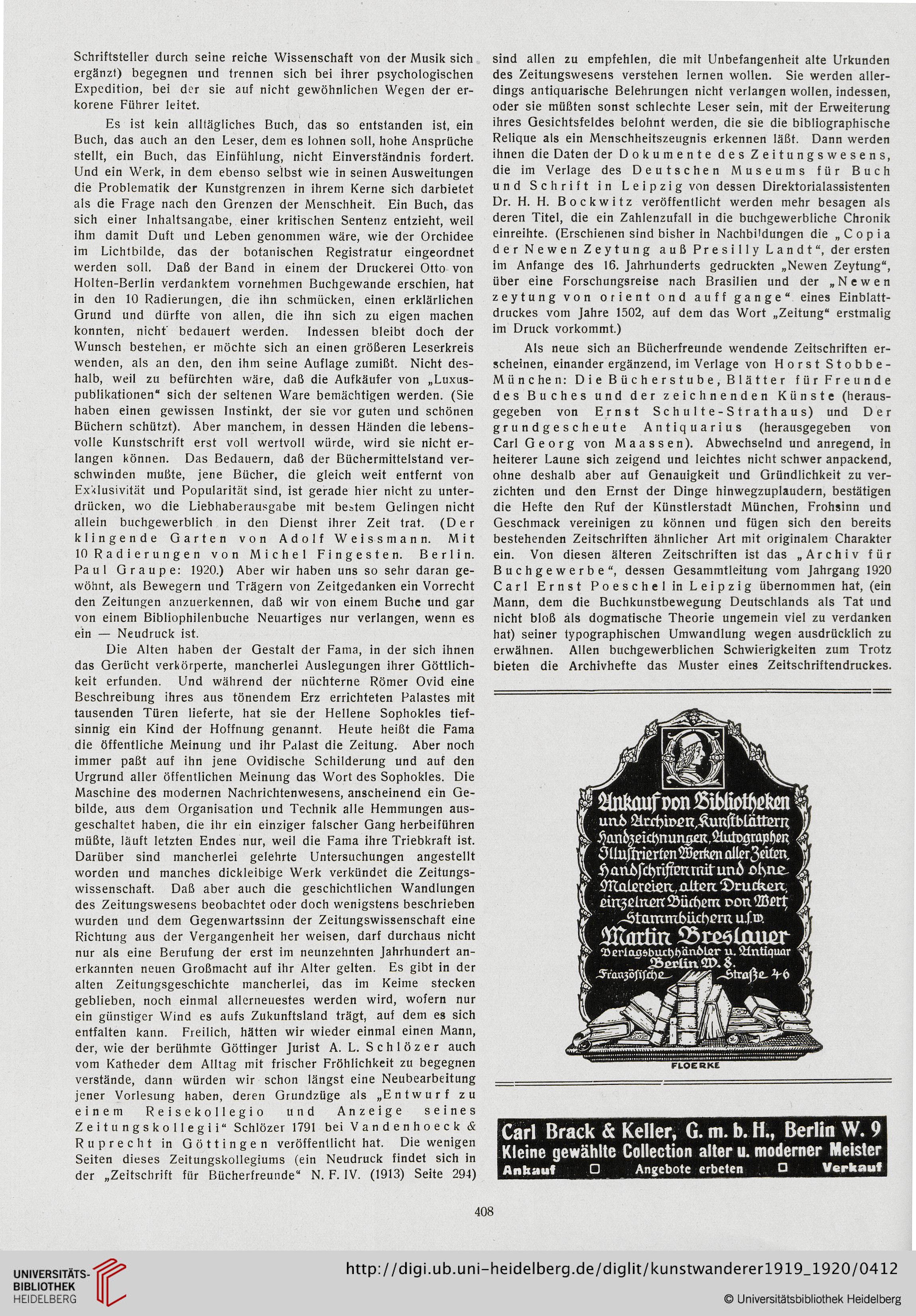Schriftsteller durch seine reiche Wissenschaft von der Musik sich
ergänzt) begegnen und trennen sich bei ihrer psychologischen
Expedition, bei der sie auf nicht gewöhnlichen Wegen der er-
korene Führer leitet.
Es ist kein alltägliches Buch, das so entstanden ist, ein
Buch, das auch an den Leser, dem es lohnen soll, hohe Ansprüche
stellt, ein Buch, das Einfühlung, nicht Einverständnis fordert.
Und ein Werk, in dem ebenso selbst wie in seinen Ausweitungen
die Problematik der Kunstgrenzen in ihrem Kerne sich darbietet
als die Frage nach den Grenzen der Menschheit. Ein Buch, das
sich einer Inhaltsangabe, einer kritischen Sentenz entzieht, weil
ihm damit Duft und Leben genommen wäre, wie der Orchidee
im Lichtbilde, das der botanischen Registratur eingeordnet
werden soll. Daß der Band in einem der Druckerei Otto von
Holten-Berlin verdanktem vornehmen Buchgewande erschien, hat
in den 10 Radierungen, die ihn schmücken, einen erklärlichen
Grund und dürfte von allen, die ihn sich zu eigen machen
konnten, nicht' bedauert werden. Indessen bleibt doch der
Wunsch bestehen, er möchte sich an einen größeren Leserkreis
wenden, als an den, den ihm seine Auflage zumißt. Nicht des-
halb, weil zu befürchten wäre, daß die Aufkäufer von „Luxus-
publikationen“ sich der seltenen Ware bemächtigen werden. (Sie
haben einen gewissen Instinkt, der sie vor guten und schönen
Büchern schützt). Aber manchem, in dessen Händen die lebens-
volle Kunstschrift erst voll wertvoll würde, wird sie nicht er-
langen können. Das Bedauern, daß der Büchermittelstand ver-
schwinden mußte, jene Bücher, die gleich weit entfernt von
Exklusivität und Popularität sind, ist gerade hier nicht zu unter-
drücken, wo die Liebhaberausgabe mit bestem Gelingen nicht
allein buchgewerblich in den Dienst ihrer Zeit trat. (Der
klingende Garten von Adolf Weissmann. Mit
10 R a d i e r u n g e n von Michel Fingesten. Berlin.
Paul Graupe: 1920.) Aber wir haben uns so sehr daran ge-
wöhnt, als Bewegern und Trägern von Zeitgedanken ein Vorrecht
den Zeitungen anzuerkennen, daß wir von einem Buche und gar
von einem Bibliophilenbuche Neuartiges nur verlangen, wenn es
ein — Neudruck ist.
Die Alten haben der Gestalt der Fama, in der sich ihnen
das Gerücht verkörperte, mancherlei Auslegungen ihrer Göttlich-
keit erfunden. Und während der nüchterne Römer Ovid eine
Beschreibung ihres aus tönendem Erz errichteten Palastes mit
tausenden Türen lieferte, hat sie der Hellene Sophokles tief-
sinnig ein Kind der Hoffnung genannt. Heute heißt die Fama
die öffentliche Meinung und ihr Palast die Zeitung. Aber noch
immer paßt auf ihn jene Ovidische Schilderung und auf den
Urgrund aller öffentlichen Meinung das Wort des Sophokles. Die
Maschine des modernen Nachrichtenwesens, anscheinend ein Ge-
bilde, aus dem Organisation und Technik alle Hemmungen aus-
geschaltet haben, die ihr ein einziger falscher Gang herbeiführen
müßte, läuft letzten Endes nur, weil die Fama ihre Triebkraft ist.
Darüber sind mancherlei gelehrte Untersuchungen angestellt
worden und manches dickleibige Werk verkündet die Zeitungs-
wissenschaft. Daß aber auch die geschichtlichen Wandlungen
des Zeitungswesens beobachtet oder doch wenigstens beschrieben
wurden und dem Gegenwartssinn der Zeitungswissenschaft eine
Richtung aus der Vergangenheit her weisen, darf durchaus nicht
nur als eine Berufung der erst im neunzehnten Jahrhundert an-
erkannten neuen Großmacht auf ihr Alter gelten. Es gibt in der
alten Zeitungsgeschichte mancherlei, das im Keime stecken
geblieben, noch einmal allerneuestes werden wird, wofern nur
ein günstiger Wind es aufs Zukunftsland trägt, auf dem es sich
entfalten kann. Freilich, hätten wir wieder einmal einen Mann,
der, wie der berühmte Göttinger Jurist A. L. Schlözer auch
vom Katheder dem Alltag mit frischer Fröhlichkeit zu begegnen
verstände, dann würden wir schon längst eine Neubearbeitung
jener Vorlesung haben, deren Grundzüge als „Entwurf zu
einem R e i s e k o 11 e g i o und Anzeige seines
Zeitungskollegii“ Schlözer 1791 bei Vandenhoeck <&
Ruprecht in Göttingen veröffentlicht hat. Die wenigen
Seiten dieses Zeitungskollegiums (ein Neudruck findet sich in
der „Zeitschrift für Bücherfreunde“ N. F. IV. (1913) Seite 294)
sind allen zu empfehlen, die mit Unbefangenheit alte Urkunden
des Zeitungswesens verstehen lernen wollen. Sie werden aller-
dings antiquarische Belehrungen nicht verlangen wollen, indessen,
oder sie müßten sonst schlechte Leser sein, mit der Erweiterung
ihres Gesichtsfeldes belohnt werden, die sie die bibliographische
Relique als ein Menschheitszeugnis erkennen läßt. Dann werden
ihnen die Daten der Dokumente des Zeitungs wesens,
die im Verlage des Deutschen Museums für Buch
und Schrift in L e i p z i g von dessen Direktorialassistenten
Dr. H. H. Bockwitz veröffentlicht werden mehr besagen als
deren Titel, die ein Zahlenzufall in die buchgewerbliche Chronik
einreihte. (Erschienen sind bisher ln Nachbildungen die „Copia
der Newen Zeytung auß Presilly Landt“, der ersten
im Anfänge des 16. Jahrhunderts gedruckten „Newen Zeytung“,
über eine Forschungsreise nach Brasilien und der „Newen
zeytung von Orient ond auff gange“ eines Einblatt-
druckes vom Jahre 1502, auf dem das Wort „Zeitung“ erstmalig
im Druck vorkommt.)
Als neue sich an Bücherfreunde wendende Zeitschriften er-
scheinen, einander ergänzend, im Verlage von Horst Stobbe-
München: D i e B ü c h e r s t u b e , B 1 ä 11 e r für Freunde
des Buches und der zeichnenden Künste (heraus-
gegeben von Ernst Schulte-Strathaus) und Der
grundgescheute Antiquarius (herausgegeben von
Carl Georg von Maassen). Abwechselnd und anregend, in
heiterer Laune sich zeigend und leichtes nicht schwer anpackend,
ohne deshalb aber auf Genauigkeit und Gründlichkeit zu ver-
zichten und den Ernst der Dinge hinwegzuplaudern, bestätigen
die Hefte den Ruf der Künstlerstadt München, Frohsinn und
Geschmack vereinigen zu können und fügen sich den bereits
bestehenden Zeitschriften ähnlicher Art mit originalem Charakter
ein. Von diesen älteren Zeitschriften ist das „Archiv für
Buchgewerbe“, dessen Gesammtleitung vom Jahrgang 1920
Carl Ernst Poeschel in Leipzig übernommen hat, (ein
Mann, dem die Buchkunstbewegung Deutschlands als Tat und
nicht bloß als dogmatische Theorie ungemein viel zu verdanken
hat) seiner typographischen Umwandlung wegen ausdrücklich zu
erwähnen. Allen buchgewerblichen Schwierigkeiten zum Trotz
bieten die Archivhefte das Muster eines Zeitschriftendruckes.
w Ankauf poniöibüo^kßn Y
| un6 ^LrrbbfiK^unftbüüfißrn, J
ijan6teicf)nun5£R,jKutDgrapf)pn’ M
W <Wtakrcicix, aüca “Dtucktar, f,
Ä ßinjßhtßir Suchern pon.®ert; J
'p -^tammbiicbcra u.f.m
i $tarüit lauer j
‘Set'lacsbutbb'dnölcr u. füntiquar
8
ißcrUn CD- $.
4Fr«i3ÖJif£t)i>^ /M% -Straße, h-b
FLOERKE
Carl Brack & Keller, G. m. b. H., Berlin W. 9
Kleine gewählte Collection alter u. moderner Meister
Anhauf □ Angebote erbeten P Verhau*
408
ergänzt) begegnen und trennen sich bei ihrer psychologischen
Expedition, bei der sie auf nicht gewöhnlichen Wegen der er-
korene Führer leitet.
Es ist kein alltägliches Buch, das so entstanden ist, ein
Buch, das auch an den Leser, dem es lohnen soll, hohe Ansprüche
stellt, ein Buch, das Einfühlung, nicht Einverständnis fordert.
Und ein Werk, in dem ebenso selbst wie in seinen Ausweitungen
die Problematik der Kunstgrenzen in ihrem Kerne sich darbietet
als die Frage nach den Grenzen der Menschheit. Ein Buch, das
sich einer Inhaltsangabe, einer kritischen Sentenz entzieht, weil
ihm damit Duft und Leben genommen wäre, wie der Orchidee
im Lichtbilde, das der botanischen Registratur eingeordnet
werden soll. Daß der Band in einem der Druckerei Otto von
Holten-Berlin verdanktem vornehmen Buchgewande erschien, hat
in den 10 Radierungen, die ihn schmücken, einen erklärlichen
Grund und dürfte von allen, die ihn sich zu eigen machen
konnten, nicht' bedauert werden. Indessen bleibt doch der
Wunsch bestehen, er möchte sich an einen größeren Leserkreis
wenden, als an den, den ihm seine Auflage zumißt. Nicht des-
halb, weil zu befürchten wäre, daß die Aufkäufer von „Luxus-
publikationen“ sich der seltenen Ware bemächtigen werden. (Sie
haben einen gewissen Instinkt, der sie vor guten und schönen
Büchern schützt). Aber manchem, in dessen Händen die lebens-
volle Kunstschrift erst voll wertvoll würde, wird sie nicht er-
langen können. Das Bedauern, daß der Büchermittelstand ver-
schwinden mußte, jene Bücher, die gleich weit entfernt von
Exklusivität und Popularität sind, ist gerade hier nicht zu unter-
drücken, wo die Liebhaberausgabe mit bestem Gelingen nicht
allein buchgewerblich in den Dienst ihrer Zeit trat. (Der
klingende Garten von Adolf Weissmann. Mit
10 R a d i e r u n g e n von Michel Fingesten. Berlin.
Paul Graupe: 1920.) Aber wir haben uns so sehr daran ge-
wöhnt, als Bewegern und Trägern von Zeitgedanken ein Vorrecht
den Zeitungen anzuerkennen, daß wir von einem Buche und gar
von einem Bibliophilenbuche Neuartiges nur verlangen, wenn es
ein — Neudruck ist.
Die Alten haben der Gestalt der Fama, in der sich ihnen
das Gerücht verkörperte, mancherlei Auslegungen ihrer Göttlich-
keit erfunden. Und während der nüchterne Römer Ovid eine
Beschreibung ihres aus tönendem Erz errichteten Palastes mit
tausenden Türen lieferte, hat sie der Hellene Sophokles tief-
sinnig ein Kind der Hoffnung genannt. Heute heißt die Fama
die öffentliche Meinung und ihr Palast die Zeitung. Aber noch
immer paßt auf ihn jene Ovidische Schilderung und auf den
Urgrund aller öffentlichen Meinung das Wort des Sophokles. Die
Maschine des modernen Nachrichtenwesens, anscheinend ein Ge-
bilde, aus dem Organisation und Technik alle Hemmungen aus-
geschaltet haben, die ihr ein einziger falscher Gang herbeiführen
müßte, läuft letzten Endes nur, weil die Fama ihre Triebkraft ist.
Darüber sind mancherlei gelehrte Untersuchungen angestellt
worden und manches dickleibige Werk verkündet die Zeitungs-
wissenschaft. Daß aber auch die geschichtlichen Wandlungen
des Zeitungswesens beobachtet oder doch wenigstens beschrieben
wurden und dem Gegenwartssinn der Zeitungswissenschaft eine
Richtung aus der Vergangenheit her weisen, darf durchaus nicht
nur als eine Berufung der erst im neunzehnten Jahrhundert an-
erkannten neuen Großmacht auf ihr Alter gelten. Es gibt in der
alten Zeitungsgeschichte mancherlei, das im Keime stecken
geblieben, noch einmal allerneuestes werden wird, wofern nur
ein günstiger Wind es aufs Zukunftsland trägt, auf dem es sich
entfalten kann. Freilich, hätten wir wieder einmal einen Mann,
der, wie der berühmte Göttinger Jurist A. L. Schlözer auch
vom Katheder dem Alltag mit frischer Fröhlichkeit zu begegnen
verstände, dann würden wir schon längst eine Neubearbeitung
jener Vorlesung haben, deren Grundzüge als „Entwurf zu
einem R e i s e k o 11 e g i o und Anzeige seines
Zeitungskollegii“ Schlözer 1791 bei Vandenhoeck <&
Ruprecht in Göttingen veröffentlicht hat. Die wenigen
Seiten dieses Zeitungskollegiums (ein Neudruck findet sich in
der „Zeitschrift für Bücherfreunde“ N. F. IV. (1913) Seite 294)
sind allen zu empfehlen, die mit Unbefangenheit alte Urkunden
des Zeitungswesens verstehen lernen wollen. Sie werden aller-
dings antiquarische Belehrungen nicht verlangen wollen, indessen,
oder sie müßten sonst schlechte Leser sein, mit der Erweiterung
ihres Gesichtsfeldes belohnt werden, die sie die bibliographische
Relique als ein Menschheitszeugnis erkennen läßt. Dann werden
ihnen die Daten der Dokumente des Zeitungs wesens,
die im Verlage des Deutschen Museums für Buch
und Schrift in L e i p z i g von dessen Direktorialassistenten
Dr. H. H. Bockwitz veröffentlicht werden mehr besagen als
deren Titel, die ein Zahlenzufall in die buchgewerbliche Chronik
einreihte. (Erschienen sind bisher ln Nachbildungen die „Copia
der Newen Zeytung auß Presilly Landt“, der ersten
im Anfänge des 16. Jahrhunderts gedruckten „Newen Zeytung“,
über eine Forschungsreise nach Brasilien und der „Newen
zeytung von Orient ond auff gange“ eines Einblatt-
druckes vom Jahre 1502, auf dem das Wort „Zeitung“ erstmalig
im Druck vorkommt.)
Als neue sich an Bücherfreunde wendende Zeitschriften er-
scheinen, einander ergänzend, im Verlage von Horst Stobbe-
München: D i e B ü c h e r s t u b e , B 1 ä 11 e r für Freunde
des Buches und der zeichnenden Künste (heraus-
gegeben von Ernst Schulte-Strathaus) und Der
grundgescheute Antiquarius (herausgegeben von
Carl Georg von Maassen). Abwechselnd und anregend, in
heiterer Laune sich zeigend und leichtes nicht schwer anpackend,
ohne deshalb aber auf Genauigkeit und Gründlichkeit zu ver-
zichten und den Ernst der Dinge hinwegzuplaudern, bestätigen
die Hefte den Ruf der Künstlerstadt München, Frohsinn und
Geschmack vereinigen zu können und fügen sich den bereits
bestehenden Zeitschriften ähnlicher Art mit originalem Charakter
ein. Von diesen älteren Zeitschriften ist das „Archiv für
Buchgewerbe“, dessen Gesammtleitung vom Jahrgang 1920
Carl Ernst Poeschel in Leipzig übernommen hat, (ein
Mann, dem die Buchkunstbewegung Deutschlands als Tat und
nicht bloß als dogmatische Theorie ungemein viel zu verdanken
hat) seiner typographischen Umwandlung wegen ausdrücklich zu
erwähnen. Allen buchgewerblichen Schwierigkeiten zum Trotz
bieten die Archivhefte das Muster eines Zeitschriftendruckes.
w Ankauf poniöibüo^kßn Y
| un6 ^LrrbbfiK^unftbüüfißrn, J
ijan6teicf)nun5£R,jKutDgrapf)pn’ M
W <Wtakrcicix, aüca “Dtucktar, f,
Ä ßinjßhtßir Suchern pon.®ert; J
'p -^tammbiicbcra u.f.m
i $tarüit lauer j
‘Set'lacsbutbb'dnölcr u. füntiquar
8
ißcrUn CD- $.
4Fr«i3ÖJif£t)i>^ /M% -Straße, h-b
FLOERKE
Carl Brack & Keller, G. m. b. H., Berlin W. 9
Kleine gewählte Collection alter u. moderner Meister
Anhauf □ Angebote erbeten P Verhau*
408