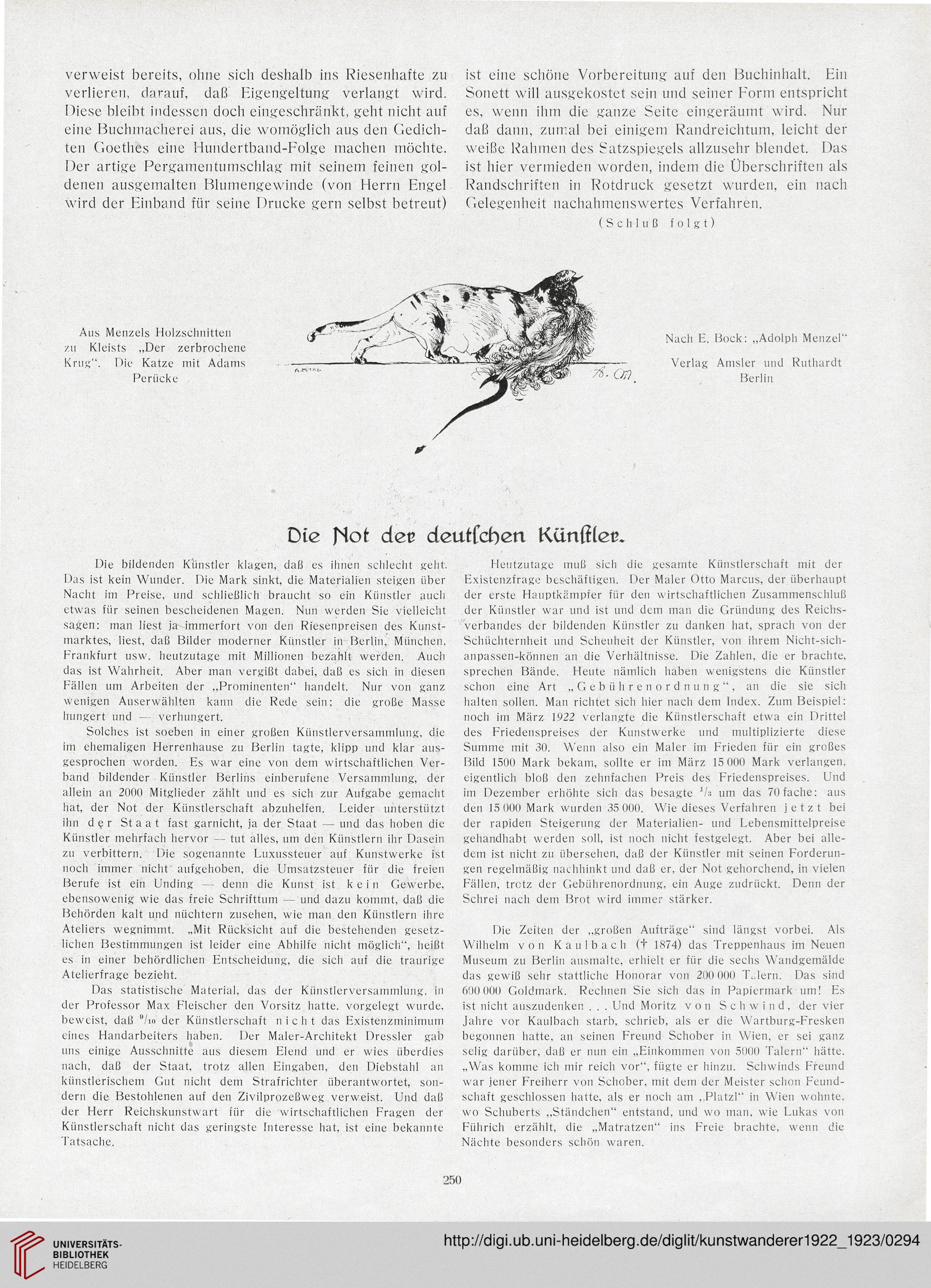verweist bereits, ohne sich deshalb ins Riesenhafte zu
verlieren, darauf, daß Higengeltung verlangt wird.
Diese bleibt indessen doch eingeschränkt, geht nicht auf
eine Buchmacherei aus, die womöglich aus den Gedich-
ten Goethes eine Hundertband-Folge machen möchte.
Der artige Pergamentumschlag mit seinem feinen gol-
denen ausgemalten Blumengewinde (von Herrn Engel
wird der Einband für seine Drucke gern selbst betreut)
ist eine schöne Vorbereitung auf den Buchinhalt. Ein
Sonett will ausgekostet sein und seiner Form entspricht
es, wenn iltm die ganze Seite eingeräumt wird. Nur
daß dann, zumal bei einigem Randreichtum, leicht der
weiße Rahmen des Satzspiegels allzusehr blendet. Das
ist hier vermieden worden, indem die Überschriften als
Randschriften in Rotdruck gesetzt wurden, ein nach
Gelegenheit nachahmenswertes Verfahren.
(S c h1u ß folgt)
Aus Menzels Holzschnitten
zu Kleists „Der zerbrochene
Krug“. Die Katze mit Adams
Pertickc
Nach E. Bock: „Adolph Menzel“
Verlag Amsler und Ruthardt
Berlin
Dte fSot deü deutfcbcn Künßlec.
Die bildenden Kiinstler klagen, daß es itihen schlecht geht.
Das ist kein Wunder. Die Mark sinkt, die Materialien steigen über
Nacht im Preise, und schließlich braucht so ein Künstler auch
etwas für seinen bescheidenen Magen. Nün werden Sie yielleicht
sagen: man liest ia^immerfort von den Riesenpreisen des Kunst-
marktes, liest, daß Bilder moderner Künsüer in Berlin, München,
Frankfurt usw. heutzutage mit Millionen bezahlt werden. Auch
das ist Wahrheit. Aber man vergißt dabei, daß es sicli in diesen
Fällen um Arbeiten der „Prominenten“ handelt. Nur von ganz
wenigen Auserwählten kann die Rede sein: die große Masse
hungert und - verhungert.
Solches ist soeben in einer großen Künstlerversammlung, die
im ehemaligen Herrenhause zu Berlin tagte, klipp und klar aus-
gesprochen worden. Es war eine von dem wirtschaftlichen Ver-
band bildender Künstler Berlins einberufene Versammlung, der
allein an 2000 Mitglieder zählt und es sich zur Aufgabe gemacht
Iiat, der Not der Künstlerschaft abzuhelfen. Leider unterstiitzt
ihn d e r St a a t fast garnicht, ja der Staat — und das hoben die
Kiinstler mehrfach hervor — tut alles, um den Kiinstlern ihr Dasein
zu verbittern. Die sogenannte Luxussteuer auf Kunstwerke ist
noch immer nicht aufgehoben, die Umsatzsteuer für die freien
Berufe ist ein Unding — denn die Kunst ist kein Gewerbe,
ebensowenig wie das freie Schrifttum — und dazu kommt, daß die
Behörden kalt und nüchtern zusehen, wie man den Künstlern ihre
Ateliers wegnimmt. „Mit Riicksicht auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen ist leider eine Abhilfe nicht möglich“, heißt
es in einer behördlichen Entscheidung, die sich auf die traurige
Atelierfrage bezieht.
Das statistische' Material, das der Künstlerversammlung, in
der Professor Max Fleischer den Vorsitz hatte. vorgelegt wurde,
beweist, daß °/io der Künstlerschaft nicht das Existenzminimum
eines Handarbeiters haben. Der Maler-Architekt Dressler gab
uns einige Ausschnitte aus diesem Elend und er wies überdies
nach, daß der Staat, trotz allen Eingaben, den Diebstahl an
künstlerischem Gut nicht dem Strafrichter überantwortet, son-
dern die Bestohlenen auf den Zivilprozeßweg verweist. Und daß
der Herr Reichskunstwart fiir die wirtschaftlichen Fragen der
Künstlerschaft nicht das geringste Interesse hat, ist eine bekannte
Tatsache.
Heutzütage muß sich die gesamte Künstlerschaft mit der
Existenzfrage beschäftigen. Der Maler Otto Marcus, der überhaupt
der erste Hauptkämpfer für den wirtschaftlichen Zusammenschluß
der Künstler war und ist und dem man die Gründung des Reichs-
'verbandes der bildenden Künstler zu danken hat, sprach von der
Schüchternheit und Scheuheit der Künstler, von ihrem Nicht-sich-
anpassen-können an die Verhältnisse. Die Zahlen, die er brachte,
sprechen Bände. Heute nämlich haben wenigstens die Künstler
schon eine Art „Gebührenordnung“, an die sie sich
halten sollen. Man richtet sich hier nach dem Index. Zum Beispiel:
noch im März 1922 verlangte die Künstlerschaft etwa ein Drittel
des Friedenspreises der Kunstwerke und multiplizierte diese
Summe mit 30. Wenn also ein Maler im Frieden für ein großes
Bild 1500 Mark bekam, sollte er im März 15 000 Mark verlangen,
eigentlich bloß den zehnfachen Preis des Friedenspreises. Und
im Dezember erhöhte sich das besagte lk um das 70fache: aus
den 15 000 Mark wurden 35 000. Wie dieses Verfahren jetzt bei
der rapiden Steigerung der Materialien- und Lebensmittelpreise
gehandhabt werden soll, ist noch nicht festgelegt. Aber bei alle-
dem ist nicht zu übersehen, daß der Künstler mit seinen Forderun-
gen regelmäßig nachhinkt und daß er, der Not gehorchend, in vielen
Fällen, trctz der Gebührenordnung, ein Auge zudrückt. Denn der
Schrei nach dem Brot wird immer stärker.
Die Zeiten der „großen Aufträge“ sind längst vorbei. Als
Wilhelm von Käulbach (t 1874) das Treppenhaus im Neuen
Museum zu Berlin ausmalte, erhielt er für die sechs Wandgemälde
das gewiß sehr stattliche Honorar von 200 000 Tulern. Das sind
600 000 Goldmark. Rechnen Sie sich das in Papiermark um! Es
ist nicht auszudenken . . . Und Moritz von Schwind, der vier
Jahre vor Kaulbach starb, schrieb, als er die Wartburg-Fresken
begonnen hatte, an seinen Freund Schober in Wien, er sei ganz
selig dariiber, daß er nun ein „Einkommen von 5000 Talern“ hätte.
„Was komme ich mir reich vor“, fügte er liinzu. Schwinds Freund
war jener Freiherr von Schober, mit dem der Meister schon Feund-
schaft geschlossen liatte, als er noch am „Platzl“ in Wien wohnte,
wo Schuberts „Ständchen“ entstand, und wo man, wie Lukas von
Führich erzählt, die „Matratzen“ ins Freie brachte, wenn die
Nächte besonders schön waren.
250
verlieren, darauf, daß Higengeltung verlangt wird.
Diese bleibt indessen doch eingeschränkt, geht nicht auf
eine Buchmacherei aus, die womöglich aus den Gedich-
ten Goethes eine Hundertband-Folge machen möchte.
Der artige Pergamentumschlag mit seinem feinen gol-
denen ausgemalten Blumengewinde (von Herrn Engel
wird der Einband für seine Drucke gern selbst betreut)
ist eine schöne Vorbereitung auf den Buchinhalt. Ein
Sonett will ausgekostet sein und seiner Form entspricht
es, wenn iltm die ganze Seite eingeräumt wird. Nur
daß dann, zumal bei einigem Randreichtum, leicht der
weiße Rahmen des Satzspiegels allzusehr blendet. Das
ist hier vermieden worden, indem die Überschriften als
Randschriften in Rotdruck gesetzt wurden, ein nach
Gelegenheit nachahmenswertes Verfahren.
(S c h1u ß folgt)
Aus Menzels Holzschnitten
zu Kleists „Der zerbrochene
Krug“. Die Katze mit Adams
Pertickc
Nach E. Bock: „Adolph Menzel“
Verlag Amsler und Ruthardt
Berlin
Dte fSot deü deutfcbcn Künßlec.
Die bildenden Kiinstler klagen, daß es itihen schlecht geht.
Das ist kein Wunder. Die Mark sinkt, die Materialien steigen über
Nacht im Preise, und schließlich braucht so ein Künstler auch
etwas für seinen bescheidenen Magen. Nün werden Sie yielleicht
sagen: man liest ia^immerfort von den Riesenpreisen des Kunst-
marktes, liest, daß Bilder moderner Künsüer in Berlin, München,
Frankfurt usw. heutzutage mit Millionen bezahlt werden. Auch
das ist Wahrheit. Aber man vergißt dabei, daß es sicli in diesen
Fällen um Arbeiten der „Prominenten“ handelt. Nur von ganz
wenigen Auserwählten kann die Rede sein: die große Masse
hungert und - verhungert.
Solches ist soeben in einer großen Künstlerversammlung, die
im ehemaligen Herrenhause zu Berlin tagte, klipp und klar aus-
gesprochen worden. Es war eine von dem wirtschaftlichen Ver-
band bildender Künstler Berlins einberufene Versammlung, der
allein an 2000 Mitglieder zählt und es sich zur Aufgabe gemacht
Iiat, der Not der Künstlerschaft abzuhelfen. Leider unterstiitzt
ihn d e r St a a t fast garnicht, ja der Staat — und das hoben die
Kiinstler mehrfach hervor — tut alles, um den Kiinstlern ihr Dasein
zu verbittern. Die sogenannte Luxussteuer auf Kunstwerke ist
noch immer nicht aufgehoben, die Umsatzsteuer für die freien
Berufe ist ein Unding — denn die Kunst ist kein Gewerbe,
ebensowenig wie das freie Schrifttum — und dazu kommt, daß die
Behörden kalt und nüchtern zusehen, wie man den Künstlern ihre
Ateliers wegnimmt. „Mit Riicksicht auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen ist leider eine Abhilfe nicht möglich“, heißt
es in einer behördlichen Entscheidung, die sich auf die traurige
Atelierfrage bezieht.
Das statistische' Material, das der Künstlerversammlung, in
der Professor Max Fleischer den Vorsitz hatte. vorgelegt wurde,
beweist, daß °/io der Künstlerschaft nicht das Existenzminimum
eines Handarbeiters haben. Der Maler-Architekt Dressler gab
uns einige Ausschnitte aus diesem Elend und er wies überdies
nach, daß der Staat, trotz allen Eingaben, den Diebstahl an
künstlerischem Gut nicht dem Strafrichter überantwortet, son-
dern die Bestohlenen auf den Zivilprozeßweg verweist. Und daß
der Herr Reichskunstwart fiir die wirtschaftlichen Fragen der
Künstlerschaft nicht das geringste Interesse hat, ist eine bekannte
Tatsache.
Heutzütage muß sich die gesamte Künstlerschaft mit der
Existenzfrage beschäftigen. Der Maler Otto Marcus, der überhaupt
der erste Hauptkämpfer für den wirtschaftlichen Zusammenschluß
der Künstler war und ist und dem man die Gründung des Reichs-
'verbandes der bildenden Künstler zu danken hat, sprach von der
Schüchternheit und Scheuheit der Künstler, von ihrem Nicht-sich-
anpassen-können an die Verhältnisse. Die Zahlen, die er brachte,
sprechen Bände. Heute nämlich haben wenigstens die Künstler
schon eine Art „Gebührenordnung“, an die sie sich
halten sollen. Man richtet sich hier nach dem Index. Zum Beispiel:
noch im März 1922 verlangte die Künstlerschaft etwa ein Drittel
des Friedenspreises der Kunstwerke und multiplizierte diese
Summe mit 30. Wenn also ein Maler im Frieden für ein großes
Bild 1500 Mark bekam, sollte er im März 15 000 Mark verlangen,
eigentlich bloß den zehnfachen Preis des Friedenspreises. Und
im Dezember erhöhte sich das besagte lk um das 70fache: aus
den 15 000 Mark wurden 35 000. Wie dieses Verfahren jetzt bei
der rapiden Steigerung der Materialien- und Lebensmittelpreise
gehandhabt werden soll, ist noch nicht festgelegt. Aber bei alle-
dem ist nicht zu übersehen, daß der Künstler mit seinen Forderun-
gen regelmäßig nachhinkt und daß er, der Not gehorchend, in vielen
Fällen, trctz der Gebührenordnung, ein Auge zudrückt. Denn der
Schrei nach dem Brot wird immer stärker.
Die Zeiten der „großen Aufträge“ sind längst vorbei. Als
Wilhelm von Käulbach (t 1874) das Treppenhaus im Neuen
Museum zu Berlin ausmalte, erhielt er für die sechs Wandgemälde
das gewiß sehr stattliche Honorar von 200 000 Tulern. Das sind
600 000 Goldmark. Rechnen Sie sich das in Papiermark um! Es
ist nicht auszudenken . . . Und Moritz von Schwind, der vier
Jahre vor Kaulbach starb, schrieb, als er die Wartburg-Fresken
begonnen hatte, an seinen Freund Schober in Wien, er sei ganz
selig dariiber, daß er nun ein „Einkommen von 5000 Talern“ hätte.
„Was komme ich mir reich vor“, fügte er liinzu. Schwinds Freund
war jener Freiherr von Schober, mit dem der Meister schon Feund-
schaft geschlossen liatte, als er noch am „Platzl“ in Wien wohnte,
wo Schuberts „Ständchen“ entstand, und wo man, wie Lukas von
Führich erzählt, die „Matratzen“ ins Freie brachte, wenn die
Nächte besonders schön waren.
250