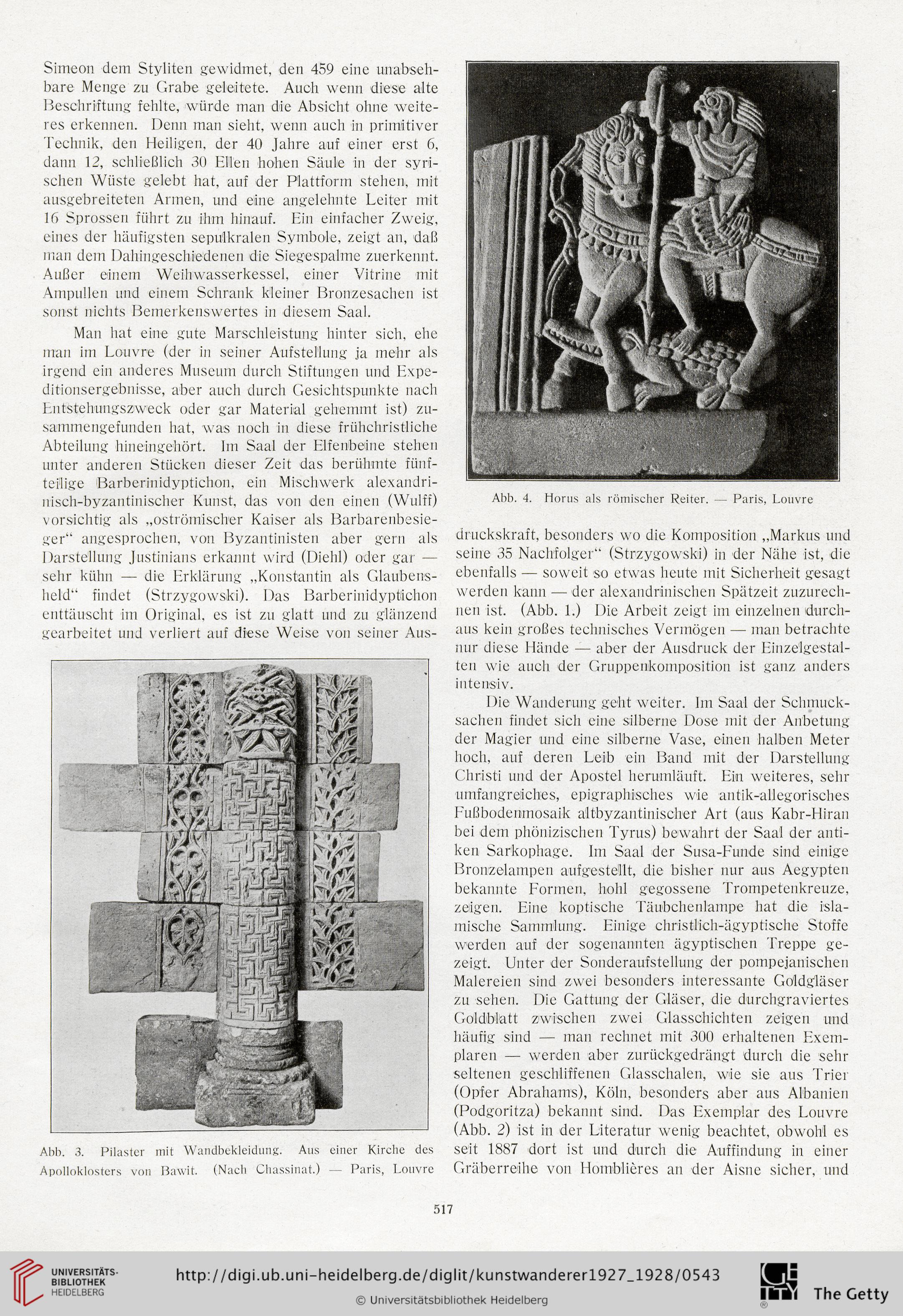Simeon dem Styliten gewidmet, den 459 eine unabseh-
bare Menge zu Grabe geleiitete. Auch wenn diese alte
Beschriftung fehlte, würde man die Absicht ohne weite-
res erkennen. Denn man sieht, wenn auch in primitiver
Technik, den Heiligen, der 40 Jahre auf einer erst 6,
dann 12, schließlich 30 Ell'en hohen Säulie in der syri-
schen Wiiste gelebt hat, auf der P'lattform stehen, mit
ausgebreiteten Armen, und eiine angelehnte Leiter mit
16 Sprossen führt zu ihm hinauf. Ein einfacher Zweig,
eines der häufigsten sepulkralen Symbole, zeigt an, daß
man dem Dahingeschiedenen die Siegespalme zuerkennt.
Außer einem Weibwasserkessel, einer Vitrine mit
Ampullen und einem Schrank Meiner Bronzesachen ist
sonst nichts Bemerkenswertes in diesem Saal.
Man hat eine gute Marschleistung hinter sich, ehe
man im Louvre (der in seiner Aufstellung ja mehr als
irgend ein anderes Museum durch Stiftungen und Expe-
ditionsergebnisse, aber auch durch Gesichtspunkte nach
Lntstehuugszweck oder gar Material gehemmt ist) zu-
sammengefunden hat, was noch in diese frühchristliche
Abteilung hineingehört. Im Saal der Elfenbeine stehen
unter anderen Stücken dieser Zeit das berühmte fünf-
teflige Barberinidyptichon, ein Mischwerk alexandri-
nisch-byzantinischer Kunst, das von den einen (Wulff)
vorsichtig als „oströmischer Kaiser als Barbarenbesie-
ger“ angesprochen, von Byzantinisten aber gern als
Darstellung Justinians erkannt wird (Diehl) oder gar —
sehr kühn — die Erklärung „Konstantin als Glaubens-
held“ findet (Strzygowski). Das Barberinidyptlichon
enttäuscht im Original, es ist zu glatt und zu glänzend
gearbeitet und verliert auf diese Weise von seiner Aus-
Abb. 3. Pilaster mit Wandbekleidung. Aus einer Kirche des
Apolloklosters von Bawit. (Nach Chassinat.) — Paris, Louvre
Abb. 4. Horus als römischer Reiter. — Paris, Louvre
druckskraft, besonders wo die Komposition „Markus und
seine 35 Nachfolger“ (Strzygowski) in der Nähe ist, die
ebenfalls — soweit so etvvas heute mit Sicherheit gesagt
werden kann — der alexaudrinischen Spätzeit zuzurech-
nen ist. (Abb. 1.) Die Arbeit zeigt im einzelnen dureh-
aus kein großes technisches Vermögen — man betrachte
nur diese Hände — aber der Ausdruck der Einzelgestal-
ten wie auch der Gruppenkomposition ist ganz anders
intensiv.
Die Wanderung geht weiter. Im Saal der Schmuck-
sachen findet sich eine siilberne Dose mit der Anbetung
der Magier und eine silberne Vase, einen halben Meter
hoch, auf deren Leib ein Band mit der Darstellung
Christi und der Apostel herumläuft. Ein weiteres, selir
umfangreiches, epigraphisches wie antik-allegorisches
Fußbodenmosaik altbyzantinischef Art (aus Kabr-Hiran
bei dem phönizischen Tyrus) bewahrt der Saal der anti-
ken Sarkophage. Im Saal der Susa-Funde sind einige
Bronzelampen aufgestellt, die bisher nur aus Aegypten
bekannte Formen, hohl gegossene Trompetenkreuze,
zeiigen. Eine koptische Täubchenlampe hat die isla-
mische Sammlung. Einige christlich-ägyptische Stoffe
werden auf der sogenannten ägyptischen Treppe ge-
zeigt. Unter der Sonderaufstellung der pompejanischen
Malereien sind zwei besonders interessante Goldgläser
zu sehen. Die Gattung der Gläser, die durchgraviertes
Goldblätt zwischen zwei Glasschichten zeigen und
häufig sind — man rechnet mit 300 erhaltenen Exem-
plaren — werden aber zurückgedrängt durch die sehr
seltenen geschliffenen Glasschalen, wie sie aus Triei’
(Opfer Abrahams), Köln, besonders aber aus Albanien
(Podgoritza) bekannt sind. Das Exemplar des Louvre
(Abb. 2) ist in der Literatur wenig beachtet, obwohl es
seit 1887 dort ist und durch die Auffindung in einer
Gräberreihe von Homblieres an der Aisne sicher, und
517
bare Menge zu Grabe geleiitete. Auch wenn diese alte
Beschriftung fehlte, würde man die Absicht ohne weite-
res erkennen. Denn man sieht, wenn auch in primitiver
Technik, den Heiligen, der 40 Jahre auf einer erst 6,
dann 12, schließlich 30 Ell'en hohen Säulie in der syri-
schen Wiiste gelebt hat, auf der P'lattform stehen, mit
ausgebreiteten Armen, und eiine angelehnte Leiter mit
16 Sprossen führt zu ihm hinauf. Ein einfacher Zweig,
eines der häufigsten sepulkralen Symbole, zeigt an, daß
man dem Dahingeschiedenen die Siegespalme zuerkennt.
Außer einem Weibwasserkessel, einer Vitrine mit
Ampullen und einem Schrank Meiner Bronzesachen ist
sonst nichts Bemerkenswertes in diesem Saal.
Man hat eine gute Marschleistung hinter sich, ehe
man im Louvre (der in seiner Aufstellung ja mehr als
irgend ein anderes Museum durch Stiftungen und Expe-
ditionsergebnisse, aber auch durch Gesichtspunkte nach
Lntstehuugszweck oder gar Material gehemmt ist) zu-
sammengefunden hat, was noch in diese frühchristliche
Abteilung hineingehört. Im Saal der Elfenbeine stehen
unter anderen Stücken dieser Zeit das berühmte fünf-
teflige Barberinidyptichon, ein Mischwerk alexandri-
nisch-byzantinischer Kunst, das von den einen (Wulff)
vorsichtig als „oströmischer Kaiser als Barbarenbesie-
ger“ angesprochen, von Byzantinisten aber gern als
Darstellung Justinians erkannt wird (Diehl) oder gar —
sehr kühn — die Erklärung „Konstantin als Glaubens-
held“ findet (Strzygowski). Das Barberinidyptlichon
enttäuscht im Original, es ist zu glatt und zu glänzend
gearbeitet und verliert auf diese Weise von seiner Aus-
Abb. 3. Pilaster mit Wandbekleidung. Aus einer Kirche des
Apolloklosters von Bawit. (Nach Chassinat.) — Paris, Louvre
Abb. 4. Horus als römischer Reiter. — Paris, Louvre
druckskraft, besonders wo die Komposition „Markus und
seine 35 Nachfolger“ (Strzygowski) in der Nähe ist, die
ebenfalls — soweit so etvvas heute mit Sicherheit gesagt
werden kann — der alexaudrinischen Spätzeit zuzurech-
nen ist. (Abb. 1.) Die Arbeit zeigt im einzelnen dureh-
aus kein großes technisches Vermögen — man betrachte
nur diese Hände — aber der Ausdruck der Einzelgestal-
ten wie auch der Gruppenkomposition ist ganz anders
intensiv.
Die Wanderung geht weiter. Im Saal der Schmuck-
sachen findet sich eine siilberne Dose mit der Anbetung
der Magier und eine silberne Vase, einen halben Meter
hoch, auf deren Leib ein Band mit der Darstellung
Christi und der Apostel herumläuft. Ein weiteres, selir
umfangreiches, epigraphisches wie antik-allegorisches
Fußbodenmosaik altbyzantinischef Art (aus Kabr-Hiran
bei dem phönizischen Tyrus) bewahrt der Saal der anti-
ken Sarkophage. Im Saal der Susa-Funde sind einige
Bronzelampen aufgestellt, die bisher nur aus Aegypten
bekannte Formen, hohl gegossene Trompetenkreuze,
zeiigen. Eine koptische Täubchenlampe hat die isla-
mische Sammlung. Einige christlich-ägyptische Stoffe
werden auf der sogenannten ägyptischen Treppe ge-
zeigt. Unter der Sonderaufstellung der pompejanischen
Malereien sind zwei besonders interessante Goldgläser
zu sehen. Die Gattung der Gläser, die durchgraviertes
Goldblätt zwischen zwei Glasschichten zeigen und
häufig sind — man rechnet mit 300 erhaltenen Exem-
plaren — werden aber zurückgedrängt durch die sehr
seltenen geschliffenen Glasschalen, wie sie aus Triei’
(Opfer Abrahams), Köln, besonders aber aus Albanien
(Podgoritza) bekannt sind. Das Exemplar des Louvre
(Abb. 2) ist in der Literatur wenig beachtet, obwohl es
seit 1887 dort ist und durch die Auffindung in einer
Gräberreihe von Homblieres an der Aisne sicher, und
517