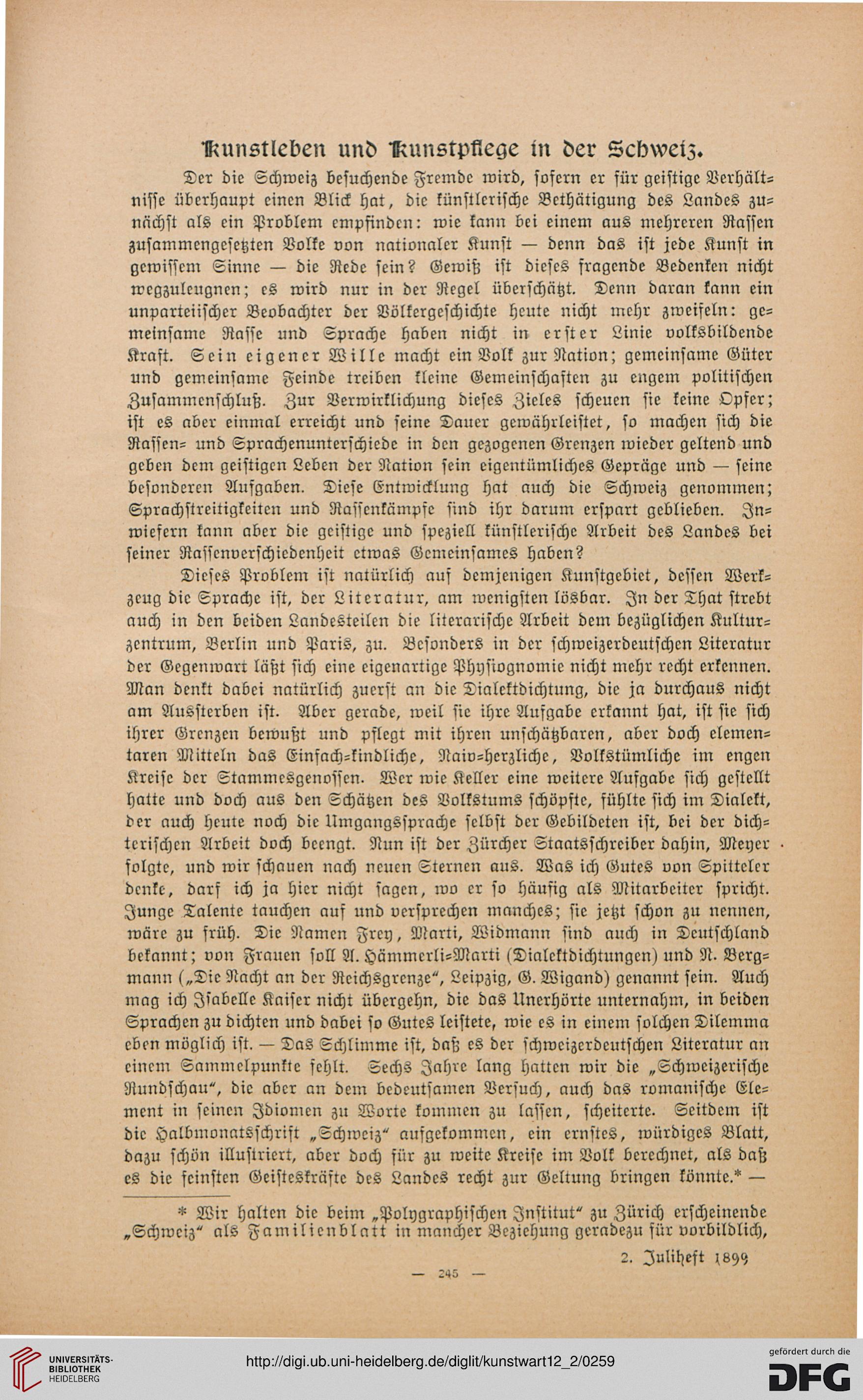Ikunslleben und Ikunslpüege in der Scbweiz.
Der die Schweiz besuchende Fremdc wird, sofern er für geistige Verhält-
nisse überhaupt eincn Blick hat, dic künstlerische Bethätigung des Landes zu-
nnchst als ein Problem cmpfinden: wie kann bei einem aus mehrcren Rassen
zusammengesetzten Volke von nationaler Kunst — denn das ist jede Kunst in
gcwisscm Sinno — die Rede sein? Gewitz ist dieses fragcnde Bedenken nicht
wegzuleugnen; cs wird nur in der Regel überschätzt. Denn daran kann cin
unparteiischer Beobachtcr der Völkergeschichte heute nicht mehr zweifeln: ge-
meinsame Rasse und Sprache haben nicht in erster Linie volksbildende
Krast. Sein cigener Wille macht ein Volk zur Nation; gemeinsame Güter
und gemeinsame Feinde treiben kleine Gemeinschaften zu engem politischon
Zusammenschlutz. Zur Verwirklichung dieses Zieles scheuen sie keine Opfer;
ist es aber einmal erreicht und seine Dauer gewährleistet, so machen sich die
Rassen- und Sprachenunlerschiede in den gezogenen Grenzen wieder geltend und
gcben dem geistigcn Leben der Nation sein eigentümliches Geprägc und — seine
besondercn Aufgabcn. Diese Entwicklung hat auch die Schweiz genommen;
Sprachstreitigkeircn und Rasscnkämpsc sind ihr darum erspart gcblieben. Jn-
wiefcrn kann aber die gcistige und speziell künstlerischc Arbeit des Landes bei
seiner Rasscnverschiedenheit ctwas Gcmeinsames haben?
Dicses Problem ist natürlich aus demjenigen Kunstgebiet, desscn Werk-
zcug dic Sprache ist, der Literatur, am wcnigsten lösbar. Jn der That strcbt
auch in den beiden Landesteilen die literarische Arbeit dem bezüglichen Kultur-
zcntrum, Berlin und Paris, zu. Bcsonders in der schweizerdeutschen Literatur
der Gegenwart lätzt sich eine eigenartige Physiognomie nicht mehr recht erkcnnen.
Man denkt dabei natürlich zucrst an die Dialcktdichtung, die ja durchaus nicht
am Aussterben ist. Abcr gerade, weil sie ihre Ausgabe erkannt hat, ist sie sich
ihrer Grcnzen bewutzt und pslegt mit ihren unschätzbaren, aber doch elemen-
taren Mitteln das Einfach-kindliche, Naiv-Hcrzliche, Volkstümliche im engen
Kreisc dcr Stammesgenossen. Wer wie Keller eine weitere Ausgabe sich gestellt
hatte und doch aus den Schätzen des Volkstums schöpfte, sühlte sich im Dialekt,
dcr auch heute noch die Umgangssprache selbst der Gebildetcn ist, bei der dich-
terischen Arbeit doch beengt. Nun ist der Zürcher Staatsschreiber dahin, Meyer
solgte, und wir schauen nach neuen Sternen aus. Was ich Gutes von Spittcler
dcnke, darf ich ja hier nicht sagcn, wo cr so häufig als Mitarbciter spricht.
Junge Talente tauchen auf und versprechen manches; sie jetzt schon zu nennen,
wäre zu früh. Die Namcn Frey, Marli, Widmann sind auch in Deutschland
bekannt; von Frauen soll A. Hämmerli-Marti (Dialcktdichtungen) und N- Berg-
mann („Die Nacht an der Rcichsgrenze", Leipzig, G. Wigand) genannt sein. Auch
mag ich Jiabelle Kaiser nicht übergehn, die das Unerhörte unternahm, in beiden
Sprachen zu dichten und dabei so Gutes leistete, wie es in einem solchen Dilemma
eben möglich ist. — Das Schlimme ist, datz es der schweizerdcutschen Literatur an
cincm Sammclpunkic sehlt. Sechs Jahre lang hattcn wir die „Schweizerische
Nundschau", die abcr an dem bedeutsamen Versuch, auch das romanische Ele-
ment in seinen Jdionren zu Worte kommen zu lassen, schciterte. Seitdem ist
die HalbmonatSschrift „Schwciz" ausgekommen, ein ernstes, würdiges Blatt,
dazu schön illustriert, aber doch sür zu weite Krcise im Volk berechnet, als datz
cs dic feinsten Geisteskräfte des Landes recht zur Geltung bringen könnte.* —
* Wir halten die beim „Polygraphischen Jnstitut" zu Zürich erscheinende
„Schwciz" als Familicnblatt in mancher Bcziehung gerndezu für vorbildlich,
2. Iuliheft z8Y9
Der die Schweiz besuchende Fremdc wird, sofern er für geistige Verhält-
nisse überhaupt eincn Blick hat, dic künstlerische Bethätigung des Landes zu-
nnchst als ein Problem cmpfinden: wie kann bei einem aus mehrcren Rassen
zusammengesetzten Volke von nationaler Kunst — denn das ist jede Kunst in
gcwisscm Sinno — die Rede sein? Gewitz ist dieses fragcnde Bedenken nicht
wegzuleugnen; cs wird nur in der Regel überschätzt. Denn daran kann cin
unparteiischer Beobachtcr der Völkergeschichte heute nicht mehr zweifeln: ge-
meinsame Rasse und Sprache haben nicht in erster Linie volksbildende
Krast. Sein cigener Wille macht ein Volk zur Nation; gemeinsame Güter
und gemeinsame Feinde treiben kleine Gemeinschaften zu engem politischon
Zusammenschlutz. Zur Verwirklichung dieses Zieles scheuen sie keine Opfer;
ist es aber einmal erreicht und seine Dauer gewährleistet, so machen sich die
Rassen- und Sprachenunlerschiede in den gezogenen Grenzen wieder geltend und
gcben dem geistigcn Leben der Nation sein eigentümliches Geprägc und — seine
besondercn Aufgabcn. Diese Entwicklung hat auch die Schweiz genommen;
Sprachstreitigkeircn und Rasscnkämpsc sind ihr darum erspart gcblieben. Jn-
wiefcrn kann aber die gcistige und speziell künstlerischc Arbeit des Landes bei
seiner Rasscnverschiedenheit ctwas Gcmeinsames haben?
Dicses Problem ist natürlich aus demjenigen Kunstgebiet, desscn Werk-
zcug dic Sprache ist, der Literatur, am wcnigsten lösbar. Jn der That strcbt
auch in den beiden Landesteilen die literarische Arbeit dem bezüglichen Kultur-
zcntrum, Berlin und Paris, zu. Bcsonders in der schweizerdeutschen Literatur
der Gegenwart lätzt sich eine eigenartige Physiognomie nicht mehr recht erkcnnen.
Man denkt dabei natürlich zucrst an die Dialcktdichtung, die ja durchaus nicht
am Aussterben ist. Abcr gerade, weil sie ihre Ausgabe erkannt hat, ist sie sich
ihrer Grcnzen bewutzt und pslegt mit ihren unschätzbaren, aber doch elemen-
taren Mitteln das Einfach-kindliche, Naiv-Hcrzliche, Volkstümliche im engen
Kreisc dcr Stammesgenossen. Wer wie Keller eine weitere Ausgabe sich gestellt
hatte und doch aus den Schätzen des Volkstums schöpfte, sühlte sich im Dialekt,
dcr auch heute noch die Umgangssprache selbst der Gebildetcn ist, bei der dich-
terischen Arbeit doch beengt. Nun ist der Zürcher Staatsschreiber dahin, Meyer
solgte, und wir schauen nach neuen Sternen aus. Was ich Gutes von Spittcler
dcnke, darf ich ja hier nicht sagcn, wo cr so häufig als Mitarbciter spricht.
Junge Talente tauchen auf und versprechen manches; sie jetzt schon zu nennen,
wäre zu früh. Die Namcn Frey, Marli, Widmann sind auch in Deutschland
bekannt; von Frauen soll A. Hämmerli-Marti (Dialcktdichtungen) und N- Berg-
mann („Die Nacht an der Rcichsgrenze", Leipzig, G. Wigand) genannt sein. Auch
mag ich Jiabelle Kaiser nicht übergehn, die das Unerhörte unternahm, in beiden
Sprachen zu dichten und dabei so Gutes leistete, wie es in einem solchen Dilemma
eben möglich ist. — Das Schlimme ist, datz es der schweizerdcutschen Literatur an
cincm Sammclpunkic sehlt. Sechs Jahre lang hattcn wir die „Schweizerische
Nundschau", die abcr an dem bedeutsamen Versuch, auch das romanische Ele-
ment in seinen Jdionren zu Worte kommen zu lassen, schciterte. Seitdem ist
die HalbmonatSschrift „Schwciz" ausgekommen, ein ernstes, würdiges Blatt,
dazu schön illustriert, aber doch sür zu weite Krcise im Volk berechnet, als datz
cs dic feinsten Geisteskräfte des Landes recht zur Geltung bringen könnte.* —
* Wir halten die beim „Polygraphischen Jnstitut" zu Zürich erscheinende
„Schwciz" als Familicnblatt in mancher Bcziehung gerndezu für vorbildlich,
2. Iuliheft z8Y9