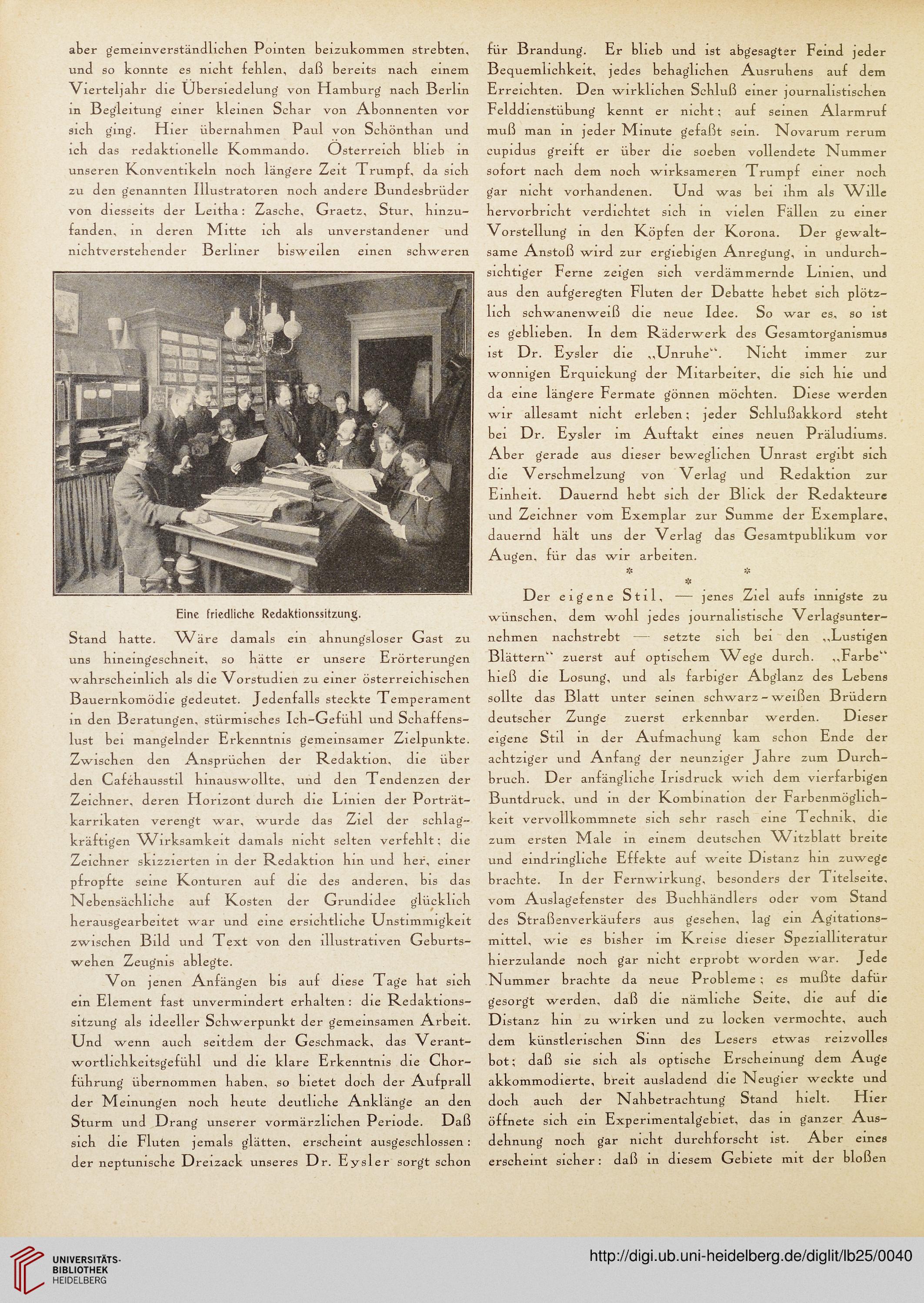aber gemeinverständlichen Pointen beizukommen strebten,
und so konnte es nicht fehlen, daß bereits nach einem
Vierteljahr die Übersiedelung von Hamburg nach Berlin
in Begleitung einer kleinen Schar von Abonnenten vor
sich ging. Hier übernahmen Paul von Schönthan und
ich das redaktionelle Kommando. Österreich blieb m
unseren Konventikeln noch längere Zeit Trumpf, da sich
zu den genannten Illustratoren noch andere Bundesbrüder
von diesseits der Leitha: Zasche, Graetz, Stur, hinzu-
fanden, m deren Mitte ich als unverstandener und
nichtverstehender Berliner bisweilen einen schweren
Eine friedliche Redaktionssitzung.
Stand hatte. Wäre damals ein ahnungsloser Gast zu
uns hmemgeschneit, so hätte er unsere Erörterungen
wahrscheinlich als die Vorstudien zu einer österreichischen
Bauernkomödie gedeutet. Jedenfalls steckte Temperament
in den Beratungen, stürmisches Ich-Gefühl und Schaffens-
lust bei mangelnder Erkenntnis gemeinsamer Zielpunkte.
Zwischen den Ansprüchen der Redaktion, die über
den Cafehausstil hinauswollte, und den Tendenzen der
Zeichner, deren Horizont durch die Limen der Porträt-
karnkaten verengt war, wurde das Ziel der schlag-
kräftigen Wirksamkeit damals nicht selten verfehlt; die
Zeichner skizzierten in der Redaktion hin und her, einer
pfropfte seine Konturen auf die des anderen, bis das
Nebensächliche auf Kosten der Grundidee glücklich
herausgearbeitet war und eine ersichtliche Unstimmigkeit
zwischen Bild und Text von den illustrativen Geburts-
wehen Zeugnis ablegte.
Von jenen Anfängen bis auf diese Tage hat sich
em Element fast unvermindert erhalten : die Redaktions-
sitzung als ideeller Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit.
Und wenn auch seitdem der Geschmack, das Verant-
wortlichkeitsgefühl und die klare Erkenntnis die Chor-
führung übernommen hab en, so bietet doch der Aufprall
der Meinungen noch heute deutliche Anklänge an den
Sturm und Dr ang unserer vormärzlichen Periode. Daß
sich die Fluten jemals glätten, erscheint ausgeschlossen :
der neptunische Dreizack unseres Dr. Eysler sorgt schon
für Brandung. Er blieb und ist abgesagter Feind jeder
Bequemlichkeit, jedes behaglichen Ausruhens auf dem
Erreichten. Den wirklichen Schluß einer journalistischen
Felddienstübung kennt er nicht; auf seinen Alarmruf
muß man m jeder Minute gefaßt sein. Novarum rerum
cupidus greift er über die soeben vollendete Nummer
sofort nach dem noch wirksameren Trumpf einer noch
gar nicht vorhandenen. Und was bei ihm als Wille
hervorbricht verdichtet sich m vielen Fällen zu einer
Vorstellung m den Köpfen der Korona. Der gewalt-
same Anstoß wird zur ergiebigen Anregung, in undurch-
sichtiger Ferne zeigen sich verdämmernde Linien, und
aus den aufgeregten Fluten der Debatte hebet sich plötz-
lich schwanenweiß die neue Idee. So war es, so ist
es geblieben. In dem Räderwerk des Gesamtorganismus
ist Dr. Eysl er die „Unruhe“. Nicht immer zur
wonnigen Erquickung der Mitarbeiter, die sich hie und
da eine längere Fermate gönnen möchten. Diese werden
wir allesamt nicht erleben; jeder Schlußakkord steht
bei Dr. Eysl er im Auftakt eines neuen Präludiums.
Aber gerade aus dieser beweglichen Unrast ergibt sich
die Verschmelzung von Verlag und Redaktion zur
Einheit. Dauernd hebt sich der Blick der Redakteure
und Zeichner vom Exemplar zur Summe der Exemplare,
dauernd hält uns der Verlag das Gesamtpublikum vor
Augen, für das wir arbeiten.
❖ ❖
❖
Der eigene Stil , - jenes Ziel aufs innigste zu
wünschen, dem wohl jedes journalistische Verlagsunter-
nehmen nachstrebt — setzte sich bei den „Lustigen
Blättern“ zuerst auf optischem Wege durch. „Farbe“
hieß die Losung, und als farbiger Abgl anz des Lebens
sollte das Blatt unter seinen schwarz - weißen Brüdern
deutscher Zunge zuerst erkennbar werden. Dieser
eigene Stil in der Aufmachung kam schon Ende der
achtziger und Anfang der neunziger Jahre zum Durch-
bruch. Der anfängliche Insdruck wich dem vierfarbigen
Buntdruck, und m der Kombination der Farbenmöglich-
keit vervollkommnete sich sehr rasch eine Technik, die
zum ersten Male m einem deutschen Witzblatt breite
und eindringliche Effekte auf weite Distanz hm zuwege
brachte. In der Fernwirkung, besonders der Titelseite,
vom Auslagefenster des Buchhändlers oder vom Stand
des Straßenverkäufers aus gesehen, lag ein Agitations-
mittel, wie es bisher im Kreise dieser Spezialliteratur
hierzulande noch gar nicht erprobt worden war. Jede
Nummer brachte da neue Probleme ; es mußte dafür
gesorgt werden, daß die nämliche Seite, die auf die
Distanz hm zu wirken und zu locken vermochte, auch
dem künstlerischen Sinn des Lesers etwas reizvolles
bot; daß sie sich als optische Erscheinung dem Auge
akkommodierte, breit ausladend die Neugier weckte und
doch auch der Nahbetrachtung Stand hielt. Hier
öffnete sich em Experimentalgebiet, das m ganzer Aus-
dehnung noch gar nicht durchforscht ist. Aber eines
erscheint sicher: daß m diesem Gebiete mit der bloßen
und so konnte es nicht fehlen, daß bereits nach einem
Vierteljahr die Übersiedelung von Hamburg nach Berlin
in Begleitung einer kleinen Schar von Abonnenten vor
sich ging. Hier übernahmen Paul von Schönthan und
ich das redaktionelle Kommando. Österreich blieb m
unseren Konventikeln noch längere Zeit Trumpf, da sich
zu den genannten Illustratoren noch andere Bundesbrüder
von diesseits der Leitha: Zasche, Graetz, Stur, hinzu-
fanden, m deren Mitte ich als unverstandener und
nichtverstehender Berliner bisweilen einen schweren
Eine friedliche Redaktionssitzung.
Stand hatte. Wäre damals ein ahnungsloser Gast zu
uns hmemgeschneit, so hätte er unsere Erörterungen
wahrscheinlich als die Vorstudien zu einer österreichischen
Bauernkomödie gedeutet. Jedenfalls steckte Temperament
in den Beratungen, stürmisches Ich-Gefühl und Schaffens-
lust bei mangelnder Erkenntnis gemeinsamer Zielpunkte.
Zwischen den Ansprüchen der Redaktion, die über
den Cafehausstil hinauswollte, und den Tendenzen der
Zeichner, deren Horizont durch die Limen der Porträt-
karnkaten verengt war, wurde das Ziel der schlag-
kräftigen Wirksamkeit damals nicht selten verfehlt; die
Zeichner skizzierten in der Redaktion hin und her, einer
pfropfte seine Konturen auf die des anderen, bis das
Nebensächliche auf Kosten der Grundidee glücklich
herausgearbeitet war und eine ersichtliche Unstimmigkeit
zwischen Bild und Text von den illustrativen Geburts-
wehen Zeugnis ablegte.
Von jenen Anfängen bis auf diese Tage hat sich
em Element fast unvermindert erhalten : die Redaktions-
sitzung als ideeller Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit.
Und wenn auch seitdem der Geschmack, das Verant-
wortlichkeitsgefühl und die klare Erkenntnis die Chor-
führung übernommen hab en, so bietet doch der Aufprall
der Meinungen noch heute deutliche Anklänge an den
Sturm und Dr ang unserer vormärzlichen Periode. Daß
sich die Fluten jemals glätten, erscheint ausgeschlossen :
der neptunische Dreizack unseres Dr. Eysler sorgt schon
für Brandung. Er blieb und ist abgesagter Feind jeder
Bequemlichkeit, jedes behaglichen Ausruhens auf dem
Erreichten. Den wirklichen Schluß einer journalistischen
Felddienstübung kennt er nicht; auf seinen Alarmruf
muß man m jeder Minute gefaßt sein. Novarum rerum
cupidus greift er über die soeben vollendete Nummer
sofort nach dem noch wirksameren Trumpf einer noch
gar nicht vorhandenen. Und was bei ihm als Wille
hervorbricht verdichtet sich m vielen Fällen zu einer
Vorstellung m den Köpfen der Korona. Der gewalt-
same Anstoß wird zur ergiebigen Anregung, in undurch-
sichtiger Ferne zeigen sich verdämmernde Linien, und
aus den aufgeregten Fluten der Debatte hebet sich plötz-
lich schwanenweiß die neue Idee. So war es, so ist
es geblieben. In dem Räderwerk des Gesamtorganismus
ist Dr. Eysl er die „Unruhe“. Nicht immer zur
wonnigen Erquickung der Mitarbeiter, die sich hie und
da eine längere Fermate gönnen möchten. Diese werden
wir allesamt nicht erleben; jeder Schlußakkord steht
bei Dr. Eysl er im Auftakt eines neuen Präludiums.
Aber gerade aus dieser beweglichen Unrast ergibt sich
die Verschmelzung von Verlag und Redaktion zur
Einheit. Dauernd hebt sich der Blick der Redakteure
und Zeichner vom Exemplar zur Summe der Exemplare,
dauernd hält uns der Verlag das Gesamtpublikum vor
Augen, für das wir arbeiten.
❖ ❖
❖
Der eigene Stil , - jenes Ziel aufs innigste zu
wünschen, dem wohl jedes journalistische Verlagsunter-
nehmen nachstrebt — setzte sich bei den „Lustigen
Blättern“ zuerst auf optischem Wege durch. „Farbe“
hieß die Losung, und als farbiger Abgl anz des Lebens
sollte das Blatt unter seinen schwarz - weißen Brüdern
deutscher Zunge zuerst erkennbar werden. Dieser
eigene Stil in der Aufmachung kam schon Ende der
achtziger und Anfang der neunziger Jahre zum Durch-
bruch. Der anfängliche Insdruck wich dem vierfarbigen
Buntdruck, und m der Kombination der Farbenmöglich-
keit vervollkommnete sich sehr rasch eine Technik, die
zum ersten Male m einem deutschen Witzblatt breite
und eindringliche Effekte auf weite Distanz hm zuwege
brachte. In der Fernwirkung, besonders der Titelseite,
vom Auslagefenster des Buchhändlers oder vom Stand
des Straßenverkäufers aus gesehen, lag ein Agitations-
mittel, wie es bisher im Kreise dieser Spezialliteratur
hierzulande noch gar nicht erprobt worden war. Jede
Nummer brachte da neue Probleme ; es mußte dafür
gesorgt werden, daß die nämliche Seite, die auf die
Distanz hm zu wirken und zu locken vermochte, auch
dem künstlerischen Sinn des Lesers etwas reizvolles
bot; daß sie sich als optische Erscheinung dem Auge
akkommodierte, breit ausladend die Neugier weckte und
doch auch der Nahbetrachtung Stand hielt. Hier
öffnete sich em Experimentalgebiet, das m ganzer Aus-
dehnung noch gar nicht durchforscht ist. Aber eines
erscheint sicher: daß m diesem Gebiete mit der bloßen