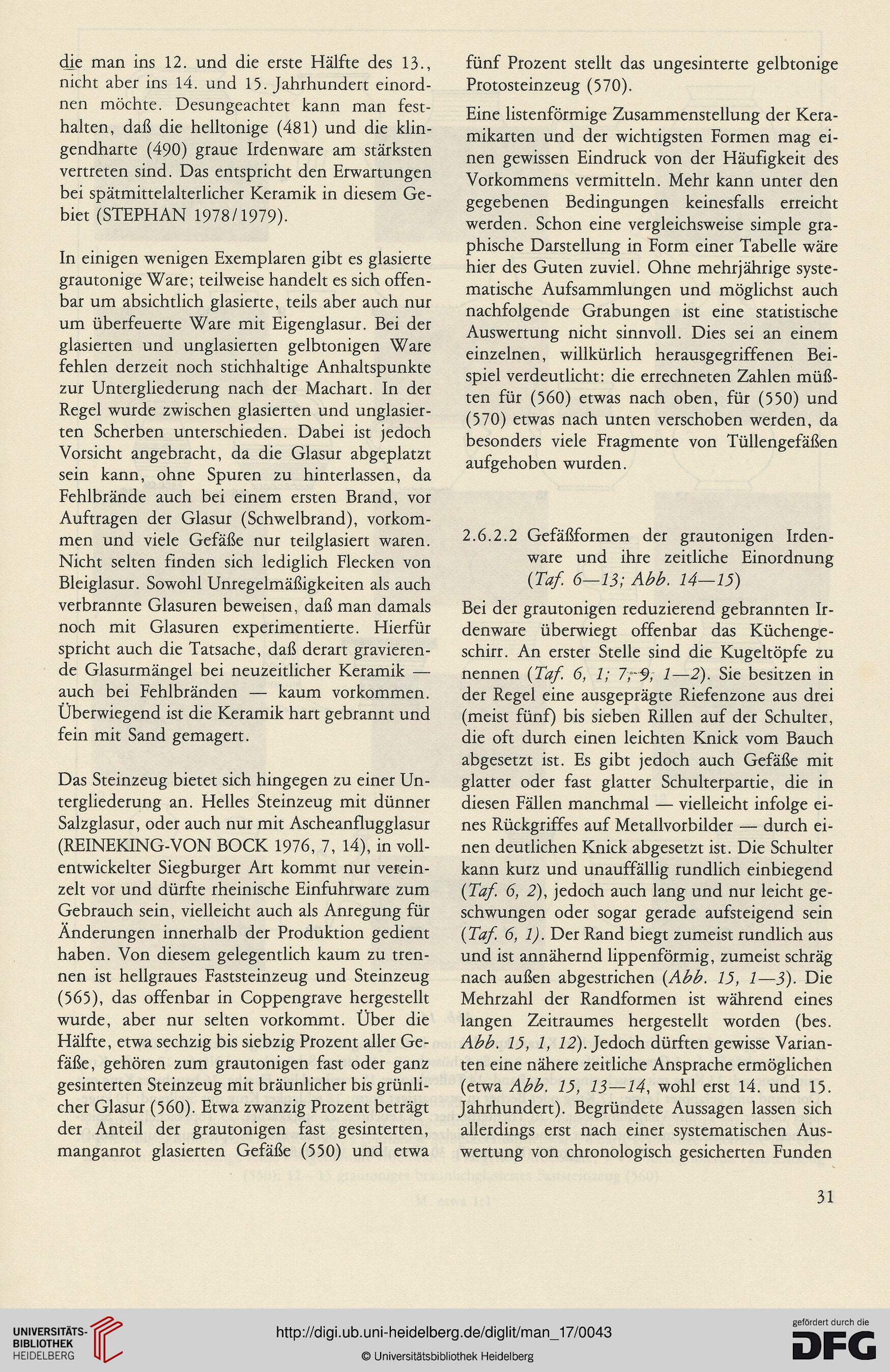die man ins 12. und die erste Hälfte des 13.,
nicht aber ins 14. und 15. Jahrhundert einord-
nen möchte. Desungeachtet kann man fest-
halten, daß die helltonige (481) und die klin-
gendharte (490) graue Irdenware am stärksten
vertreten sind. Das entspricht den Erwartungen
bei spätmittelalterlicher Keramik in diesem Ge-
biet (STEPHAN 1978/1979).
In einigen wenigen Exemplaren gibt es glasierte
grautonige Ware; teilweise handelt es sich offen-
bar um absichtlich glasierte, teils aber auch nur
um überfeuerte Ware mit Eigenglasur. Bei der
glasierten und unglasierten gelbtonigen Ware
fehlen derzeit noch stichhaltige Anhaltspunkte
zur Untergliederung nach der Machart. In der
Regel wurde zwischen glasierten und unglasier-
ten Scherben unterschieden. Dabei ist jedoch
Vorsicht angebracht, da die Glasur abgeplatzt
sein kann, ohne Spuren zu hinterlassen, da
Fehlbrände auch bei einem ersten Brand, vor
Aufträgen der Glasur (Schwelbrand), vorkom-
men und viele Gefäße nur teilglasiert waren.
Nicht selten finden sich lediglich Flecken von
Bleiglasur. Sowohl Unregelmäßigkeiten als auch
verbrannte Glasuren beweisen, daß man damals
noch mit Glasuren experimentierte. Hierfür
spricht auch die Tatsache, daß derart gravieren-
de Glasurmängel bei neuzeitlicher Keramik —
auch bei Fehlbränden — kaum vorkommen.
Überwiegend ist die Keramik hart gebrannt und
fein mit Sand gemagert.
Das Steinzeug bietet sich hingegen zu einer Un-
tergliederung an. Helles Steinzeug mit dünner
Salzglasur, oder auch nur mit Ascheanflugglasur
(REINEKING-VON BOCK 1976, 7, 14), in voll-
entwickelter Siegburger Art kommt nur verein-
zelt vor und dürfte rheinische Einfuhrware zum
Gebrauch sein, vielleicht auch als Anregung für
Änderungen innerhalb der Produktion gedient
haben. Von diesem gelegentlich kaum zu tren-
nen ist hellgraues Faststeinzeug und Steinzeug
(565), das offenbar in Coppengrave hergestellt
wurde, aber nur selten vorkommt. Über die
Hälfte, etwa sechzig bis siebzig Prozent aller Ge-
fäße, gehören zum grautonigen fast oder ganz
gesinterten Steinzeug mit bräunlicher bis grünli-
cher Glasur (560). Etwa zwanzig Prozent beträgt
der Anteil der grautonigen fast gesinterten,
manganrot glasierten Gefäße (550) und etwa
fünf Prozent stellt das ungesinterte gelbtonige
Protosteinzeug (570).
Eine listenförmige Zusammenstellung der Kera-
mikarten und der wichtigsten Formen mag ei-
nen gewissen Eindruck von der Häufigkeit des
Vorkommens vermitteln. Mehr kann unter den
gegebenen Bedingungen keinesfalls erreicht
werden. Schon eine vergleichsweise simple gra-
phische Darstellung in Form einer Tabelle wäre
hier des Guten zuviel. Ohne mehrjährige syste-
matische Aufsammlungen und möglichst auch
nachfolgende Grabungen ist eine statistische
Auswertung nicht sinnvoll. Dies sei an einem
einzelnen, willkürlich herausgegriffenen Bei-
spiel verdeutlicht: die errechneten Zahlen müß-
ten für (560) etwas nach oben, für (550) und
(570) etwas nach unten verschoben werden, da
besonders viele Fragmente von Tüllengefäßen
aufgehoben wurden.
2.6.2.2 Gefäßformen der grautonigen Irden-
ware und ihre zeitliche Einordnung
(Taf. 6—13; Abb. 14—13)
Bei der grautonigen reduzierend gebrannten Ir-
denware überwiegt offenbar das Küchenge-
schirr. An erster Stelle sind die Kugeltöpfe zu
nennen (Taf. 6, 1; 7;~9, 1—2). Sie besitzen in
der Regel eine ausgeprägte Riefenzone aus drei
(meist fünf) bis sieben Rillen auf der Schulter,
die oft durch einen leichten Knick vom Bauch
abgesetzt ist. Es gibt jedoch auch Gefäße mit
glatter oder fast glatter Schulterpartie, die in
diesen Fällen manchmal — vielleicht infolge ei-
nes Rückgriffes auf Metallvorbilder — durch ei-
nen deutlichen Knick abgesetzt ist. Die Schulter
kann kurz und unauffällig rundlich einbiegend
(Taf. 6, 2), jedoch auch lang und nur leicht ge-
schwungen oder sogar gerade aufsteigend sein
(Taf. 6, 1). Der Rand biegt zumeist rundlich aus
und ist annähernd lippenförmig, zumeist schräg
nach außen abgestrichen (Abb. 13, 1—3). Die
Mehrzahl der Randformen ist während eines
langen Zeitraumes hergestellt worden (bes.
Abb. 13, 1, 12). Jedoch dürften gewisse Varian-
ten eine nähere zeitliche Ansprache ermöglichen
(etwa Abb. 13, 13—14, wohl erst 14. und 15.
Jahrhundert). Begründete Aussagen lassen sich
allerdings erst nach einer systematischen Aus-
wertung von chronologisch gesicherten Funden
31
nicht aber ins 14. und 15. Jahrhundert einord-
nen möchte. Desungeachtet kann man fest-
halten, daß die helltonige (481) und die klin-
gendharte (490) graue Irdenware am stärksten
vertreten sind. Das entspricht den Erwartungen
bei spätmittelalterlicher Keramik in diesem Ge-
biet (STEPHAN 1978/1979).
In einigen wenigen Exemplaren gibt es glasierte
grautonige Ware; teilweise handelt es sich offen-
bar um absichtlich glasierte, teils aber auch nur
um überfeuerte Ware mit Eigenglasur. Bei der
glasierten und unglasierten gelbtonigen Ware
fehlen derzeit noch stichhaltige Anhaltspunkte
zur Untergliederung nach der Machart. In der
Regel wurde zwischen glasierten und unglasier-
ten Scherben unterschieden. Dabei ist jedoch
Vorsicht angebracht, da die Glasur abgeplatzt
sein kann, ohne Spuren zu hinterlassen, da
Fehlbrände auch bei einem ersten Brand, vor
Aufträgen der Glasur (Schwelbrand), vorkom-
men und viele Gefäße nur teilglasiert waren.
Nicht selten finden sich lediglich Flecken von
Bleiglasur. Sowohl Unregelmäßigkeiten als auch
verbrannte Glasuren beweisen, daß man damals
noch mit Glasuren experimentierte. Hierfür
spricht auch die Tatsache, daß derart gravieren-
de Glasurmängel bei neuzeitlicher Keramik —
auch bei Fehlbränden — kaum vorkommen.
Überwiegend ist die Keramik hart gebrannt und
fein mit Sand gemagert.
Das Steinzeug bietet sich hingegen zu einer Un-
tergliederung an. Helles Steinzeug mit dünner
Salzglasur, oder auch nur mit Ascheanflugglasur
(REINEKING-VON BOCK 1976, 7, 14), in voll-
entwickelter Siegburger Art kommt nur verein-
zelt vor und dürfte rheinische Einfuhrware zum
Gebrauch sein, vielleicht auch als Anregung für
Änderungen innerhalb der Produktion gedient
haben. Von diesem gelegentlich kaum zu tren-
nen ist hellgraues Faststeinzeug und Steinzeug
(565), das offenbar in Coppengrave hergestellt
wurde, aber nur selten vorkommt. Über die
Hälfte, etwa sechzig bis siebzig Prozent aller Ge-
fäße, gehören zum grautonigen fast oder ganz
gesinterten Steinzeug mit bräunlicher bis grünli-
cher Glasur (560). Etwa zwanzig Prozent beträgt
der Anteil der grautonigen fast gesinterten,
manganrot glasierten Gefäße (550) und etwa
fünf Prozent stellt das ungesinterte gelbtonige
Protosteinzeug (570).
Eine listenförmige Zusammenstellung der Kera-
mikarten und der wichtigsten Formen mag ei-
nen gewissen Eindruck von der Häufigkeit des
Vorkommens vermitteln. Mehr kann unter den
gegebenen Bedingungen keinesfalls erreicht
werden. Schon eine vergleichsweise simple gra-
phische Darstellung in Form einer Tabelle wäre
hier des Guten zuviel. Ohne mehrjährige syste-
matische Aufsammlungen und möglichst auch
nachfolgende Grabungen ist eine statistische
Auswertung nicht sinnvoll. Dies sei an einem
einzelnen, willkürlich herausgegriffenen Bei-
spiel verdeutlicht: die errechneten Zahlen müß-
ten für (560) etwas nach oben, für (550) und
(570) etwas nach unten verschoben werden, da
besonders viele Fragmente von Tüllengefäßen
aufgehoben wurden.
2.6.2.2 Gefäßformen der grautonigen Irden-
ware und ihre zeitliche Einordnung
(Taf. 6—13; Abb. 14—13)
Bei der grautonigen reduzierend gebrannten Ir-
denware überwiegt offenbar das Küchenge-
schirr. An erster Stelle sind die Kugeltöpfe zu
nennen (Taf. 6, 1; 7;~9, 1—2). Sie besitzen in
der Regel eine ausgeprägte Riefenzone aus drei
(meist fünf) bis sieben Rillen auf der Schulter,
die oft durch einen leichten Knick vom Bauch
abgesetzt ist. Es gibt jedoch auch Gefäße mit
glatter oder fast glatter Schulterpartie, die in
diesen Fällen manchmal — vielleicht infolge ei-
nes Rückgriffes auf Metallvorbilder — durch ei-
nen deutlichen Knick abgesetzt ist. Die Schulter
kann kurz und unauffällig rundlich einbiegend
(Taf. 6, 2), jedoch auch lang und nur leicht ge-
schwungen oder sogar gerade aufsteigend sein
(Taf. 6, 1). Der Rand biegt zumeist rundlich aus
und ist annähernd lippenförmig, zumeist schräg
nach außen abgestrichen (Abb. 13, 1—3). Die
Mehrzahl der Randformen ist während eines
langen Zeitraumes hergestellt worden (bes.
Abb. 13, 1, 12). Jedoch dürften gewisse Varian-
ten eine nähere zeitliche Ansprache ermöglichen
(etwa Abb. 13, 13—14, wohl erst 14. und 15.
Jahrhundert). Begründete Aussagen lassen sich
allerdings erst nach einer systematischen Aus-
wertung von chronologisch gesicherten Funden
31