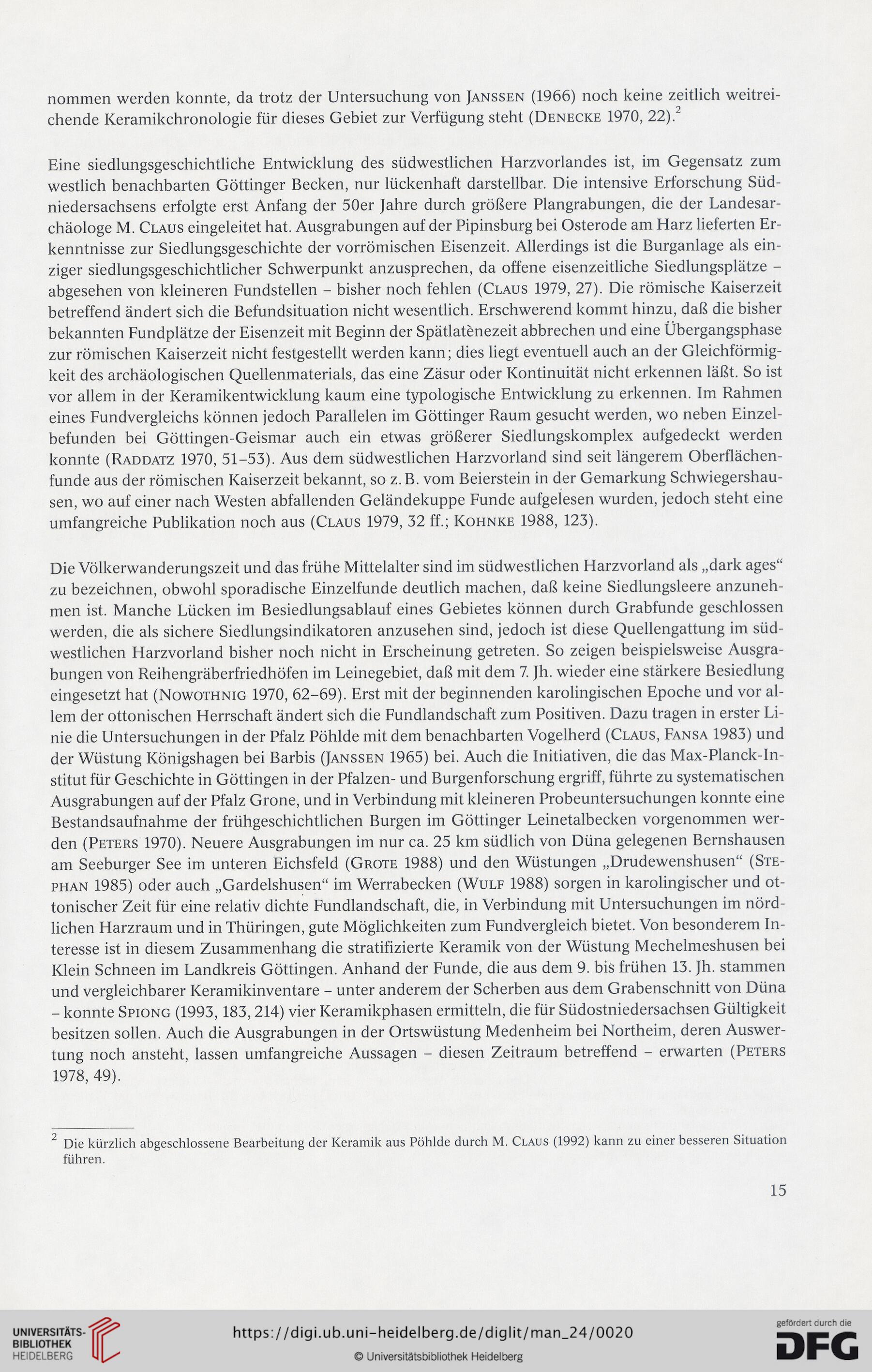nommen werden konnte, da trotz der Untersuchung von Janssen (1966) noch keine zeitlich weitrei-
chende Keramikchronologie für dieses Gebiet zur Verfügung steht (Denecke 1970, 22).2
Eine siedlungsgeschichtliche Entwicklung des südwestlichen Harzvorlandes ist, im Gegensatz zum
westlich benachbarten Göttinger Becken, nur lückenhaft darstellbar. Die intensive Erforschung Süd-
niedersachsens erfolgte erst Anfang der 50er Jahre durch größere Plangrabungen, die der Landesar-
chäologe M. Claus eingeleitet hat. Ausgrabungen auf der Pipinsburg bei Osterode am Harz lieferten Er-
kenntnisse zur Siedlungsgeschichte der vorrömischen Eisenzeit. Allerdings ist die Burganlage als ein-
ziger siedlungsgeschichtlicher Schwerpunkt anzusprechen, da offene eisenzeitliche Siedlungsplätze -
abgesehen von kleineren Fundstellen - bisher noch fehlen (Claus 1979, 27). Die römische Kaiserzeit
betreffend ändert sich die Befundsituation nicht wesentlich. Erschwerend kommt hinzu, daß die bisher
bekannten Fundplätze der Eisenzeit mit Beginn der Spätlatenezeit abbrechen und eine Übergangsphase
zur römischen Kaiserzeit nicht festgestellt werden kann; dies liegt eventuell auch an der Gleichförmig-
keit des archäologischen Quellenmaterials, das eine Zäsur oder Kontinuität nicht erkennen läßt. So ist
vor allem in der Keramikentwicklung kaum eine typologische Entwicklung zu erkennen. Im Rahmen
eines Fundvergleichs können jedoch Parallelen im Göttinger Raum gesucht werden, wo neben Einzel-
befunden bei Göttingen-Geismar auch ein etwas größerer Siedlungskomplex aufgedeckt werden
konnte (Raddatz 1970, 51-53). Aus dem südwestlichen Harzvorland sind seit längerem Oberflächen-
funde aus der römischen Kaiserzeit bekannt, so z. B. vom Beierstein in der Gemarkung Schwiegershau-
sen, wo auf einer nach Westen abfallenden Geländekuppe Funde aufgelesen wurden, jedoch steht eine
umfangreiche Publikation noch aus (Claus 1979, 32 ff.; Kohnke 1988, 123).
Die Völkerwanderungszeit und das frühe Mittelalter sind im südwestlichen Harzvorland als „dark ages“
zu bezeichnen, obwohl sporadische Einzelfunde deutlich machen, daß keine Siedlungsleere anzuneh-
men ist. Manche Lücken im Besiedlungsablauf eines Gebietes können durch Grabfunde geschlossen
werden, die als sichere Siedlungsindikatoren anzusehen sind, jedoch ist diese Quellengattung im süd-
westlichen Harzvorland bisher noch nicht in Erscheinung getreten. So zeigen beispielsweise Ausgra-
bungen von Reihengräberfriedhöfen im Leinegebiet, daß mit dem 7. Jh. wieder eine stärkere Besiedlung
eingesetzt hat (Nowothnig 1970, 62-69). Erst mit der beginnenden karolingischen Epoche und vor al-
lem der ottonischen Herrschaft ändert sich die Fundlandschaft zum Positiven. Dazu tragen in erster Li-
nie die Untersuchungen in der Pfalz Pöhlde mit dem benachbarten Vogelherd (Claus, Fansa 1983) und
der Wüstung Königshagen bei Barbis (Janssen 1965) bei. Auch die Initiativen, die das Max-Planck-In-
stitut für Geschichte in Göttingen in der Pfalzen- und Burgenforschung ergriff, führte zu systematischen
Ausgrabungen auf der Pfalz Grone, und in Verbindung mit kleineren Probeuntersuchungen konnte eine
Bestandsaufnahme der frühgeschichtlichen Burgen im Göttinger Leinetalbecken vorgenommen wer-
den (Peters 1970). Neuere Ausgrabungen im nur ca. 25 km südlich von Düna gelegenen Bernshausen
am Seeburger See im unteren Eichsfeld (Grote 1988) und den Wüstungen „Drudewenshusen“ (Ste-
phan 1985) oder auch „Gardelshusen“ im Werrabecken (Wulf 1988) sorgen in karolingischer und ot-
tonischer Zeit für eine relativ dichte Fundlandschaft, die, in Verbindung mit Untersuchungen im nörd-
lichen Harzraum und in Thüringen, gute Möglichkeiten zum Fundvergleich bietet. Von besonderem In-
teresse ist in diesem Zusammenhang die stratifizierte Keramik von der Wüstung Mechelmeshusen bei
Klein Schneen im Landkreis Göttingen. Anhand der Funde, die aus dem 9. bis frühen 13. Jh. stammen
und vergleichbarer Keramikinventare - unter anderem der Scherben aus dem Grabenschnitt von Düna
- konnte Spiong (1993,183,214) vier Keramikphasen ermitteln, die für Südostniedersachsen Gültigkeit
besitzen sollen. Auch die Ausgrabungen in der Ortswüstung Medenheim bei Northeim, deren Auswer-
tung noch ansteht, lassen umfangreiche Aussagen - diesen Zeitraum betreffend - erwarten (Peters
1978, 49).
Die kürzlich abgeschlossene Bearbeitung der Keramik aus Pöhlde durch M. Claus (1992) kann zu einer besseren Situation
führen.
15
chende Keramikchronologie für dieses Gebiet zur Verfügung steht (Denecke 1970, 22).2
Eine siedlungsgeschichtliche Entwicklung des südwestlichen Harzvorlandes ist, im Gegensatz zum
westlich benachbarten Göttinger Becken, nur lückenhaft darstellbar. Die intensive Erforschung Süd-
niedersachsens erfolgte erst Anfang der 50er Jahre durch größere Plangrabungen, die der Landesar-
chäologe M. Claus eingeleitet hat. Ausgrabungen auf der Pipinsburg bei Osterode am Harz lieferten Er-
kenntnisse zur Siedlungsgeschichte der vorrömischen Eisenzeit. Allerdings ist die Burganlage als ein-
ziger siedlungsgeschichtlicher Schwerpunkt anzusprechen, da offene eisenzeitliche Siedlungsplätze -
abgesehen von kleineren Fundstellen - bisher noch fehlen (Claus 1979, 27). Die römische Kaiserzeit
betreffend ändert sich die Befundsituation nicht wesentlich. Erschwerend kommt hinzu, daß die bisher
bekannten Fundplätze der Eisenzeit mit Beginn der Spätlatenezeit abbrechen und eine Übergangsphase
zur römischen Kaiserzeit nicht festgestellt werden kann; dies liegt eventuell auch an der Gleichförmig-
keit des archäologischen Quellenmaterials, das eine Zäsur oder Kontinuität nicht erkennen läßt. So ist
vor allem in der Keramikentwicklung kaum eine typologische Entwicklung zu erkennen. Im Rahmen
eines Fundvergleichs können jedoch Parallelen im Göttinger Raum gesucht werden, wo neben Einzel-
befunden bei Göttingen-Geismar auch ein etwas größerer Siedlungskomplex aufgedeckt werden
konnte (Raddatz 1970, 51-53). Aus dem südwestlichen Harzvorland sind seit längerem Oberflächen-
funde aus der römischen Kaiserzeit bekannt, so z. B. vom Beierstein in der Gemarkung Schwiegershau-
sen, wo auf einer nach Westen abfallenden Geländekuppe Funde aufgelesen wurden, jedoch steht eine
umfangreiche Publikation noch aus (Claus 1979, 32 ff.; Kohnke 1988, 123).
Die Völkerwanderungszeit und das frühe Mittelalter sind im südwestlichen Harzvorland als „dark ages“
zu bezeichnen, obwohl sporadische Einzelfunde deutlich machen, daß keine Siedlungsleere anzuneh-
men ist. Manche Lücken im Besiedlungsablauf eines Gebietes können durch Grabfunde geschlossen
werden, die als sichere Siedlungsindikatoren anzusehen sind, jedoch ist diese Quellengattung im süd-
westlichen Harzvorland bisher noch nicht in Erscheinung getreten. So zeigen beispielsweise Ausgra-
bungen von Reihengräberfriedhöfen im Leinegebiet, daß mit dem 7. Jh. wieder eine stärkere Besiedlung
eingesetzt hat (Nowothnig 1970, 62-69). Erst mit der beginnenden karolingischen Epoche und vor al-
lem der ottonischen Herrschaft ändert sich die Fundlandschaft zum Positiven. Dazu tragen in erster Li-
nie die Untersuchungen in der Pfalz Pöhlde mit dem benachbarten Vogelherd (Claus, Fansa 1983) und
der Wüstung Königshagen bei Barbis (Janssen 1965) bei. Auch die Initiativen, die das Max-Planck-In-
stitut für Geschichte in Göttingen in der Pfalzen- und Burgenforschung ergriff, führte zu systematischen
Ausgrabungen auf der Pfalz Grone, und in Verbindung mit kleineren Probeuntersuchungen konnte eine
Bestandsaufnahme der frühgeschichtlichen Burgen im Göttinger Leinetalbecken vorgenommen wer-
den (Peters 1970). Neuere Ausgrabungen im nur ca. 25 km südlich von Düna gelegenen Bernshausen
am Seeburger See im unteren Eichsfeld (Grote 1988) und den Wüstungen „Drudewenshusen“ (Ste-
phan 1985) oder auch „Gardelshusen“ im Werrabecken (Wulf 1988) sorgen in karolingischer und ot-
tonischer Zeit für eine relativ dichte Fundlandschaft, die, in Verbindung mit Untersuchungen im nörd-
lichen Harzraum und in Thüringen, gute Möglichkeiten zum Fundvergleich bietet. Von besonderem In-
teresse ist in diesem Zusammenhang die stratifizierte Keramik von der Wüstung Mechelmeshusen bei
Klein Schneen im Landkreis Göttingen. Anhand der Funde, die aus dem 9. bis frühen 13. Jh. stammen
und vergleichbarer Keramikinventare - unter anderem der Scherben aus dem Grabenschnitt von Düna
- konnte Spiong (1993,183,214) vier Keramikphasen ermitteln, die für Südostniedersachsen Gültigkeit
besitzen sollen. Auch die Ausgrabungen in der Ortswüstung Medenheim bei Northeim, deren Auswer-
tung noch ansteht, lassen umfangreiche Aussagen - diesen Zeitraum betreffend - erwarten (Peters
1978, 49).
Die kürzlich abgeschlossene Bearbeitung der Keramik aus Pöhlde durch M. Claus (1992) kann zu einer besseren Situation
führen.
15