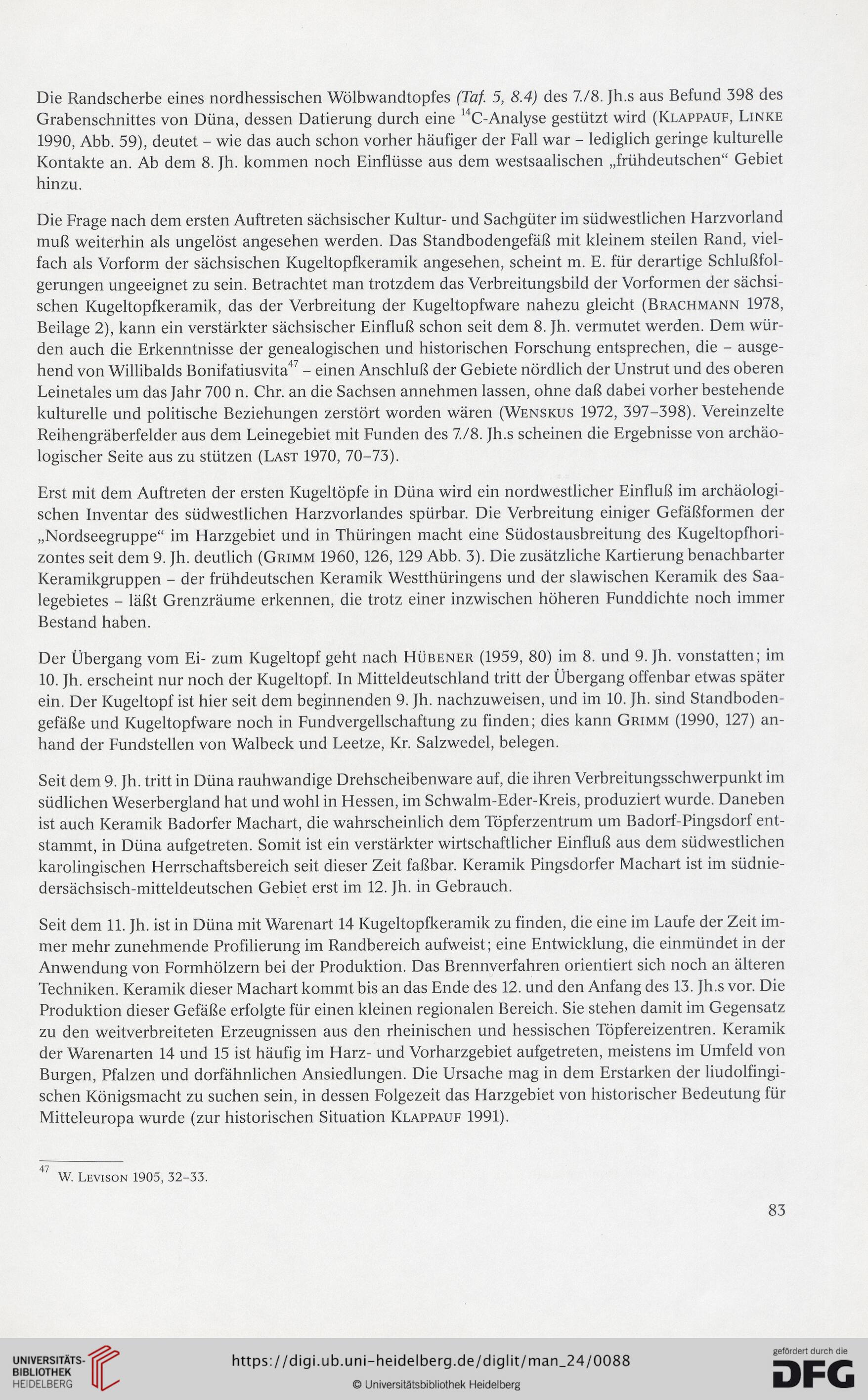Die Randscherbe eines nordhessischen Wölbwandtopfes (Taf. 5, 8.4) des 7/8. Jh.s aus Befund 398 des
Grabenschnittes von Düna, dessen Datierung durch eine 14C-Analyse gestützt wird (Klappauf, Linke
1990, Abb. 59), deutet - wie das auch schon vorher häufiger der Fall war - lediglich geringe kulturelle
Kontakte an. Ab dem 8. Jh. kommen noch Einflüsse aus dem westsaalischen „frühdeutschen“ Gebiet
hinzu.
Die Frage nach dem ersten Auftreten sächsischer Kultur- und Sachgüter im südwestlichen Harzvorland
muß weiterhin als ungelöst angesehen werden. Das Standbodengefäß mit kleinem steilen Rand, viel-
fach als Vorform der sächsischen Kugeltopfkeramik angesehen, scheint m. E. für derartige Schlußfol-
gerungen ungeeignet zu sein. Betrachtet man trotzdem das Verbreitungsbild der Vorformen der sächsi-
schen Kugeltopfkeramik, das der Verbreitung der Kugeltopfware nahezu gleicht (Brachmann 1978,
Beilage 2), kann ein verstärkter sächsischer Einfluß schon seit dem 8. Jh. vermutet werden. Dem wür-
den auch die Erkenntnisse der genealogischen und historischen Forschung entsprechen, die - ausge-
hend von Willibalds Bonifatiusvita47 - einen Anschluß der Gebiete nördlich der Unstrut und des oberen
Leinetales um das Jahr 700 n. Chr. an die Sachsen annehmen lassen, ohne daß dabei vorher bestehende
kulturelle und politische Beziehungen zerstört worden wären (Wenskus 1972, 397-398). Vereinzelte
Reihengräberfelder aus dem Leinegebiet mit Funden des 7/8. Jh.s scheinen die Ergebnisse von archäo-
logischer Seite aus zu stützen (Last 1970, 70-73).
Erst mit dem Auftreten der ersten Kugeltöpfe in Düna wird ein nordwestlicher Einfluß im archäologi-
schen Inventar des südwestlichen Harzvorlandes spürbar. Die Verbreitung einiger Gefäßformen der
„Nordseegruppe“ im Harzgebiet und in Thüringen macht eine Südostausbreitung des Kugeltopfhori-
zontes seit dem 9. Jh. deutlich (Grimm 1960, 126, 129 Abb. 3). Die zusätzliche Kartierung benachbarter
Keramikgruppen - der frühdeutschen Keramik Westthüringens und der slawischen Keramik des Saa-
legebietes - läßt Grenzräume erkennen, die trotz einer inzwischen höheren Funddichte noch immer
Bestand haben.
Der Übergang vom Ei- zum Kugeltopf geht nach Hübener (1959, 80) im 8. und 9. Jh. vonstatten; im
10. Jh. erscheint nur noch der Kugeltopf. In Mitteldeutschland tritt der Übergang offenbar etwas später
ein. Der Kugeltopf ist hier seit dem beginnenden 9. Jh. nachzuweisen, und im 10. Jh. sind Standboden-
gefäße und Kugeltopfware noch in Fundvergellschaftung zu finden; dies kann Grimm (1990, 127) an-
hand der Fundstellen von Walbeck und Leetze, Kr. Salzwedel, belegen.
Seit dem 9. Jh. tritt in Düna rauhwandige Drehscheibenware auf, die ihren Verbreitungsschwerpunkt im
südlichen Weserbergland hat und wohl in Hessen, im Schwalm-Eder-Kreis, produziert wurde. Daneben
ist auch Keramik Badorfer Machart, die wahrscheinlich dem Töpferzentrum um Badorf-Pingsdorf ent-
stammt, in Düna aufgetreten. Somit ist ein verstärkter wirtschaftlicher Einfluß aus dem südwestlichen
karolingischen Herrschaftsbereich seit dieser Zeit faßbar. Keramik Pingsdorfer Machart ist im südnie-
dersächsisch-mitteldeutschen Gebiet erst im 12. Jh. in Gebrauch.
Seit dem 11. Jh. ist in Düna mit Warenart 14 Kugeltopfkeramik zu finden, die eine im Laufe der Zeit im-
mer mehr zunehmende Profilierung im Randbereich aufweist; eine Entwicklung, die einmündet in der
Anwendung von Formhölzern bei der Produktion. Das Brennverfahren orientiert sich noch an älteren
Techniken. Keramik dieser Machart kommt bis an das Ende des 12. und den Anfang des 13. Jh.s vor. Die
Produktion dieser Gefäße erfolgte für einen kleinen regionalen Bereich. Sie stehen damit im Gegensatz
zu den weitverbreiteten Erzeugnissen aus den rheinischen und hessischen Töpfereizentren. Keramik
der Warenarten 14 und 15 ist häufig im Harz- und Vorharzgebiet aufgetreten, meistens im Umfeld von
Burgen, Pfalzen und dorfähnlichen Ansiedlungen. Die Ursache mag in dem Erstarken der liudolfingi-
schen Königsmacht zu suchen sein, in dessen Folgezeit das Harzgebiet von historischer Bedeutung für
Mitteleuropa wurde (zur historischen Situation Klappauf 1991).
W. Levison 1905, 32-33.
83
Grabenschnittes von Düna, dessen Datierung durch eine 14C-Analyse gestützt wird (Klappauf, Linke
1990, Abb. 59), deutet - wie das auch schon vorher häufiger der Fall war - lediglich geringe kulturelle
Kontakte an. Ab dem 8. Jh. kommen noch Einflüsse aus dem westsaalischen „frühdeutschen“ Gebiet
hinzu.
Die Frage nach dem ersten Auftreten sächsischer Kultur- und Sachgüter im südwestlichen Harzvorland
muß weiterhin als ungelöst angesehen werden. Das Standbodengefäß mit kleinem steilen Rand, viel-
fach als Vorform der sächsischen Kugeltopfkeramik angesehen, scheint m. E. für derartige Schlußfol-
gerungen ungeeignet zu sein. Betrachtet man trotzdem das Verbreitungsbild der Vorformen der sächsi-
schen Kugeltopfkeramik, das der Verbreitung der Kugeltopfware nahezu gleicht (Brachmann 1978,
Beilage 2), kann ein verstärkter sächsischer Einfluß schon seit dem 8. Jh. vermutet werden. Dem wür-
den auch die Erkenntnisse der genealogischen und historischen Forschung entsprechen, die - ausge-
hend von Willibalds Bonifatiusvita47 - einen Anschluß der Gebiete nördlich der Unstrut und des oberen
Leinetales um das Jahr 700 n. Chr. an die Sachsen annehmen lassen, ohne daß dabei vorher bestehende
kulturelle und politische Beziehungen zerstört worden wären (Wenskus 1972, 397-398). Vereinzelte
Reihengräberfelder aus dem Leinegebiet mit Funden des 7/8. Jh.s scheinen die Ergebnisse von archäo-
logischer Seite aus zu stützen (Last 1970, 70-73).
Erst mit dem Auftreten der ersten Kugeltöpfe in Düna wird ein nordwestlicher Einfluß im archäologi-
schen Inventar des südwestlichen Harzvorlandes spürbar. Die Verbreitung einiger Gefäßformen der
„Nordseegruppe“ im Harzgebiet und in Thüringen macht eine Südostausbreitung des Kugeltopfhori-
zontes seit dem 9. Jh. deutlich (Grimm 1960, 126, 129 Abb. 3). Die zusätzliche Kartierung benachbarter
Keramikgruppen - der frühdeutschen Keramik Westthüringens und der slawischen Keramik des Saa-
legebietes - läßt Grenzräume erkennen, die trotz einer inzwischen höheren Funddichte noch immer
Bestand haben.
Der Übergang vom Ei- zum Kugeltopf geht nach Hübener (1959, 80) im 8. und 9. Jh. vonstatten; im
10. Jh. erscheint nur noch der Kugeltopf. In Mitteldeutschland tritt der Übergang offenbar etwas später
ein. Der Kugeltopf ist hier seit dem beginnenden 9. Jh. nachzuweisen, und im 10. Jh. sind Standboden-
gefäße und Kugeltopfware noch in Fundvergellschaftung zu finden; dies kann Grimm (1990, 127) an-
hand der Fundstellen von Walbeck und Leetze, Kr. Salzwedel, belegen.
Seit dem 9. Jh. tritt in Düna rauhwandige Drehscheibenware auf, die ihren Verbreitungsschwerpunkt im
südlichen Weserbergland hat und wohl in Hessen, im Schwalm-Eder-Kreis, produziert wurde. Daneben
ist auch Keramik Badorfer Machart, die wahrscheinlich dem Töpferzentrum um Badorf-Pingsdorf ent-
stammt, in Düna aufgetreten. Somit ist ein verstärkter wirtschaftlicher Einfluß aus dem südwestlichen
karolingischen Herrschaftsbereich seit dieser Zeit faßbar. Keramik Pingsdorfer Machart ist im südnie-
dersächsisch-mitteldeutschen Gebiet erst im 12. Jh. in Gebrauch.
Seit dem 11. Jh. ist in Düna mit Warenart 14 Kugeltopfkeramik zu finden, die eine im Laufe der Zeit im-
mer mehr zunehmende Profilierung im Randbereich aufweist; eine Entwicklung, die einmündet in der
Anwendung von Formhölzern bei der Produktion. Das Brennverfahren orientiert sich noch an älteren
Techniken. Keramik dieser Machart kommt bis an das Ende des 12. und den Anfang des 13. Jh.s vor. Die
Produktion dieser Gefäße erfolgte für einen kleinen regionalen Bereich. Sie stehen damit im Gegensatz
zu den weitverbreiteten Erzeugnissen aus den rheinischen und hessischen Töpfereizentren. Keramik
der Warenarten 14 und 15 ist häufig im Harz- und Vorharzgebiet aufgetreten, meistens im Umfeld von
Burgen, Pfalzen und dorfähnlichen Ansiedlungen. Die Ursache mag in dem Erstarken der liudolfingi-
schen Königsmacht zu suchen sein, in dessen Folgezeit das Harzgebiet von historischer Bedeutung für
Mitteleuropa wurde (zur historischen Situation Klappauf 1991).
W. Levison 1905, 32-33.
83