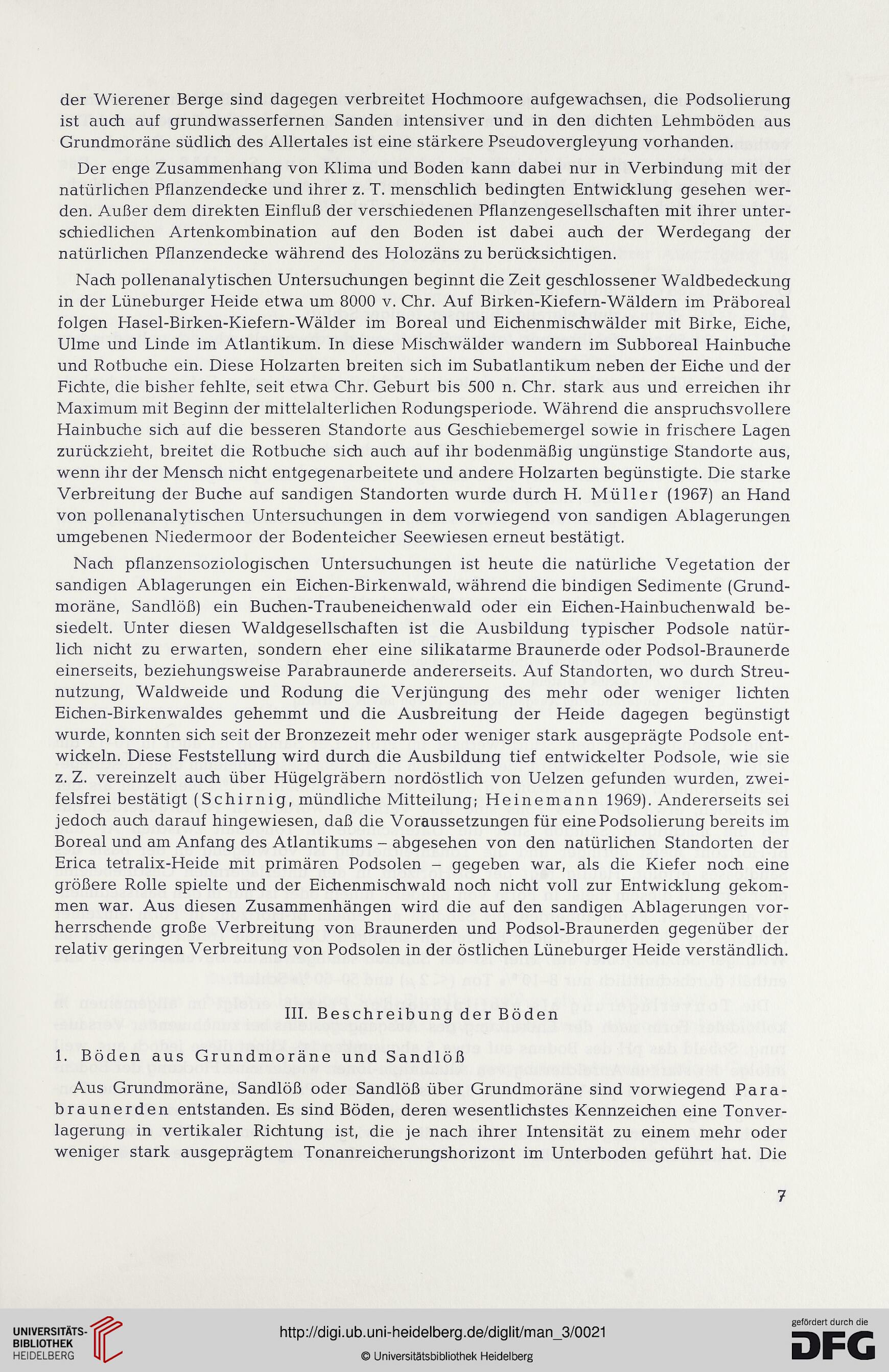der Wierener Berge sind dagegen verbreitet Hochmoore aufgewachsen, die Podsolierung
ist auch auf grundwasserfernen Sanden intensiver und in den dichten Lehmböden aus
Grundmoräne südlich des Allertales ist eine stärkere Pseudovergleyung vorhanden.
Der enge Zusammenhang von Klima und Boden kann dabei nur in Verbindung mit der
natürlichen Pflanzendecke und ihrer z. T. menschlich bedingten Entwicklung gesehen wer-
den. Außer dem direkten Einfluß der verschiedenen Pflanzengesellschaften mit ihrer unter-
schiedlichen Artenkombination auf den Boden ist dabei auch der Werdegang der
natürlichen Pflanzendecke während des Holozäns zu berücksichtigen.
Nach pollenanalytischen Untersuchungen beginnt die Zeit geschlossener Waldbedeckung
in der Lüneburger Heide etwa um 8000 v. Chr. Auf Birken-Kiefern-Wäldern im Präboreal
folgen Hasel-Birken-Kiefern-Wälder im Boreal und Eichenmischwälder mit Birke, Eiche,
Ulme und Linde im Atlantikum. In diese Mischwälder wandern im Subboreal Hainbuche
und Rotbuche ein. Diese Holzarten breiten sich im Subatlantikum neben der Eiche und der
Fichte, die bisher fehlte, seit etwa Chr. Geburt bis 500 n. Chr. stark aus und erreichen ihr
Maximum mit Beginn der mittelalterlichen Rodungsperiode. Während die anspruchsvollere
Hainbuche sich auf die besseren Standorte aus Geschiebemergel sowie in frischere Lagen
zurückzieht, breitet die Rotbuche sich auch auf ihr bodenmäßig ungünstige Standorte aus,
wenn ihr der Mensch nicht entgegenarbeitete und andere Holzarten begünstigte. Die starke
Verbreitung der Buche auf sandigen Standorten wurde durch H. Müller (1967) an Hand
von pollenanalytischen Untersuchungen in dem vorwiegend von sandigen Ablagerungen
umgebenen Niedermoor der Bodenteicher Seewiesen erneut bestätigt.
Nach pflanzensoziologischen Untersuchungen ist heute die natürliche Vegetation der
sandigen Ablagerungen ein Eichen-Birkenwald, während die bindigen Sedimente (Grund-
moräne, Sandlöß) ein Buchen-Traubeneichenwald oder ein Eichen-Hainbuchenwald be-
siedelt. Unter diesen Waldgesellschaften ist die Ausbildung typischer Podsole natür-
lich nicht zu erwarten, sondern eher eine silikatarme Braunerde oder Podsol-Braunerde
einerseits, beziehungsweise Parabraunerde andererseits. Auf Standorten, wo durch Streu-
nutzung, Waldweide und Rodung die Verjüngung des mehr oder weniger lichten
Eichen-Birkenwaldes gehemmt und die Ausbreitung der Heide dagegen begünstigt
wurde, konnten sich seit der Bronzezeit mehr oder weniger stark ausgeprägte Podsole ent-
wickeln. Diese Feststellung wird durch die Ausbildung tief entwickelter Podsole, wie sie
z. Z. vereinzelt auch über Hügelgräbern nordöstlich von Uelzen gefunden wurden, zwei-
felsfrei bestätigt (Schirnig, mündliche Mitteilung; Heinemann 1969). Andererseits sei
jedoch auch darauf hingewiesen, daß die Voraussetzungen für eine Podsolierung bereits im
Boreal und am Anfang des Atlantikums - abgesehen von den natürlichen Standorten der
Erica tetralix-Heide mit primären Podsolen - gegeben war, als die Kiefer noch eine
größere Rolle spielte und der Eichenmischwald noch nicht voll zur Entwicklung gekom-
men war. Aus diesen Zusammenhängen wird die auf den sandigen Ablagerungen vor-
herrschende große Verbreitung von Braunerden und Podsol-Braunerden gegenüber der
relativ geringen Verbreitung von Podsolen in der östlichen Lüneburger Heide verständlich.
III. Beschreibung der Böden
1. Böden aus Grundmoräne und Sandlöß
Aus Grundmoräne, Sandlöß oder Sandlöß über Grundmoräne sind vorwiegend Para-
braunerden entstanden. Es sind Böden, deren wesentlichstes Kennzeichen eine Tonver-
lagerung in vertikaler Richtung ist, die je nach ihrer Intensität zu einem mehr oder
weniger stark ausgeprägtem Tonanreicherungshorizont im Unterboden geführt hat. Die
7
ist auch auf grundwasserfernen Sanden intensiver und in den dichten Lehmböden aus
Grundmoräne südlich des Allertales ist eine stärkere Pseudovergleyung vorhanden.
Der enge Zusammenhang von Klima und Boden kann dabei nur in Verbindung mit der
natürlichen Pflanzendecke und ihrer z. T. menschlich bedingten Entwicklung gesehen wer-
den. Außer dem direkten Einfluß der verschiedenen Pflanzengesellschaften mit ihrer unter-
schiedlichen Artenkombination auf den Boden ist dabei auch der Werdegang der
natürlichen Pflanzendecke während des Holozäns zu berücksichtigen.
Nach pollenanalytischen Untersuchungen beginnt die Zeit geschlossener Waldbedeckung
in der Lüneburger Heide etwa um 8000 v. Chr. Auf Birken-Kiefern-Wäldern im Präboreal
folgen Hasel-Birken-Kiefern-Wälder im Boreal und Eichenmischwälder mit Birke, Eiche,
Ulme und Linde im Atlantikum. In diese Mischwälder wandern im Subboreal Hainbuche
und Rotbuche ein. Diese Holzarten breiten sich im Subatlantikum neben der Eiche und der
Fichte, die bisher fehlte, seit etwa Chr. Geburt bis 500 n. Chr. stark aus und erreichen ihr
Maximum mit Beginn der mittelalterlichen Rodungsperiode. Während die anspruchsvollere
Hainbuche sich auf die besseren Standorte aus Geschiebemergel sowie in frischere Lagen
zurückzieht, breitet die Rotbuche sich auch auf ihr bodenmäßig ungünstige Standorte aus,
wenn ihr der Mensch nicht entgegenarbeitete und andere Holzarten begünstigte. Die starke
Verbreitung der Buche auf sandigen Standorten wurde durch H. Müller (1967) an Hand
von pollenanalytischen Untersuchungen in dem vorwiegend von sandigen Ablagerungen
umgebenen Niedermoor der Bodenteicher Seewiesen erneut bestätigt.
Nach pflanzensoziologischen Untersuchungen ist heute die natürliche Vegetation der
sandigen Ablagerungen ein Eichen-Birkenwald, während die bindigen Sedimente (Grund-
moräne, Sandlöß) ein Buchen-Traubeneichenwald oder ein Eichen-Hainbuchenwald be-
siedelt. Unter diesen Waldgesellschaften ist die Ausbildung typischer Podsole natür-
lich nicht zu erwarten, sondern eher eine silikatarme Braunerde oder Podsol-Braunerde
einerseits, beziehungsweise Parabraunerde andererseits. Auf Standorten, wo durch Streu-
nutzung, Waldweide und Rodung die Verjüngung des mehr oder weniger lichten
Eichen-Birkenwaldes gehemmt und die Ausbreitung der Heide dagegen begünstigt
wurde, konnten sich seit der Bronzezeit mehr oder weniger stark ausgeprägte Podsole ent-
wickeln. Diese Feststellung wird durch die Ausbildung tief entwickelter Podsole, wie sie
z. Z. vereinzelt auch über Hügelgräbern nordöstlich von Uelzen gefunden wurden, zwei-
felsfrei bestätigt (Schirnig, mündliche Mitteilung; Heinemann 1969). Andererseits sei
jedoch auch darauf hingewiesen, daß die Voraussetzungen für eine Podsolierung bereits im
Boreal und am Anfang des Atlantikums - abgesehen von den natürlichen Standorten der
Erica tetralix-Heide mit primären Podsolen - gegeben war, als die Kiefer noch eine
größere Rolle spielte und der Eichenmischwald noch nicht voll zur Entwicklung gekom-
men war. Aus diesen Zusammenhängen wird die auf den sandigen Ablagerungen vor-
herrschende große Verbreitung von Braunerden und Podsol-Braunerden gegenüber der
relativ geringen Verbreitung von Podsolen in der östlichen Lüneburger Heide verständlich.
III. Beschreibung der Böden
1. Böden aus Grundmoräne und Sandlöß
Aus Grundmoräne, Sandlöß oder Sandlöß über Grundmoräne sind vorwiegend Para-
braunerden entstanden. Es sind Böden, deren wesentlichstes Kennzeichen eine Tonver-
lagerung in vertikaler Richtung ist, die je nach ihrer Intensität zu einem mehr oder
weniger stark ausgeprägtem Tonanreicherungshorizont im Unterboden geführt hat. Die
7