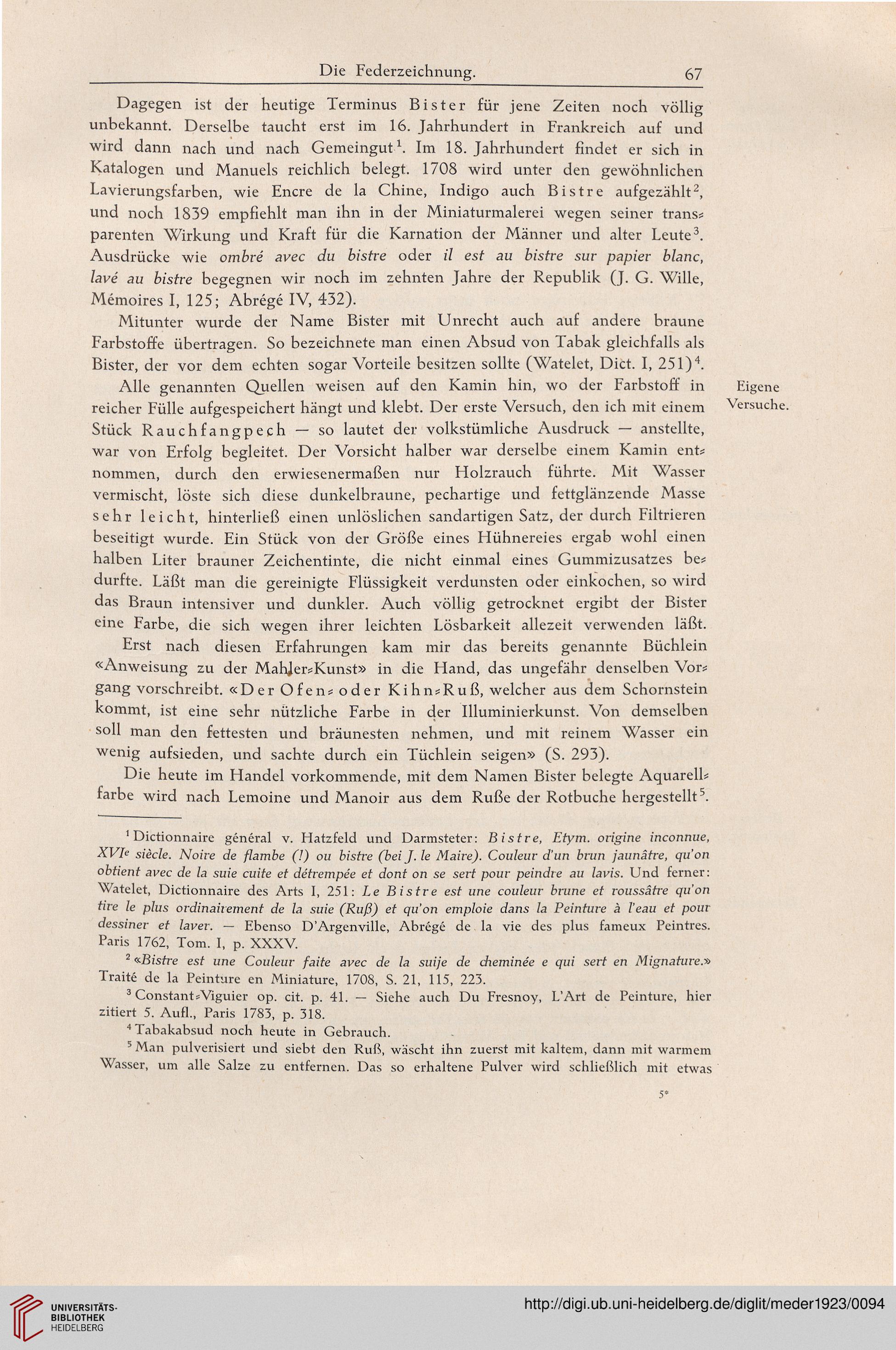Die Federzeichnung.
67
Dagegen ist der heutige Terminus Bister für jene Zeiten noch völlig
unbekannt. Derselbe taucht erst im 16. Jahrhundert in Frankreich auf und
wird dann nach und nach Gemeingut1. Im 18. Jahrhundert findet er sich in
Katalogen und Manuels reichlich belegt. 1708 wird unter den gewöhnlichen
Lavierungsfarben, wie Encre de la Chine, Indigo auch Bistre aufgezählt2,
und noch 1839 empfiehlt man ihn in der Miniaturmalerei wegen seiner trans*
parenten Wirkung und Kraft für die Karnation der Männer und alter Leute3.
Ausdrücke wie ombre avec du bistre oder il est au bistre sur papier blanc,
lave au bistre begegnen wir noch im zehnten Jahre der Republik (J. G. Wille,
Memoires I, 125; Abrege IV, 432).
Mitunter wurde der Name Bister mit Unrecht auch auf andere braune
Farbstoffe übertragen. So bezeichnete man einen Absud von Tabak gleichfalls als
Bister, der vor dem echten sogar Vorteile besitzen sollte (Watelet, Dict. I, 251)4.
Alle genannten Quellen weisen auf den Kamin hin, wo der Farbstoff in Eigene
reicher Fülle aufgespeichert hängt und klebt. Der erste Versuch, den ich mit einem Versuche.
Stück Rauchfangpech — so lautet der volkstümliche Ausdruck — anstellte,
war von Erfolg begleitet. Der Vorsicht halber war derselbe einem Kamin ent*
nommen, durch den erwiesenermaßen nur Holzrauch führte. Mit Wasser
vermischt, löste sich diese dunkelbraune, pechartige und fettglänzende Masse
sehr leicht, hinterließ einen unlöslichen sandartigen Satz, der durch Filtrieren
beseitigt wurde. Ein Stück von der Größe eines Hühnereies ergab wohl einen
halben Liter brauner Zeichentinte, die nicht einmal eines Gummizusatzes be?
durfte. Läßt man die gereinigte Flüssigkeit verdunsten oder einkochen, so wird
das Braun intensiver und dunkler. Auch völlig getrocknet ergibt der Bister
eine Farbe, die sich wegen ihrer leichten Lösbarkeit allezeit verwenden läßt.
Erst nach diesen Erfahrungen kam mir das bereits genannte Büchlein
«Anweisung zu der MabJersKunst» in die Hand, das ungefähr denselben Vor*
gang vorschreibt. «Der Ofens oder Kinn* Ruß, welcher aus dem Schornstein
kommt, ist eine sehr nützliche Farbe in der Illuminierkunst. Von demselben
soll man den fettesten und bräunesten nehmen, und mit reinem Wasser ein
wenig aufsieden, und sachte durch ein Tüchlein seigen» (S. 293).
Die heute im Handel vorkommende, mit dem Namen Bister belegte Aquarell*
färbe wird nach Lemoine und Manoir aus dem Ruße der Rotbuche hergestellt5.
1 Dictionnaire general v. Hatzfeld und Darmsteter: Bistre, Etym. origine inconnue,
XVI<! siede. Noire de flambe (!) ou bistre (bei J. le Maire). Couleur d'un brun jaunätre, qu'on
obtient avec de la suie cuite et detrempee et dont on se sert pour peindre au lavis. Und ferner:
Watelet, Dictionnaire des Arts I, 251: Le Bistre est une couleur brune et roussätre qu'on
tire le plus ordinairement de la suie (Ruß) et qu'on emploie dans la Peinture ä l'eau et pour
dessiner et laver. — Ebenso D'Argenville, Abrege de la vie des plus fameux Peintres.
Paris 1762, Tom. 1, p. XXXV.
2 «-Bistre est une Couleur faite avec de la suije de cheminee e qui sert en Mignature.»
Traite de la Peinture cn Miniature, 1708, S. 21, 115, 223.
3 ConstantsViguier op. cit. p. 41. — Siehe auch Du Fresnoy, L'Art de Peinture, hier
zitiert 5. Aufl., Paris 1783, p. 318.
4 Tabakabsud noch heute in Gebrauch.
5 Man pulverisiert und siebt den Ruß, wäscht ihn zuerst mit kaltem, dann mit warmem
Wasser, um alle Salze zu entfernen. Das so erhaltene Pulver wird schließlich mit etwas
5*
67
Dagegen ist der heutige Terminus Bister für jene Zeiten noch völlig
unbekannt. Derselbe taucht erst im 16. Jahrhundert in Frankreich auf und
wird dann nach und nach Gemeingut1. Im 18. Jahrhundert findet er sich in
Katalogen und Manuels reichlich belegt. 1708 wird unter den gewöhnlichen
Lavierungsfarben, wie Encre de la Chine, Indigo auch Bistre aufgezählt2,
und noch 1839 empfiehlt man ihn in der Miniaturmalerei wegen seiner trans*
parenten Wirkung und Kraft für die Karnation der Männer und alter Leute3.
Ausdrücke wie ombre avec du bistre oder il est au bistre sur papier blanc,
lave au bistre begegnen wir noch im zehnten Jahre der Republik (J. G. Wille,
Memoires I, 125; Abrege IV, 432).
Mitunter wurde der Name Bister mit Unrecht auch auf andere braune
Farbstoffe übertragen. So bezeichnete man einen Absud von Tabak gleichfalls als
Bister, der vor dem echten sogar Vorteile besitzen sollte (Watelet, Dict. I, 251)4.
Alle genannten Quellen weisen auf den Kamin hin, wo der Farbstoff in Eigene
reicher Fülle aufgespeichert hängt und klebt. Der erste Versuch, den ich mit einem Versuche.
Stück Rauchfangpech — so lautet der volkstümliche Ausdruck — anstellte,
war von Erfolg begleitet. Der Vorsicht halber war derselbe einem Kamin ent*
nommen, durch den erwiesenermaßen nur Holzrauch führte. Mit Wasser
vermischt, löste sich diese dunkelbraune, pechartige und fettglänzende Masse
sehr leicht, hinterließ einen unlöslichen sandartigen Satz, der durch Filtrieren
beseitigt wurde. Ein Stück von der Größe eines Hühnereies ergab wohl einen
halben Liter brauner Zeichentinte, die nicht einmal eines Gummizusatzes be?
durfte. Läßt man die gereinigte Flüssigkeit verdunsten oder einkochen, so wird
das Braun intensiver und dunkler. Auch völlig getrocknet ergibt der Bister
eine Farbe, die sich wegen ihrer leichten Lösbarkeit allezeit verwenden läßt.
Erst nach diesen Erfahrungen kam mir das bereits genannte Büchlein
«Anweisung zu der MabJersKunst» in die Hand, das ungefähr denselben Vor*
gang vorschreibt. «Der Ofens oder Kinn* Ruß, welcher aus dem Schornstein
kommt, ist eine sehr nützliche Farbe in der Illuminierkunst. Von demselben
soll man den fettesten und bräunesten nehmen, und mit reinem Wasser ein
wenig aufsieden, und sachte durch ein Tüchlein seigen» (S. 293).
Die heute im Handel vorkommende, mit dem Namen Bister belegte Aquarell*
färbe wird nach Lemoine und Manoir aus dem Ruße der Rotbuche hergestellt5.
1 Dictionnaire general v. Hatzfeld und Darmsteter: Bistre, Etym. origine inconnue,
XVI<! siede. Noire de flambe (!) ou bistre (bei J. le Maire). Couleur d'un brun jaunätre, qu'on
obtient avec de la suie cuite et detrempee et dont on se sert pour peindre au lavis. Und ferner:
Watelet, Dictionnaire des Arts I, 251: Le Bistre est une couleur brune et roussätre qu'on
tire le plus ordinairement de la suie (Ruß) et qu'on emploie dans la Peinture ä l'eau et pour
dessiner et laver. — Ebenso D'Argenville, Abrege de la vie des plus fameux Peintres.
Paris 1762, Tom. 1, p. XXXV.
2 «-Bistre est une Couleur faite avec de la suije de cheminee e qui sert en Mignature.»
Traite de la Peinture cn Miniature, 1708, S. 21, 115, 223.
3 ConstantsViguier op. cit. p. 41. — Siehe auch Du Fresnoy, L'Art de Peinture, hier
zitiert 5. Aufl., Paris 1783, p. 318.
4 Tabakabsud noch heute in Gebrauch.
5 Man pulverisiert und siebt den Ruß, wäscht ihn zuerst mit kaltem, dann mit warmem
Wasser, um alle Salze zu entfernen. Das so erhaltene Pulver wird schließlich mit etwas
5*