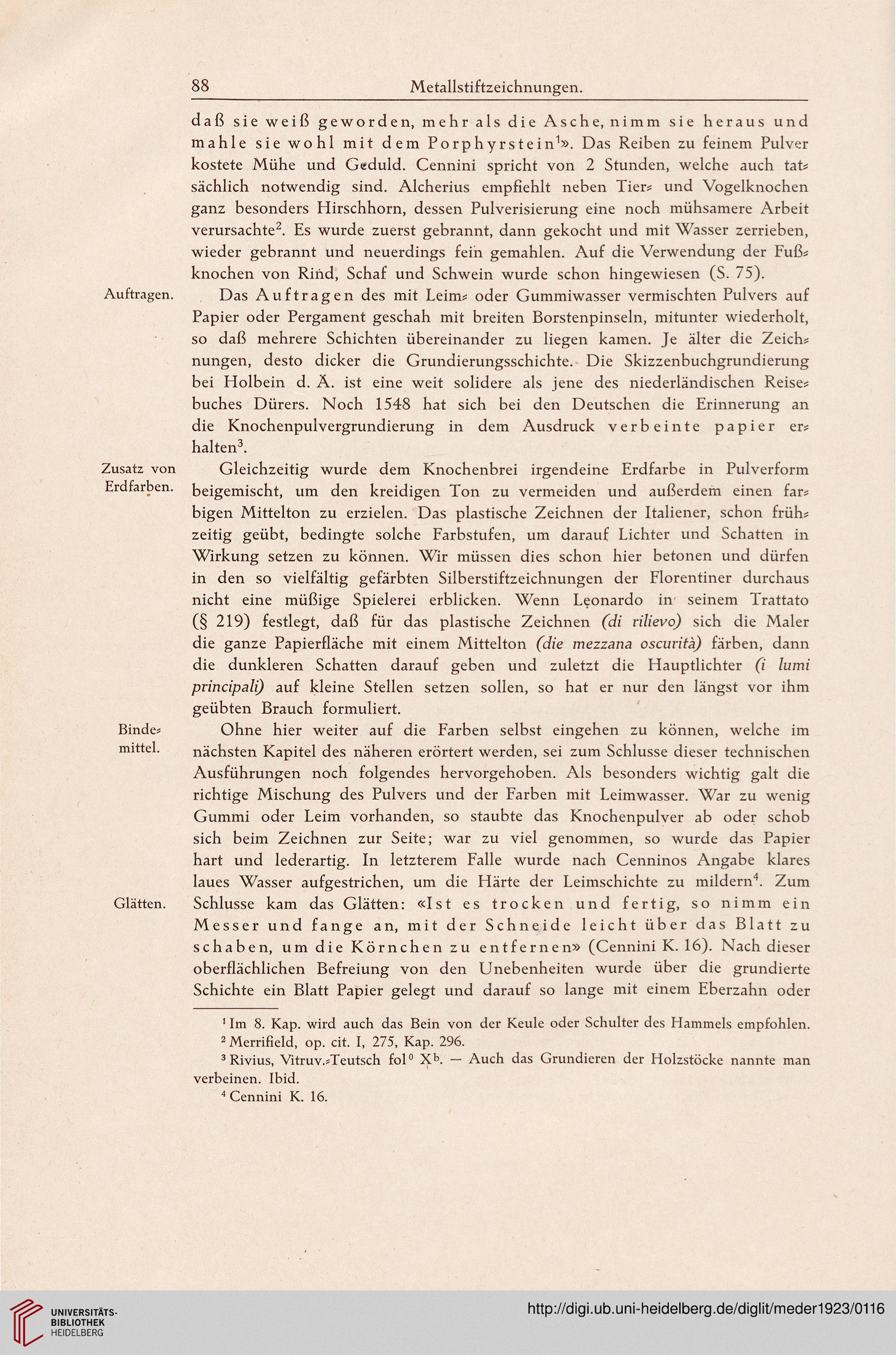88
Metallstiftzeichnungen.
Zusatz von
Erdfarben.
daß sie weiß geworden, mehr als die Asche, nimm sie heraus und
mahle sie wohl mit dem Porphyrstein1». Das Reiben zu feinem Pulver
kostete Mühe und Geduld. Cennini spricht von 2 Stunden, welche auch tat*
sächlich notwendig sind. Alcherius empfiehlt neben Tiers und Vogelknochen
ganz besonders Hirschhorn, dessen Pulverisierung eine noch mühsamere Arbeit
verursachte2. Es wurde zuerst gebrannt, dann gekocht und mit Wasser zerrieben,
wieder gebrannt und neuerdings fein gemahlen. Auf die Verwendung der Fuß;
knochen von Rind, Schaf und Schwein wurde schon hingewiesen (S. 75).
Auftragen. Das Auftragen des mit Leim* oder Gummiwasser vermischten Pulvers auf
Papier oder Pergament geschah mit breiten Borstenpinseln, mitunter wiederholt,
so daß mehrere Schichten übereinander zu liegen kamen. Je älter die Zeich*
nungen, desto dicker die Grundierungsschichte. Die Skizzenbuchgrundierung
bei Holbein d. Ä. ist eine weit solidere als jene des niederländischen Reise*
buches Dürers. Noch 1548 hat sich bei den Deutschen die Erinnerung an
die Knochenpulvergrundierung in dem Ausdruck verbeinte papier er*
halten3.
Gleichzeitig wurde dem Knochenbrei irgendeine Erdfarbe in Pulverform
beigemischt, um den kreidigen Ton zu vermeiden und außerdem einen far*
bigen Mittelton zu erzielen. Das plastische Zeichnen der Italiener, schon früh*
zeitig geübt, bedingte solche Farbstufen, um darauf Lichter und Schatten in
Wirkung setzen zu können. Wir müssen dies schon hier betonen und dürfen
in den so vielfältig gefärbten Silberstiftzeichnungen der Florentiner durchaus
nicht eine müßige Spielerei erblicken. Wenn Leonardo in seinem Trattato
(§ 219) festlegt, daß für das plastische Zeichnen (di vüievo) sich die Maler
die ganze Papierfläche mit einem Mittelton (die mezzana oscuritä) färben, dann
die dunkleren Schatten darauf geben und zuletzt die Hauptlichter (i lumi
principali) auf kleine Stellen setzen sollen, so hat er nur den längst vor ihm
geübten Brauch formuliert.
Ohne hier weiter auf die Farben selbst eingehen zu können, welche im
nächsten Kapitel des näheren erörtert werden, sei zum Schlüsse dieser technischen
Ausführungen noch folgendes hervorgehoben. Als besonders wichtig galt die
richtige Mischung des Pulvers und der Farben mit Leimwasser. War zu wenig
Gummi oder Leim vorhanden, so staubte das Knochenpulver ab oder schob
sich beim Zeichnen zur Seite; war zu viel genommen, so wurde das Papier
hart und lederartig. In letzterem Falle wurde nach Cenninos Angabe klares
laues Wasser aufgestrichen, um die Härte der Leimschichte zu mildern4. Zum
Glätten. Schlüsse kam das Glätten: «Ist es trocken und fertig, so nimm ein
Messer und fange an, mit der Schneide leicht über das Blatt zu
schaben, um die Körnchen zu entfernen» (Cennini K. 16). Nach dieser
oberflächlichen Befreiung von den Unebenheiten wurde über die grundierte
Schichte ein Blatt Papier gelegt und darauf so lange mit einem Eberzahn oder
Binde*
mittel.
1 Im 8. Kap. wird auch das Bein von der Keule oder Schulter des Hammels empfohlen.
2 Merrifield, op. cit. I, 275, Kap. 296.
3Rivius, Vitruv.*Teutsch fol° Xb. — Auch das Grundieren der Holzstöcke nannte man
verbeinen. Ibid.
4 Cennini K. 16.
Metallstiftzeichnungen.
Zusatz von
Erdfarben.
daß sie weiß geworden, mehr als die Asche, nimm sie heraus und
mahle sie wohl mit dem Porphyrstein1». Das Reiben zu feinem Pulver
kostete Mühe und Geduld. Cennini spricht von 2 Stunden, welche auch tat*
sächlich notwendig sind. Alcherius empfiehlt neben Tiers und Vogelknochen
ganz besonders Hirschhorn, dessen Pulverisierung eine noch mühsamere Arbeit
verursachte2. Es wurde zuerst gebrannt, dann gekocht und mit Wasser zerrieben,
wieder gebrannt und neuerdings fein gemahlen. Auf die Verwendung der Fuß;
knochen von Rind, Schaf und Schwein wurde schon hingewiesen (S. 75).
Auftragen. Das Auftragen des mit Leim* oder Gummiwasser vermischten Pulvers auf
Papier oder Pergament geschah mit breiten Borstenpinseln, mitunter wiederholt,
so daß mehrere Schichten übereinander zu liegen kamen. Je älter die Zeich*
nungen, desto dicker die Grundierungsschichte. Die Skizzenbuchgrundierung
bei Holbein d. Ä. ist eine weit solidere als jene des niederländischen Reise*
buches Dürers. Noch 1548 hat sich bei den Deutschen die Erinnerung an
die Knochenpulvergrundierung in dem Ausdruck verbeinte papier er*
halten3.
Gleichzeitig wurde dem Knochenbrei irgendeine Erdfarbe in Pulverform
beigemischt, um den kreidigen Ton zu vermeiden und außerdem einen far*
bigen Mittelton zu erzielen. Das plastische Zeichnen der Italiener, schon früh*
zeitig geübt, bedingte solche Farbstufen, um darauf Lichter und Schatten in
Wirkung setzen zu können. Wir müssen dies schon hier betonen und dürfen
in den so vielfältig gefärbten Silberstiftzeichnungen der Florentiner durchaus
nicht eine müßige Spielerei erblicken. Wenn Leonardo in seinem Trattato
(§ 219) festlegt, daß für das plastische Zeichnen (di vüievo) sich die Maler
die ganze Papierfläche mit einem Mittelton (die mezzana oscuritä) färben, dann
die dunkleren Schatten darauf geben und zuletzt die Hauptlichter (i lumi
principali) auf kleine Stellen setzen sollen, so hat er nur den längst vor ihm
geübten Brauch formuliert.
Ohne hier weiter auf die Farben selbst eingehen zu können, welche im
nächsten Kapitel des näheren erörtert werden, sei zum Schlüsse dieser technischen
Ausführungen noch folgendes hervorgehoben. Als besonders wichtig galt die
richtige Mischung des Pulvers und der Farben mit Leimwasser. War zu wenig
Gummi oder Leim vorhanden, so staubte das Knochenpulver ab oder schob
sich beim Zeichnen zur Seite; war zu viel genommen, so wurde das Papier
hart und lederartig. In letzterem Falle wurde nach Cenninos Angabe klares
laues Wasser aufgestrichen, um die Härte der Leimschichte zu mildern4. Zum
Glätten. Schlüsse kam das Glätten: «Ist es trocken und fertig, so nimm ein
Messer und fange an, mit der Schneide leicht über das Blatt zu
schaben, um die Körnchen zu entfernen» (Cennini K. 16). Nach dieser
oberflächlichen Befreiung von den Unebenheiten wurde über die grundierte
Schichte ein Blatt Papier gelegt und darauf so lange mit einem Eberzahn oder
Binde*
mittel.
1 Im 8. Kap. wird auch das Bein von der Keule oder Schulter des Hammels empfohlen.
2 Merrifield, op. cit. I, 275, Kap. 296.
3Rivius, Vitruv.*Teutsch fol° Xb. — Auch das Grundieren der Holzstöcke nannte man
verbeinen. Ibid.
4 Cennini K. 16.