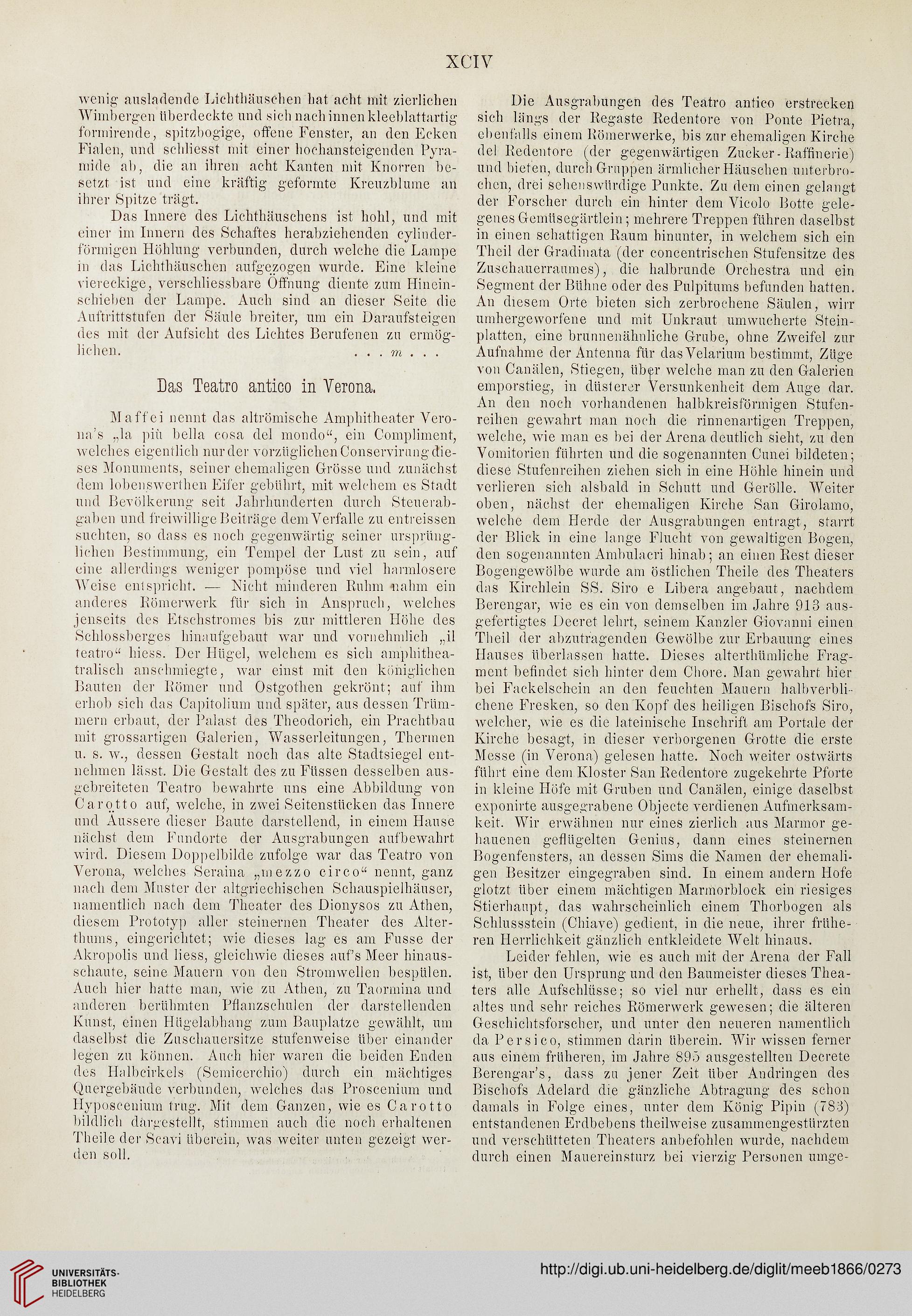xeiv
wenig ausladende Lichthäuschen bat acht mit zierlichen
Wimbergen überdeckte und sich nach innen kleeblattartig
formirende, spitzbogige, offene Fenster, an den Ecken
Fialen, und schliesst mit einer hochansteigenden Pyra-
mide ab, die an Ihren acht Kanten mit Knorren be-
setzt ist und eine kräftig geformte Kreuzblume an
ihrer Spitze trägt.
Das Innere des Lichthäuschens ist hohl, und mit
einer im Innern des Schaftes herabziehenden cylinder-
förmigen Höhlung verbunden, durch welche die Lampe
in das Lichthäuschen aufgezogen wurde. Eine kleine
viereckige, verschliessbare Öffnung diente zum Hinein-
schieben der Lampe. Auch sind an dieser Seite die
Auftrittstufen der Säule breiter, um ein Daraufsteigen
des mit der Aufsicht des Lichtes Berufenen zu ermög-
lichen. . . . m . . .
Das Teatro antico in Verona.
M aff ei nennt das altrömische Amphitheater Vcro-
na’s „la piü bella cosa del mondo“, ein Compliment,
welches eigentlich nur der vorzüglichen Conservirung die-
ses Monuments, seiner ehemaligen Grösse und zunächst
dem lobenswerthen Eifer gebührt, mit welchem es Stadt
und Bevölkerung seit Jahrhunderten durch Steuerab-
gaben und freiwillige Beiträge dem Verfalle zu entreissen
suchten, so dass es noch gegenwärtig seiner ursprüng-
lichen Bestimmung, ein Tempel der Lust zu sein, auf
eine allerdings weniger pompöse und viel harmlosere
Weise entspricht. — Nicht minderen Ruhm nahm ein
anderes Römerwerk für sich in Anspruch, welches
jenseits des Etschstromes bis zur mittleren Höhe des
Schlossberges hinaufgebaut war und vornehmlich „il
teatro“ hiess. Der Hügel, welchem es sich amphithea-
tralisch anschmiegte, war einst mit den königlichen
Bauten der Römer und Ostgothen gekrönt; auf ihm
erhob sich das Capitolium und später, aus dessen Trüm-
mern erbaut, der Palast des Theodorich, ein Prachtbau
mit grossartigen Galerien, Wasserleitungen, Thermen
u. s. w., dessen Gestalt noch das alte Stadtsiegel ent-
nehmen lässt. Die Gestalt des zu Füssen desselben aus-
gebreiteten Teatro bewahrte uns eine Abbildung von
Carotto auf, welche, in zwei Seitenstücken das Innere
und Äussere dieser Baute darstellend, in einem Hause
nächst dem Fundorte der Ausgrabungen aufbewahrt
wird. Diesem Doppelbilde zufolge war das Teatro von
Verona, welches Seraina „mezzo circo“ nennt, ganz
nach dem Muster der altgriechischen Schauspielhäuser,
namentlich nach dem Theater des Dionysos zu Athen,
diesem Prototyp aller steinernen Theater des Alter-
tlmms, eingerichtet; wie dieses lag es am Fusse der
Akropolis und liess, gleichwie dieses auf’s Meer hinaus-
schaute, seine Mauern von den Stromwellen bespülen.
Auch hier hatte man, wie zu Athen, zu Taormina und
anderen berühmten Pflanzschulen der darstellenden
Kunst, einen Hügelabhang zum Bauplatze gewählt, um
daselbst die Zuschauersitze stufenweise über einander
legen zu können. Auch hier waren die beiden Enden
des Halbcirkels (Semicerchio) durch ein mächtiges
Quergebäude verbunden, welches das Proscenium und
Hyposcenium trug. Mit dem Ganzen, wie es Carotto
bildlich dargestellt, stimmen auch die noch erhaltenen
Theile der Scavi überein, was weiter unten gezeigt wer-
den soll.
Die Ausgrabungen des Teatro antico erstrecken
sich längs der Regaste Redentore von Ponte Pietra,
ebenfalls einem Römerwerke, bis zur ehemaligen Kirche
del Redentore (der gegenwärtigen Zucker-Raffinerie)
und bieten, durch Gruppen ärmlicher Häuschen unterbro-
chen, drei sehenswürdige Punkte. Zu dem einen gelangt
der Forscher durch ein hinter dem Vicolo Botte gele-
genes Gemüsegärtlein; mehrere Treppen führen daselbst
in einen schattigen Raum hinunter, in welchem sich ein
Theil der Gradinata (der concentrischen Stufensitze des
Zuschauerraumes), die halbrunde Orchestra und ein
Segment der Bühne oder des Pulpitums befunden hatten.
An diesem Orte bieten sich zerbrochene Säulen, wirr
umhergeworfene und mit Unkraut umwucherte Stein-
platten, eine brunnenähnliche Grube, ohne Zweifel zur
Aufnahme der Antenna für das Velarium bestimmt, Züge
von Canälen, Stiegen, über welche man zu den Galerien
emporstieg, in düsterer Versunkenheit dem Auge dar.
An den noch vorhandenen halbkreisförmigen Stufen-
reihen gewahrt man noch die rinnenartigen Treppen,
welche, wie man es bei der Arena deutlich sieht, zu den
Vomitorien führten und die sogenannten Cunei bildeten;
diese Stufenreihen ziehen sich in eine Höhle hinein und
verlieren sich alsbald in Schutt und Gerolle. Weiter
oben, nächst der ehemaligen Kirche San Girolamo,
welche dem Herde der Ausgrabungen entragt, starrt
der Blick in eine lange Flucht von gewaltigen Bogen,
den sogenannten Ambulacri hinab; an einen Rest dieser
Bogengewölbe wurde am östlichen Theile des Theaters
das Kirchlein SS. Siro e Libera angebaut, nachdem
Berengar, wie es ein von demselben im Jahre 913 aus-
gefertigtes Decret lehrt, seinem Kanzler Giovanni einen
Theil der abzutragenden Gewölbe zur Erbauung eines
Hauses überlassen hatte. Dieses alterthümliche Frag-
ment befindet sich hinter dem Chore. Man gewahrt hier
bei Fackelschein an den feuchten Mauern halbverbli-
chene Fresken, so den Kopf des heiligen Bischofs Siro,
welcher, wie es die lateinische Inschrift am Portale der
Kirche besagt, in dieser verborgenen Grotte die erste
Messe (in Verona) gelesen hatte. Noch weiter ostwärts
führt eine dem Kloster San Redentore zugekehrte Pforte
in kleine Höfe mit Gruben und Canälen, einige daselbst
exponirte ausgegrabene Objecte verdienen Aufmerksam-
keit. Wir erwähnen nur eines zierlich aus Marmor ge-
hauenen geflügelten Genius, dann eines steinernen
Bogenfensters, an dessen Sims die Namen der ehemali-
gen Besitzer eingegraben sind. In einem andern Hofe
glotzt über einem mächtigen Marmorblock ein riesiges
Stierhaupt, das wahrscheinlich einem Thorbogen als
Schlussstein (Clffave) gedient, in die neue, ihrer frühe-
ren Herrlichkeit gänzlich entkleidete Welt hinaus.
Leider fehlen, wie es auch mit der Arena der Fall
ist, über den Ursprung und den Baumeister dieses Thea-
ters alle Aufschlüsse; so viel nur erhellt, dass es ein
altes und sehr reiches Römerwerk gewesen; die älteren
Geschichtsforscher, und unter den neueren namentlich
da Persico, stimmen darin überein. Wir wissen ferner
aus einem früheren, im Jahre 895 ausgestellten Decrete
Berengar’s, dass zu jener Zeit über Andringen des
Bischofs Adelard die gänzliche Abtragung des schon
damals in Folge eines, unter dem König Pipiu (783)
entstandenen Erdbebens theilweise zusammengestürzten
und verschütteten Theaters anbefohlen wurde, nachdem
durch einen Mauereinsturz bei vierzig Personen umge-
wenig ausladende Lichthäuschen bat acht mit zierlichen
Wimbergen überdeckte und sich nach innen kleeblattartig
formirende, spitzbogige, offene Fenster, an den Ecken
Fialen, und schliesst mit einer hochansteigenden Pyra-
mide ab, die an Ihren acht Kanten mit Knorren be-
setzt ist und eine kräftig geformte Kreuzblume an
ihrer Spitze trägt.
Das Innere des Lichthäuschens ist hohl, und mit
einer im Innern des Schaftes herabziehenden cylinder-
förmigen Höhlung verbunden, durch welche die Lampe
in das Lichthäuschen aufgezogen wurde. Eine kleine
viereckige, verschliessbare Öffnung diente zum Hinein-
schieben der Lampe. Auch sind an dieser Seite die
Auftrittstufen der Säule breiter, um ein Daraufsteigen
des mit der Aufsicht des Lichtes Berufenen zu ermög-
lichen. . . . m . . .
Das Teatro antico in Verona.
M aff ei nennt das altrömische Amphitheater Vcro-
na’s „la piü bella cosa del mondo“, ein Compliment,
welches eigentlich nur der vorzüglichen Conservirung die-
ses Monuments, seiner ehemaligen Grösse und zunächst
dem lobenswerthen Eifer gebührt, mit welchem es Stadt
und Bevölkerung seit Jahrhunderten durch Steuerab-
gaben und freiwillige Beiträge dem Verfalle zu entreissen
suchten, so dass es noch gegenwärtig seiner ursprüng-
lichen Bestimmung, ein Tempel der Lust zu sein, auf
eine allerdings weniger pompöse und viel harmlosere
Weise entspricht. — Nicht minderen Ruhm nahm ein
anderes Römerwerk für sich in Anspruch, welches
jenseits des Etschstromes bis zur mittleren Höhe des
Schlossberges hinaufgebaut war und vornehmlich „il
teatro“ hiess. Der Hügel, welchem es sich amphithea-
tralisch anschmiegte, war einst mit den königlichen
Bauten der Römer und Ostgothen gekrönt; auf ihm
erhob sich das Capitolium und später, aus dessen Trüm-
mern erbaut, der Palast des Theodorich, ein Prachtbau
mit grossartigen Galerien, Wasserleitungen, Thermen
u. s. w., dessen Gestalt noch das alte Stadtsiegel ent-
nehmen lässt. Die Gestalt des zu Füssen desselben aus-
gebreiteten Teatro bewahrte uns eine Abbildung von
Carotto auf, welche, in zwei Seitenstücken das Innere
und Äussere dieser Baute darstellend, in einem Hause
nächst dem Fundorte der Ausgrabungen aufbewahrt
wird. Diesem Doppelbilde zufolge war das Teatro von
Verona, welches Seraina „mezzo circo“ nennt, ganz
nach dem Muster der altgriechischen Schauspielhäuser,
namentlich nach dem Theater des Dionysos zu Athen,
diesem Prototyp aller steinernen Theater des Alter-
tlmms, eingerichtet; wie dieses lag es am Fusse der
Akropolis und liess, gleichwie dieses auf’s Meer hinaus-
schaute, seine Mauern von den Stromwellen bespülen.
Auch hier hatte man, wie zu Athen, zu Taormina und
anderen berühmten Pflanzschulen der darstellenden
Kunst, einen Hügelabhang zum Bauplatze gewählt, um
daselbst die Zuschauersitze stufenweise über einander
legen zu können. Auch hier waren die beiden Enden
des Halbcirkels (Semicerchio) durch ein mächtiges
Quergebäude verbunden, welches das Proscenium und
Hyposcenium trug. Mit dem Ganzen, wie es Carotto
bildlich dargestellt, stimmen auch die noch erhaltenen
Theile der Scavi überein, was weiter unten gezeigt wer-
den soll.
Die Ausgrabungen des Teatro antico erstrecken
sich längs der Regaste Redentore von Ponte Pietra,
ebenfalls einem Römerwerke, bis zur ehemaligen Kirche
del Redentore (der gegenwärtigen Zucker-Raffinerie)
und bieten, durch Gruppen ärmlicher Häuschen unterbro-
chen, drei sehenswürdige Punkte. Zu dem einen gelangt
der Forscher durch ein hinter dem Vicolo Botte gele-
genes Gemüsegärtlein; mehrere Treppen führen daselbst
in einen schattigen Raum hinunter, in welchem sich ein
Theil der Gradinata (der concentrischen Stufensitze des
Zuschauerraumes), die halbrunde Orchestra und ein
Segment der Bühne oder des Pulpitums befunden hatten.
An diesem Orte bieten sich zerbrochene Säulen, wirr
umhergeworfene und mit Unkraut umwucherte Stein-
platten, eine brunnenähnliche Grube, ohne Zweifel zur
Aufnahme der Antenna für das Velarium bestimmt, Züge
von Canälen, Stiegen, über welche man zu den Galerien
emporstieg, in düsterer Versunkenheit dem Auge dar.
An den noch vorhandenen halbkreisförmigen Stufen-
reihen gewahrt man noch die rinnenartigen Treppen,
welche, wie man es bei der Arena deutlich sieht, zu den
Vomitorien führten und die sogenannten Cunei bildeten;
diese Stufenreihen ziehen sich in eine Höhle hinein und
verlieren sich alsbald in Schutt und Gerolle. Weiter
oben, nächst der ehemaligen Kirche San Girolamo,
welche dem Herde der Ausgrabungen entragt, starrt
der Blick in eine lange Flucht von gewaltigen Bogen,
den sogenannten Ambulacri hinab; an einen Rest dieser
Bogengewölbe wurde am östlichen Theile des Theaters
das Kirchlein SS. Siro e Libera angebaut, nachdem
Berengar, wie es ein von demselben im Jahre 913 aus-
gefertigtes Decret lehrt, seinem Kanzler Giovanni einen
Theil der abzutragenden Gewölbe zur Erbauung eines
Hauses überlassen hatte. Dieses alterthümliche Frag-
ment befindet sich hinter dem Chore. Man gewahrt hier
bei Fackelschein an den feuchten Mauern halbverbli-
chene Fresken, so den Kopf des heiligen Bischofs Siro,
welcher, wie es die lateinische Inschrift am Portale der
Kirche besagt, in dieser verborgenen Grotte die erste
Messe (in Verona) gelesen hatte. Noch weiter ostwärts
führt eine dem Kloster San Redentore zugekehrte Pforte
in kleine Höfe mit Gruben und Canälen, einige daselbst
exponirte ausgegrabene Objecte verdienen Aufmerksam-
keit. Wir erwähnen nur eines zierlich aus Marmor ge-
hauenen geflügelten Genius, dann eines steinernen
Bogenfensters, an dessen Sims die Namen der ehemali-
gen Besitzer eingegraben sind. In einem andern Hofe
glotzt über einem mächtigen Marmorblock ein riesiges
Stierhaupt, das wahrscheinlich einem Thorbogen als
Schlussstein (Clffave) gedient, in die neue, ihrer frühe-
ren Herrlichkeit gänzlich entkleidete Welt hinaus.
Leider fehlen, wie es auch mit der Arena der Fall
ist, über den Ursprung und den Baumeister dieses Thea-
ters alle Aufschlüsse; so viel nur erhellt, dass es ein
altes und sehr reiches Römerwerk gewesen; die älteren
Geschichtsforscher, und unter den neueren namentlich
da Persico, stimmen darin überein. Wir wissen ferner
aus einem früheren, im Jahre 895 ausgestellten Decrete
Berengar’s, dass zu jener Zeit über Andringen des
Bischofs Adelard die gänzliche Abtragung des schon
damals in Folge eines, unter dem König Pipiu (783)
entstandenen Erdbebens theilweise zusammengestürzten
und verschütteten Theaters anbefohlen wurde, nachdem
durch einen Mauereinsturz bei vierzig Personen umge-