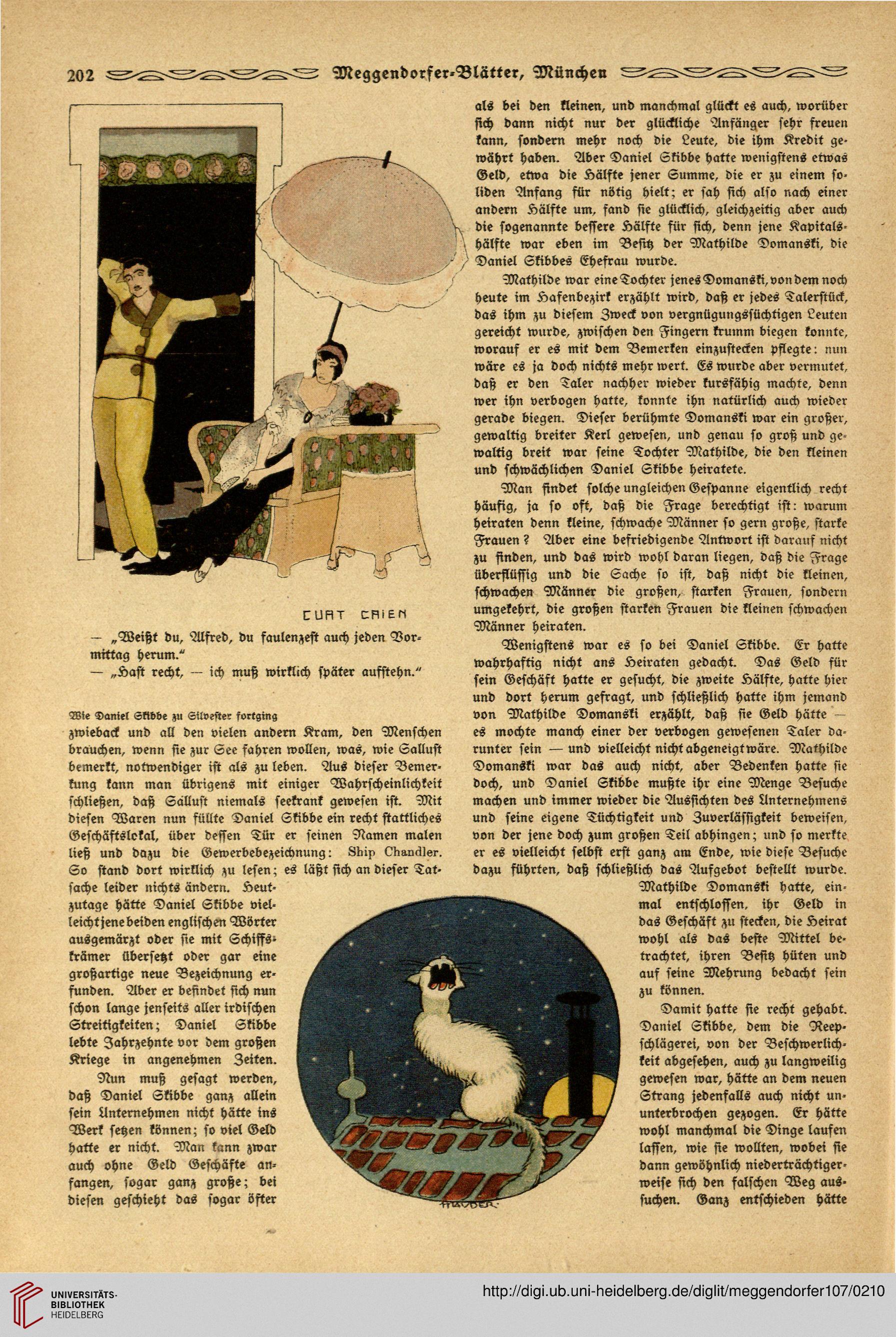202
Meggendorfer-Blätter, Müncheu
— „Weißk du, Wfred, du faulenzest auch jeden Dor-
mittag herum."
— „Äast recht, - ich muß wirklich später aufstehn."
Wie Daniel Sktbbe zu Silvester fortging
zwieback und all den vielen andern Kram, den Menschen
brauchen, wenn sie zur See fahren wollen, was, wie Sallust
bemerkt, notwendiger ist als zu leben. Aus dieser Bemer-
kung kann man übrigens mit einiger Wahrscheinlichkeit
schließen, daß Sälluft niemals seekrank geweien ist. Mit
diefen Waren nun füllte Daniel Skibbe ein recht stattliches
Geschäftslokal, üder deffen Tür er seinen Namen malen
ließ und dazu die Gewerbebezeichnung: 8t>ig 6bg.näler.
So stand dort wirklich zu lesen; es läßt sich an diefer Tat-
sache leider nichts ändern. Äeut-
zutage hätte Daniel Skibbe viel-
leichtjenebeiden englischen Wörter
ausgemärzt oder sie mit Schiffs-
krämer übersetzt oder gar eine
großartige neue Bezeichnung er-
funden. Aber er befindet sich nun
schon lange jenseits aller irdischen
Streitigkeiten; Daniel Skibbe
lebte Jahrzehnte vor dem großen
Kriege in angenehmen Zeiten.
Nun muß gefagt werden,
daß Daniel Skibbe ganz allein
sein Anternehmen nichk hätte ins
Werk setzen können; so viel Geld
hatte er nicht. Man kann zwar
auch ohne Geld Geschäfte an-
fangen, sogar ganz große; bei
diesen geschieht das sogar öster
als bei den kleinen, und manchmal glückt es auch, worüber
fich dann nicht nur der glückliche Anfänger sehr freuen
kann, sondern mehr noch die Leute, die ihm Kredit ge-
währt haben. Aber Daniel Skibbe hatte wenigftens etwas
Geld, etwa die Kälfte jener Summe, die er zu einem so-
liden Anfang für nötig hielt; er sah sich also nach einer
andern Lälfte um, fand sie glücklich, gleichzeitig aber auch
die sogenannte bessere Lälfte für sich, denn jene Kapitals-
hälfte war eben im Besitz der Mathilde Domanski, die
Daniel Skibbes Ehefrau wurde.
Mathilde war eineTochter jenesDomanski,vondein noch
heute im Lafenbezirk erzählt wird, daß er jedes Talerstück,
das ihm zu diesem Zweck von vergnügungssüchtigen Leuten
gereicht wurde, zwischen den Fingern krumm bicgen konnte,
worauf er es mit dem Bemerken einzustecken pflegte: nun
wäre es ja doch nickts mehr wert. Es wurde aber vermutet,
daß er den Taler nachher wieder kursfähig machte, denn
wer ihn verbogen hatte, konnte ihn natürlich auch wieder
gerade biegen. Dieser berühmte Domanski war ein großer,
gewaltig breiter Kerl gewesen, und genau so groß und ge°
waltig breit war seine Tochter Mathilde, die den kleinen
und schwächlichen Daniel Skibbe heiratete.
Man findet solche ungleichen Gespanne eigentlich recht
häufig, ja so ofi, daß die Frage berechtigt ist: warum
heiraten denn kleine, fchwache Männer fo gern große, starke
Frauen ? Aber eine befriedigende Antwort ist darauf nicht
zu finden, und das wird wohl daran liegen, daß die Frage
überflüssig und die Sache so ist, daß nicht die kleinen,
schwachen Männer die großen, starken Frauen, sondern
umgekehrt, die großen starken Frauen die kleinen schwachen
Männer heiraten.
Wenigstens war es so bei Daniel Skibbe. Er hatte
wahrhaftig nicht ans Leiraten gedacht. Das Geld für
sein Geschäft hatte er gesucht, die zweite Äälfte, hatte hier
und dort herum gefragt, und schließlich hatte ihm jemand
von Mathilde Domanski erzählt, daß sie Geld hätte —
es mochte manch einer der verbogen gewesenen Taler da-
runter sein —und vielleicht nicht abgeneigtwäre. Mathilde
Domanski war das auch nicht, aber Bedenken hatte sie
doch, und Daniel Skibbe mußte ihr eine Menge Befuche
machen und immer wieder die Ausfichten des Anternehmens
und seine eigene Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit beweisen,
von der jene doch zum großen Teil abhingen; und so merkte
er es vielleicht selbst erst ganz am Ende, wie diese Besuche
dazu führten, daß schließlich das Aufgebot bestellt wurde.
Mathilde Domanski hatte, ein-
mal entschloffen, ihr Geld in
das Geschäft zu stecken, die Leirat
wohl als das beste Mittel be-
trachtet, ihren Befitz hüten und
auf seine Mehrung bedacht sein
zu können.
Damit hatte sie recht gehabt.
Daniel Skibbe, dem die Reep-
schlägeret, von der Beschwerlich-
keit abgesehen, auch zu langweilig
gewesen war, hätte an dem neuen
Strang jedenfalls auch nicht un-
unterbrochen gezogen. Er hätte
wohl manchmal die Dinge lausen
laffen, wie sie wollten, wobei sie
dann gewöhnlich niederträchtiger-
weise sich den falschen Weg aus-
suchen. Ganz entfchieden hätte
Meggendorfer-Blätter, Müncheu
— „Weißk du, Wfred, du faulenzest auch jeden Dor-
mittag herum."
— „Äast recht, - ich muß wirklich später aufstehn."
Wie Daniel Sktbbe zu Silvester fortging
zwieback und all den vielen andern Kram, den Menschen
brauchen, wenn sie zur See fahren wollen, was, wie Sallust
bemerkt, notwendiger ist als zu leben. Aus dieser Bemer-
kung kann man übrigens mit einiger Wahrscheinlichkeit
schließen, daß Sälluft niemals seekrank geweien ist. Mit
diefen Waren nun füllte Daniel Skibbe ein recht stattliches
Geschäftslokal, üder deffen Tür er seinen Namen malen
ließ und dazu die Gewerbebezeichnung: 8t>ig 6bg.näler.
So stand dort wirklich zu lesen; es läßt sich an diefer Tat-
sache leider nichts ändern. Äeut-
zutage hätte Daniel Skibbe viel-
leichtjenebeiden englischen Wörter
ausgemärzt oder sie mit Schiffs-
krämer übersetzt oder gar eine
großartige neue Bezeichnung er-
funden. Aber er befindet sich nun
schon lange jenseits aller irdischen
Streitigkeiten; Daniel Skibbe
lebte Jahrzehnte vor dem großen
Kriege in angenehmen Zeiten.
Nun muß gefagt werden,
daß Daniel Skibbe ganz allein
sein Anternehmen nichk hätte ins
Werk setzen können; so viel Geld
hatte er nicht. Man kann zwar
auch ohne Geld Geschäfte an-
fangen, sogar ganz große; bei
diesen geschieht das sogar öster
als bei den kleinen, und manchmal glückt es auch, worüber
fich dann nicht nur der glückliche Anfänger sehr freuen
kann, sondern mehr noch die Leute, die ihm Kredit ge-
währt haben. Aber Daniel Skibbe hatte wenigftens etwas
Geld, etwa die Kälfte jener Summe, die er zu einem so-
liden Anfang für nötig hielt; er sah sich also nach einer
andern Lälfte um, fand sie glücklich, gleichzeitig aber auch
die sogenannte bessere Lälfte für sich, denn jene Kapitals-
hälfte war eben im Besitz der Mathilde Domanski, die
Daniel Skibbes Ehefrau wurde.
Mathilde war eineTochter jenesDomanski,vondein noch
heute im Lafenbezirk erzählt wird, daß er jedes Talerstück,
das ihm zu diesem Zweck von vergnügungssüchtigen Leuten
gereicht wurde, zwischen den Fingern krumm bicgen konnte,
worauf er es mit dem Bemerken einzustecken pflegte: nun
wäre es ja doch nickts mehr wert. Es wurde aber vermutet,
daß er den Taler nachher wieder kursfähig machte, denn
wer ihn verbogen hatte, konnte ihn natürlich auch wieder
gerade biegen. Dieser berühmte Domanski war ein großer,
gewaltig breiter Kerl gewesen, und genau so groß und ge°
waltig breit war seine Tochter Mathilde, die den kleinen
und schwächlichen Daniel Skibbe heiratete.
Man findet solche ungleichen Gespanne eigentlich recht
häufig, ja so ofi, daß die Frage berechtigt ist: warum
heiraten denn kleine, fchwache Männer fo gern große, starke
Frauen ? Aber eine befriedigende Antwort ist darauf nicht
zu finden, und das wird wohl daran liegen, daß die Frage
überflüssig und die Sache so ist, daß nicht die kleinen,
schwachen Männer die großen, starken Frauen, sondern
umgekehrt, die großen starken Frauen die kleinen schwachen
Männer heiraten.
Wenigstens war es so bei Daniel Skibbe. Er hatte
wahrhaftig nicht ans Leiraten gedacht. Das Geld für
sein Geschäft hatte er gesucht, die zweite Äälfte, hatte hier
und dort herum gefragt, und schließlich hatte ihm jemand
von Mathilde Domanski erzählt, daß sie Geld hätte —
es mochte manch einer der verbogen gewesenen Taler da-
runter sein —und vielleicht nicht abgeneigtwäre. Mathilde
Domanski war das auch nicht, aber Bedenken hatte sie
doch, und Daniel Skibbe mußte ihr eine Menge Befuche
machen und immer wieder die Ausfichten des Anternehmens
und seine eigene Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit beweisen,
von der jene doch zum großen Teil abhingen; und so merkte
er es vielleicht selbst erst ganz am Ende, wie diese Besuche
dazu führten, daß schließlich das Aufgebot bestellt wurde.
Mathilde Domanski hatte, ein-
mal entschloffen, ihr Geld in
das Geschäft zu stecken, die Leirat
wohl als das beste Mittel be-
trachtet, ihren Befitz hüten und
auf seine Mehrung bedacht sein
zu können.
Damit hatte sie recht gehabt.
Daniel Skibbe, dem die Reep-
schlägeret, von der Beschwerlich-
keit abgesehen, auch zu langweilig
gewesen war, hätte an dem neuen
Strang jedenfalls auch nicht un-
unterbrochen gezogen. Er hätte
wohl manchmal die Dinge lausen
laffen, wie sie wollten, wobei sie
dann gewöhnlich niederträchtiger-
weise sich den falschen Weg aus-
suchen. Ganz entfchieden hätte