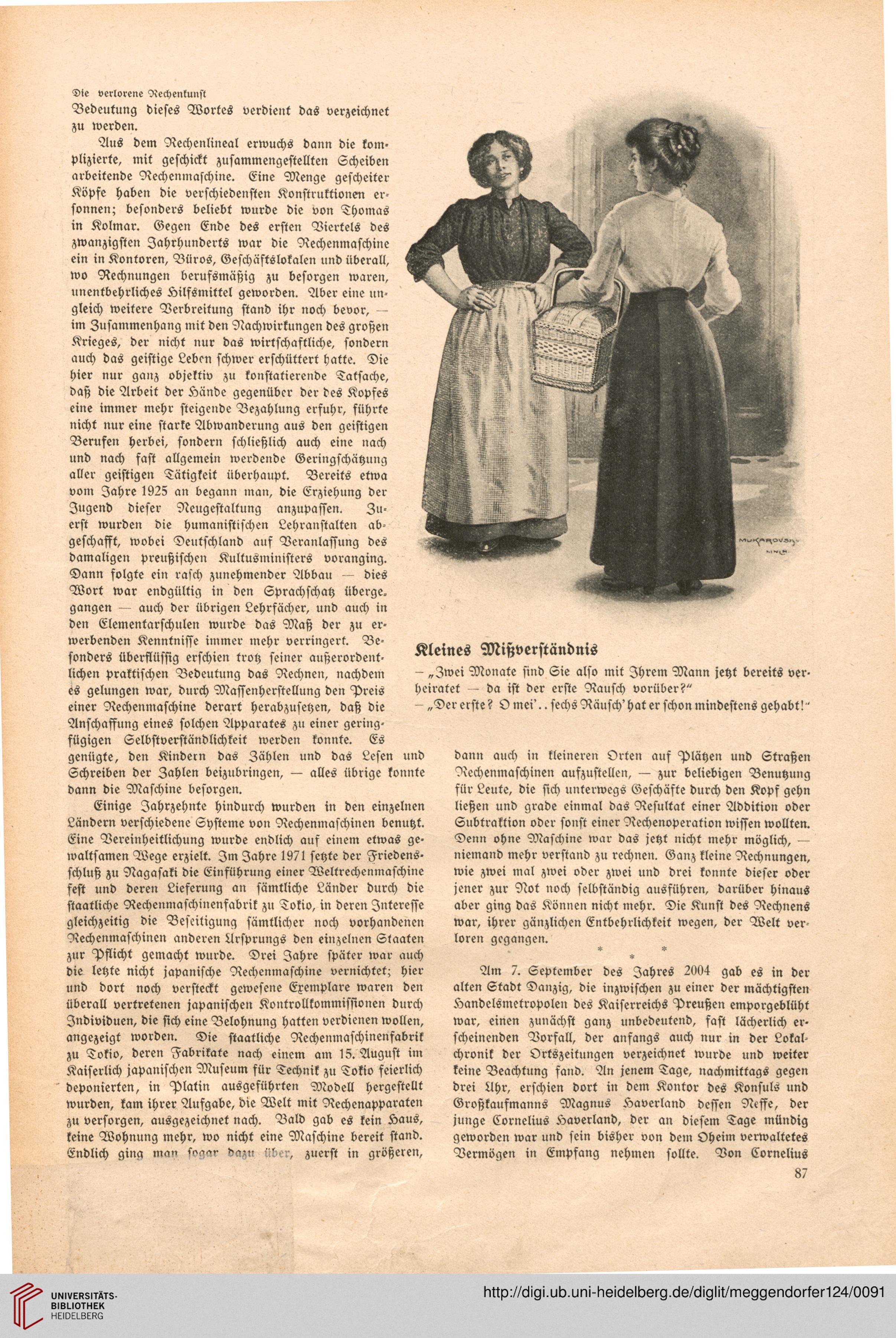Dle verlorene Rechenkunst
Bedeutung dieses Wortes verdient das verzeichnet
zu werden.
Aus dem Rechenlineal erwuchs dann die kom-
plizierte, mit geschickt zusammengestellten Scheiben
arbeitende Nechenmaschine. Eine Menge gescheiter
Köpfe haben die verschiedensten Konstruktionen er-
sonnen; besonders beliebt wurde die von Thomas
in Kolmar. Gegen Ende des ersten Viertels des
zwanzigsten Jahrhunderts war die Rechenmaschine
ein in Kontoren, Vüros, Geschäftslokalen und überall,
wo Rechnungen berussmäßig zu besorgen waren,
unentbehrliches Äilfsmittel geworden. Aber eine un-
gleich weitere Verbreitung stand ihr noch bevor,
im Zusammenhang mit den Nachwirkungen des großen
Krieges, der nicht nur das wirtschaftliche, sondern
auch das geistige Leben schwer erschüttert hatte. Die
hier nur ganz objektiv zu konstatierende Tatsache,
daß die Arbeit der Lände gegenübcr der des Kopfes
eine immer mehr steigende Bezahlung erfuhr, führte
nicht nur eine starke Abwanderung aus den geistigen
Berufen herbei, sondern schließlich auch eine nach
und nach fast allgemein werdende Geringschähung
aller geistigen Tätigkeit überhaupt. Vereits etwa
vom Iahre 1925 an begann man, die Erziehung der
Iugend dieser Neugestaltung anzupassen. Zu-
erst wurden die humanistischen Lehranstalten ab
geschafft, wobei Deutschland auf Veranlassung des
damaligen preußischen Kullusministers voranging.
Dann folgte ein rasch zunehmender Abbau — dies
Mort war endgültig in den Sprachschatz überge.
gangen — auch der übrigen Lehrfächer, und auch in
den Elementarschulen wurde das Maß der zu er-
werbenden Kenntnisse immer mehr verringert. Be-
sonders überssüssig erschien trotz seiner außerordent-
lichen praktischen Bedeutung das Rechnen, nachdem
es gelungen war, durch Massenherstellung den Preis
einer Rechenmaschine derart herabzusehen, daß die
Anschaffung eines solchen Apparates zu einer gering-
fllgigen Selbstverständlichkeit werden konnte. Es
genügte, den Kindern das Zählen und das Lesen und
Schreiben der Zahlen beizubringen, — alles übrige konnte
dann die Maschine besorgen.
Einige Iahrzehnte hindurch wurden in den einzelnen
Ländern verschiedene Systeme von Rechenmaschinen benutzt.
Eine Vereinheitlichung wurde endlich auf einem etwas ge-
waltsamen Wege erzielt. Im Iahre 197l setzte der Friedens-
schluß zu Nagasaki die Einführung einer Weltrechenmaschine
fest und deren Lieserung an sämtliche Länder durch die
staatliche Nechenmaschinenfabrik zu Tokio, in deren Interesse
gleichzeitig die Beseitigung sämtlicher noch vorhandenen
Nechenmaschinen anderen Arsprungs den einzelnen Staaten
zur Pflicht gemacht wurde. Drei Iahre später war auch
die letzte nicht japanische Nechenmaschine vernichtet; hier
und dort noch versteckt gewesene Exemplare waren den
überall vertretenen japanischen Kontrollkommissionen durch
Individuen, die sich eine Belohnung hatten verdienen wollen,
angezeigt worden. Die staatliche Rechenmaschinenfabrik
zu Tokio, deren Fabrikate nach einem am 15. August im
Kaiserlich japanischen Museum für Technik zu Tokio feierlich
deponierten, in Platin ausgeführten Modell hergestellt
wurden, kam ihrer Aufgabe, die Welt mit Rechenapparaten
zu versorgen, ausgezeichnet nach. Bald gab es kein Äaus,
keine Wohnung mehr, wo nicht eine Maschine bereit stand.
Endlich gina mav soaa>- dazn über, zuerst in größeren,
Kleines Mißverständnis
- „Zwei Monate sind Sie also mit Ihrem Mann jetzt bereits ver-
heiratet — da ist der erste Rausch vorüber?"
- „Dererste? Omei'..sechsRäusch'haterschonmindestens gehabt!"
dann auch in kleineren Orten auf Plätzen und Straßen
Rechenmaschinen aufzustellen, — zur beliebigen Benutzung
fllr Leute, die sich unterwegs Geschäfte durch den Kopf gehn
ließen und grade einmal das Resultat einer Addition oder
Subtraktion oder sonst einer Rechenoperation wissen wollten.
Denn ohne Maschine war das jetzt nicht mehr möglich, —
niemand mehr verstand zu rechnen. Ganz kleine Rechnungen,
wie zwei mal zwei oder zwei und drei konnte dieser oder
jener zur Not noch selbständig ausführen, darüber hinaus
aber ging das Können nicht mehr. Die Kunst des Rechnens
war, ihrer gänzlichen Entbehrlichkeit wegen, der Welt ver
loren gegangen.
Am 7. September des Iahres 2004 gab es in der
alten Stadt Danzig, die inzwischen zu einer der mächtigsten
Äandelsmetropolen des Kaiserreichs Preußen emporgeblüht
war, einen zunächst ganz unbedeutend, fast lächerlich er-
scheinenden Vorfall, der ansangs auch nur in der Lokal
chronik der Ortszeitungen verzeichnet wurde und weiter
keine Beachtung fand. An jenem Tage, nachmiktags gegen
drei !lhr, erschien dort in dem Kontor des Konsuls und
Großkaufmanns Magnus Laverland dcssen Neffe, der
junge Cornelius löaverland, der an diesem Tage mündig
geworden war und sein bisher von dem Oheim verwaltetes
Vermögen in Empfang nehmen sollte. Von Cornelius
87
Bedeutung dieses Wortes verdient das verzeichnet
zu werden.
Aus dem Rechenlineal erwuchs dann die kom-
plizierte, mit geschickt zusammengestellten Scheiben
arbeitende Nechenmaschine. Eine Menge gescheiter
Köpfe haben die verschiedensten Konstruktionen er-
sonnen; besonders beliebt wurde die von Thomas
in Kolmar. Gegen Ende des ersten Viertels des
zwanzigsten Jahrhunderts war die Rechenmaschine
ein in Kontoren, Vüros, Geschäftslokalen und überall,
wo Rechnungen berussmäßig zu besorgen waren,
unentbehrliches Äilfsmittel geworden. Aber eine un-
gleich weitere Verbreitung stand ihr noch bevor,
im Zusammenhang mit den Nachwirkungen des großen
Krieges, der nicht nur das wirtschaftliche, sondern
auch das geistige Leben schwer erschüttert hatte. Die
hier nur ganz objektiv zu konstatierende Tatsache,
daß die Arbeit der Lände gegenübcr der des Kopfes
eine immer mehr steigende Bezahlung erfuhr, führte
nicht nur eine starke Abwanderung aus den geistigen
Berufen herbei, sondern schließlich auch eine nach
und nach fast allgemein werdende Geringschähung
aller geistigen Tätigkeit überhaupt. Vereits etwa
vom Iahre 1925 an begann man, die Erziehung der
Iugend dieser Neugestaltung anzupassen. Zu-
erst wurden die humanistischen Lehranstalten ab
geschafft, wobei Deutschland auf Veranlassung des
damaligen preußischen Kullusministers voranging.
Dann folgte ein rasch zunehmender Abbau — dies
Mort war endgültig in den Sprachschatz überge.
gangen — auch der übrigen Lehrfächer, und auch in
den Elementarschulen wurde das Maß der zu er-
werbenden Kenntnisse immer mehr verringert. Be-
sonders überssüssig erschien trotz seiner außerordent-
lichen praktischen Bedeutung das Rechnen, nachdem
es gelungen war, durch Massenherstellung den Preis
einer Rechenmaschine derart herabzusehen, daß die
Anschaffung eines solchen Apparates zu einer gering-
fllgigen Selbstverständlichkeit werden konnte. Es
genügte, den Kindern das Zählen und das Lesen und
Schreiben der Zahlen beizubringen, — alles übrige konnte
dann die Maschine besorgen.
Einige Iahrzehnte hindurch wurden in den einzelnen
Ländern verschiedene Systeme von Rechenmaschinen benutzt.
Eine Vereinheitlichung wurde endlich auf einem etwas ge-
waltsamen Wege erzielt. Im Iahre 197l setzte der Friedens-
schluß zu Nagasaki die Einführung einer Weltrechenmaschine
fest und deren Lieserung an sämtliche Länder durch die
staatliche Nechenmaschinenfabrik zu Tokio, in deren Interesse
gleichzeitig die Beseitigung sämtlicher noch vorhandenen
Nechenmaschinen anderen Arsprungs den einzelnen Staaten
zur Pflicht gemacht wurde. Drei Iahre später war auch
die letzte nicht japanische Nechenmaschine vernichtet; hier
und dort noch versteckt gewesene Exemplare waren den
überall vertretenen japanischen Kontrollkommissionen durch
Individuen, die sich eine Belohnung hatten verdienen wollen,
angezeigt worden. Die staatliche Rechenmaschinenfabrik
zu Tokio, deren Fabrikate nach einem am 15. August im
Kaiserlich japanischen Museum für Technik zu Tokio feierlich
deponierten, in Platin ausgeführten Modell hergestellt
wurden, kam ihrer Aufgabe, die Welt mit Rechenapparaten
zu versorgen, ausgezeichnet nach. Bald gab es kein Äaus,
keine Wohnung mehr, wo nicht eine Maschine bereit stand.
Endlich gina mav soaa>- dazn über, zuerst in größeren,
Kleines Mißverständnis
- „Zwei Monate sind Sie also mit Ihrem Mann jetzt bereits ver-
heiratet — da ist der erste Rausch vorüber?"
- „Dererste? Omei'..sechsRäusch'haterschonmindestens gehabt!"
dann auch in kleineren Orten auf Plätzen und Straßen
Rechenmaschinen aufzustellen, — zur beliebigen Benutzung
fllr Leute, die sich unterwegs Geschäfte durch den Kopf gehn
ließen und grade einmal das Resultat einer Addition oder
Subtraktion oder sonst einer Rechenoperation wissen wollten.
Denn ohne Maschine war das jetzt nicht mehr möglich, —
niemand mehr verstand zu rechnen. Ganz kleine Rechnungen,
wie zwei mal zwei oder zwei und drei konnte dieser oder
jener zur Not noch selbständig ausführen, darüber hinaus
aber ging das Können nicht mehr. Die Kunst des Rechnens
war, ihrer gänzlichen Entbehrlichkeit wegen, der Welt ver
loren gegangen.
Am 7. September des Iahres 2004 gab es in der
alten Stadt Danzig, die inzwischen zu einer der mächtigsten
Äandelsmetropolen des Kaiserreichs Preußen emporgeblüht
war, einen zunächst ganz unbedeutend, fast lächerlich er-
scheinenden Vorfall, der ansangs auch nur in der Lokal
chronik der Ortszeitungen verzeichnet wurde und weiter
keine Beachtung fand. An jenem Tage, nachmiktags gegen
drei !lhr, erschien dort in dem Kontor des Konsuls und
Großkaufmanns Magnus Laverland dcssen Neffe, der
junge Cornelius löaverland, der an diesem Tage mündig
geworden war und sein bisher von dem Oheim verwaltetes
Vermögen in Empfang nehmen sollte. Von Cornelius
87