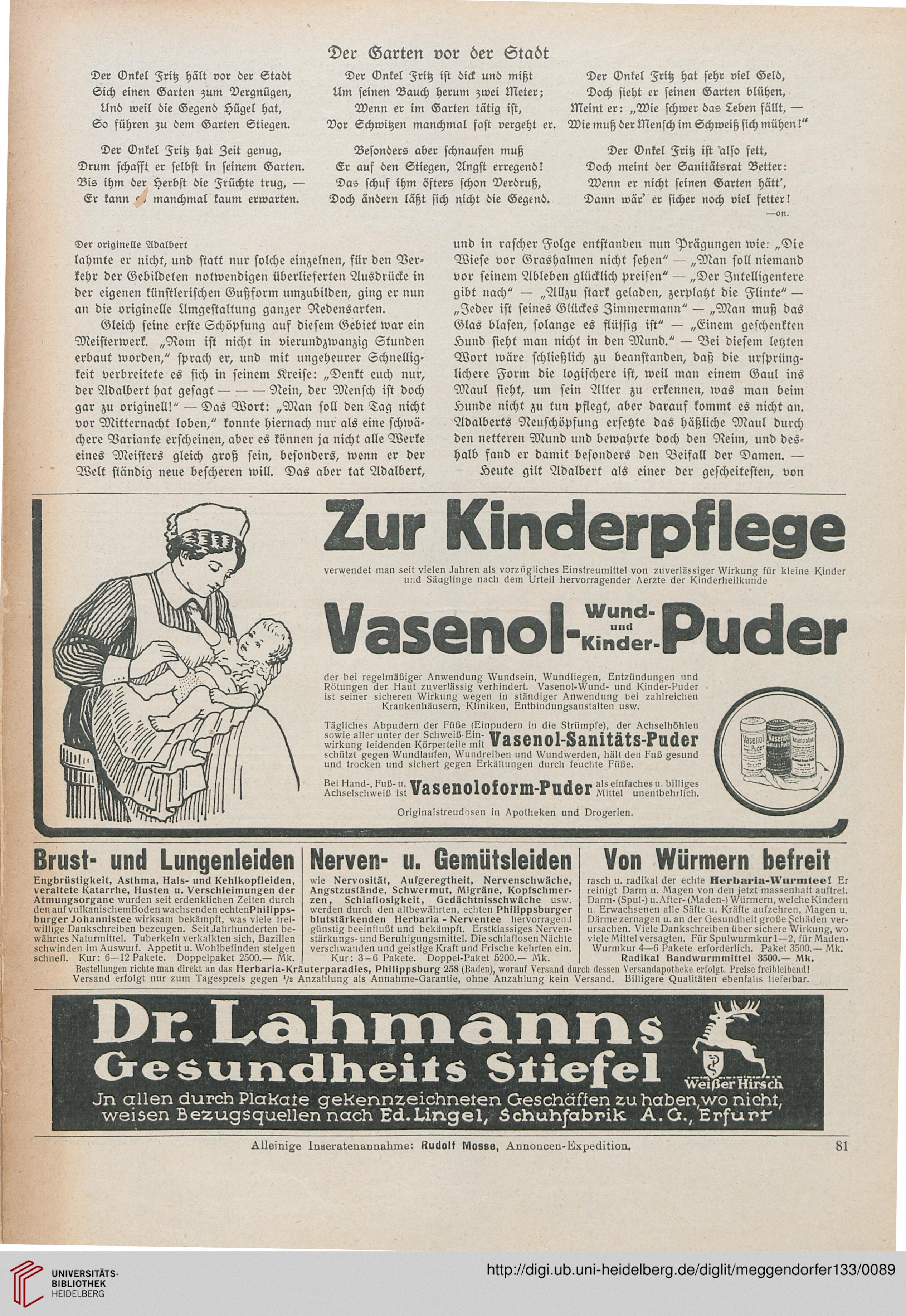Der Vnkel §rih hält vor der Stadt
Sich einen Garten ;um Vergnügen,
Und weil die Gegend Hügel hat,
So führen ;u Lem Garten Stiegen.
Dec Garten vor öer Staöt
Der Dnkel Irih ist Lick unü mißt
Um seinen Bauch herum ;wei Meter;
Wenn er im Garten tätig ist,
Dor Schwitzen manchmal fost vergeht er.
Der Gnkel?ritz hat sehr viel Geld,
Doch sieht er seinen Garten blühen,
Meint er: „Wie schwer das Leben fällt, —
Wie muß der Mensch im Schweiß sich mühen!"
Der Gnkel Iritz hat Zeit genug,
Drum schafft er selbst in seinem Garten.
Bis ihm Ler Herbst die Irüchte trug, —
Gr kann , manchmal kaum erwarten.
Besonders aber schnaufen muß
Lr auf den Stiegen, Angst erregend!
Das schuf ihm öfters schon Berüruß,
Doch ändern läßt sich nicht die Gegend.
Der Gnkel Iritz ist 'also fett,
Doch meint üer Sanitätsrat Better:
Wenn er nicht seinen Garten hätt',
Dann wär' er sicher noch viel fetter!
Der orlginelle Adalbert
lahmte er nicht, und statt nur solche einzelnen, sür den Ver-
kehr der Gebildelen notwendigen überlieferten Ausdrücke in
der eigenen künstlerischen Gußform umzubilden, ging er nun
an die originelle Amgestaltung ganzer Redensarten.
Gleich seine erste Schöpfung auf diesem Gebiet war ein
Meisterwerk. „Rom ist nicht in vierundzwanzig Stunden
erbaut worden," sprach er, und mit ungeheurer Schnellig-
keit verbreitete es sich in seinem Kreise: „Denkt euch nur,
der Adalbert hat gesagt-Nein, der Mensch ist doch
gar zu originell!" — Das Wort: „Man soll den Tag nicht
vor Mitternacht loben," konnte hiernach nur als eine schwä-
chere Variante erscheinen, aber es können ja nicht alle Werke
eines Meisters gleich groß sein, besonders, wenn er der
Welt siändig neue bescheren will. Das aber tat Adalbert,
und in rascher Folge entstanden nun Prägungen wie: „Die
Wiese vor Grashalmen nicht schen" — „Man soll niemand
vor seinem Ableben glücklich preisen" — „Der Intelligentere
gibt nach" — „Allzu stark geladen, zerplatzt die Flinte" —
„Ieder ist seines Glückes Zimmermann" — „Man muß das
Glas blasen, solange es flüssig ist" — „Einem geschenkten
Lund sieht man nicht in den Mund." — Bei diesem letzten
Wort wäre schließlich zu beanstanden, daß die ursprüng-
lichere Form die logischere ist, weil man einem Gaul ins
Maul sieht, um sein Alter zu erkennen, was man beim
Lunde nicht zu tun Pflegt, aber daraus kommt es nicht an.
Adalberts Neuschöpfung ersetzte das häßliche Maul durch
den »etteren Mund und bewahrte doch den Neim, und des-
halb fand er damit besonders den Beifall der Damen. —
Leute gilt Adalbert als einer der gescheitesten, von
2uc liincisrpklsgs
verwenäet man seit vielen äobren 3I8 vorrüxlicties Oinstreumittel von ruverl388l'§er ^VirkunZ lür kleine Kinäer
unä LäuZIin^e ngcli clem Orteil bervorra^encler ^errte äer Kinciertreilkuncie
VsssnoHpuelsr
üer bei re§eImäLi§er -Vnwenäun§ Wunä^ein, VVunälie^en, Lnt^ünäunxen uncl
?ötun§en cier biaut 7.uverIZ88i§ verliinclert. V38enol-V?uncI- unci Kincler-Pucler
i8t 8einer siclieren VVirkunZ cveZen in 8täncli§er /Vnwenäun^ dei ralilreiciien
Kr3nkenträu8ern, Kliniken, Lntbinc1un§83N8l3lten U8W.
sowie aller uiiter äer 8cbwei6 Oin-
wirkun^ leiäenäen Körpeiteile mit » »»vZI vL »ZtLLLL L UU vK
scbütrt 8e§en V/unälaufen, VVunclreiben uncl ^Vunäweräen, Iiält cleii ?uü ^e^uncl
uncl trocken unö 8icbert §e§en LrkältunZen äurcli keucbte ?llüe.
Lei iäanä
/Vcli8el8cbwei6 i8t
bu°-u. Va8snolokorm-?lläer
OriZin3l8treuc1o86N in ^potbelcen uncl vro§erien.
kr»8t- unr! I.ungenleir!en
kmLbrü8lixlceit, /Vstbma, ttul8- unä Keblkopfleiclen
veraltete Katarrbe, ttu8ten u. VersckIeimunZen cler
/Vtmun^sorxane wuröen seit eröenklicben ^eiten öurck
clen 3uk vulkaniscbemkoöen W3cb8enöen ecbtenpbilipp8-
bur^er äobannistee wirk^am dekämpkt, W38 viele trei-
williZe l)3nk8cbreiben bereu§en. 8eit äabrbunäerten de-
wäbrtes Katurmitlel. I'uberkeln verkrilkten 8icb, üarillen
scbnell. Kur: 6—12 ?akete. Ooppelpaket 2500.— i^k.
l^erven- u. Lemüleleillen
wie >Iervo8i1ät, ^ukßsere^tbeit, blerven8cbvväcbe,
/Vnxstrustänäe, 8cbvvermut, /Vli^räne, Kopfscbmer-
ren, 8cbIaiIo8i^keit, Oec!2cb1ni88cbw2cbe U8W.
weröen clurcb öen 3>lbew3brten, ecbten ?bilipp8burgser
§ün8ti^ beeintluüt unö bekämpkt. Hr8tk>388i§e8 blerven-
8tärkun§8- uncl Lerubißun^mittel. vie 8cbl3tIo8en bläcbte
ver8cbw3iic1en uncl §ei8ti§e Krakt unö ^riscbe kebrten ein.
Kur: 3-6 ?akete. OoppeI-?aket 5200.— /V1K.
6e8teIIuiiLen rielite man üirekt an üa.8 Herbaria-Krauterparaäies, ^bilippsburgs 258 (bacien), worruik Vernrnc! äureli äe886ii Versanciapottieke erkol^t. ?rei86 kreilileibenä
Ver83nä erkoIZt nur ^um D3§e8prejs §e§en '/2 /Vn23blun§ als /Vnnabme-O^rantie, obne /Vn23blun§ kein Versanä. Lilli^ere tzu^Iitäten ebenfabs lieterdar.
Von Mrmern deireil
urs3cben. Viele Ounkscbreiden üder sicbere ^Virkun§, wo
viele/viittel versa^ten. ?ür 8pubvurmkur1—2. kür/^3äen-
Wurmkur 4—6 ?3kete erkoräerlicb. ?3ket 3500.— ^k.
?aäikal kanclvvurmmittel 3500.— /11k.
ä'rc ccllsri ctiavcb plclkcrts gsSksrznLSiQbristsri QSsetrÖkteri Lu bckdsn,v/O rüebt,
^VSILSN L>SLciZSc;uSllSn riclOb Lä.1.iiNISl, Lcbubfabrük. ^..o.,
Hlsivi^s IvssrLtsllLiiQLllive: iiullols IVIosso, ^viioiiLeri-iüxpoüitioii.
81
Sich einen Garten ;um Vergnügen,
Und weil die Gegend Hügel hat,
So führen ;u Lem Garten Stiegen.
Dec Garten vor öer Staöt
Der Dnkel Irih ist Lick unü mißt
Um seinen Bauch herum ;wei Meter;
Wenn er im Garten tätig ist,
Dor Schwitzen manchmal fost vergeht er.
Der Gnkel?ritz hat sehr viel Geld,
Doch sieht er seinen Garten blühen,
Meint er: „Wie schwer das Leben fällt, —
Wie muß der Mensch im Schweiß sich mühen!"
Der Gnkel Iritz hat Zeit genug,
Drum schafft er selbst in seinem Garten.
Bis ihm Ler Herbst die Irüchte trug, —
Gr kann , manchmal kaum erwarten.
Besonders aber schnaufen muß
Lr auf den Stiegen, Angst erregend!
Das schuf ihm öfters schon Berüruß,
Doch ändern läßt sich nicht die Gegend.
Der Gnkel Iritz ist 'also fett,
Doch meint üer Sanitätsrat Better:
Wenn er nicht seinen Garten hätt',
Dann wär' er sicher noch viel fetter!
Der orlginelle Adalbert
lahmte er nicht, und statt nur solche einzelnen, sür den Ver-
kehr der Gebildelen notwendigen überlieferten Ausdrücke in
der eigenen künstlerischen Gußform umzubilden, ging er nun
an die originelle Amgestaltung ganzer Redensarten.
Gleich seine erste Schöpfung auf diesem Gebiet war ein
Meisterwerk. „Rom ist nicht in vierundzwanzig Stunden
erbaut worden," sprach er, und mit ungeheurer Schnellig-
keit verbreitete es sich in seinem Kreise: „Denkt euch nur,
der Adalbert hat gesagt-Nein, der Mensch ist doch
gar zu originell!" — Das Wort: „Man soll den Tag nicht
vor Mitternacht loben," konnte hiernach nur als eine schwä-
chere Variante erscheinen, aber es können ja nicht alle Werke
eines Meisters gleich groß sein, besonders, wenn er der
Welt siändig neue bescheren will. Das aber tat Adalbert,
und in rascher Folge entstanden nun Prägungen wie: „Die
Wiese vor Grashalmen nicht schen" — „Man soll niemand
vor seinem Ableben glücklich preisen" — „Der Intelligentere
gibt nach" — „Allzu stark geladen, zerplatzt die Flinte" —
„Ieder ist seines Glückes Zimmermann" — „Man muß das
Glas blasen, solange es flüssig ist" — „Einem geschenkten
Lund sieht man nicht in den Mund." — Bei diesem letzten
Wort wäre schließlich zu beanstanden, daß die ursprüng-
lichere Form die logischere ist, weil man einem Gaul ins
Maul sieht, um sein Alter zu erkennen, was man beim
Lunde nicht zu tun Pflegt, aber daraus kommt es nicht an.
Adalberts Neuschöpfung ersetzte das häßliche Maul durch
den »etteren Mund und bewahrte doch den Neim, und des-
halb fand er damit besonders den Beifall der Damen. —
Leute gilt Adalbert als einer der gescheitesten, von
2uc liincisrpklsgs
verwenäet man seit vielen äobren 3I8 vorrüxlicties Oinstreumittel von ruverl388l'§er ^VirkunZ lür kleine Kinäer
unä LäuZIin^e ngcli clem Orteil bervorra^encler ^errte äer Kinciertreilkuncie
VsssnoHpuelsr
üer bei re§eImäLi§er -Vnwenäun§ Wunä^ein, VVunälie^en, Lnt^ünäunxen uncl
?ötun§en cier biaut 7.uverIZ88i§ verliinclert. V38enol-V?uncI- unci Kincler-Pucler
i8t 8einer siclieren VVirkunZ cveZen in 8täncli§er /Vnwenäun^ dei ralilreiciien
Kr3nkenträu8ern, Kliniken, Lntbinc1un§83N8l3lten U8W.
sowie aller uiiter äer 8cbwei6 Oin-
wirkun^ leiäenäen Körpeiteile mit » »»vZI vL »ZtLLLL L UU vK
scbütrt 8e§en V/unälaufen, VVunclreiben uncl ^Vunäweräen, Iiält cleii ?uü ^e^uncl
uncl trocken unö 8icbert §e§en LrkältunZen äurcli keucbte ?llüe.
Lei iäanä
/Vcli8el8cbwei6 i8t
bu°-u. Va8snolokorm-?lläer
OriZin3l8treuc1o86N in ^potbelcen uncl vro§erien.
kr»8t- unr! I.ungenleir!en
kmLbrü8lixlceit, /Vstbma, ttul8- unä Keblkopfleiclen
veraltete Katarrbe, ttu8ten u. VersckIeimunZen cler
/Vtmun^sorxane wuröen seit eröenklicben ^eiten öurck
clen 3uk vulkaniscbemkoöen W3cb8enöen ecbtenpbilipp8-
bur^er äobannistee wirk^am dekämpkt, W38 viele trei-
williZe l)3nk8cbreiben bereu§en. 8eit äabrbunäerten de-
wäbrtes Katurmitlel. I'uberkeln verkrilkten 8icb, üarillen
scbnell. Kur: 6—12 ?akete. Ooppelpaket 2500.— i^k.
l^erven- u. Lemüleleillen
wie >Iervo8i1ät, ^ukßsere^tbeit, blerven8cbvväcbe,
/Vnxstrustänäe, 8cbvvermut, /Vli^räne, Kopfscbmer-
ren, 8cbIaiIo8i^keit, Oec!2cb1ni88cbw2cbe U8W.
weröen clurcb öen 3>lbew3brten, ecbten ?bilipp8burgser
§ün8ti^ beeintluüt unö bekämpkt. Hr8tk>388i§e8 blerven-
8tärkun§8- uncl Lerubißun^mittel. vie 8cbl3tIo8en bläcbte
ver8cbw3iic1en uncl §ei8ti§e Krakt unö ^riscbe kebrten ein.
Kur: 3-6 ?akete. OoppeI-?aket 5200.— /V1K.
6e8teIIuiiLen rielite man üirekt an üa.8 Herbaria-Krauterparaäies, ^bilippsburgs 258 (bacien), worruik Vernrnc! äureli äe886ii Versanciapottieke erkol^t. ?rei86 kreilileibenä
Ver83nä erkoIZt nur ^um D3§e8prejs §e§en '/2 /Vn23blun§ als /Vnnabme-O^rantie, obne /Vn23blun§ kein Versanä. Lilli^ere tzu^Iitäten ebenfabs lieterdar.
Von Mrmern deireil
urs3cben. Viele Ounkscbreiden üder sicbere ^Virkun§, wo
viele/viittel versa^ten. ?ür 8pubvurmkur1—2. kür/^3äen-
Wurmkur 4—6 ?3kete erkoräerlicb. ?3ket 3500.— ^k.
?aäikal kanclvvurmmittel 3500.— /11k.
ä'rc ccllsri ctiavcb plclkcrts gsSksrznLSiQbristsri QSsetrÖkteri Lu bckdsn,v/O rüebt,
^VSILSN L>SLciZSc;uSllSn riclOb Lä.1.iiNISl, Lcbubfabrük. ^..o.,
Hlsivi^s IvssrLtsllLiiQLllive: iiullols IVIosso, ^viioiiLeri-iüxpoüitioii.
81