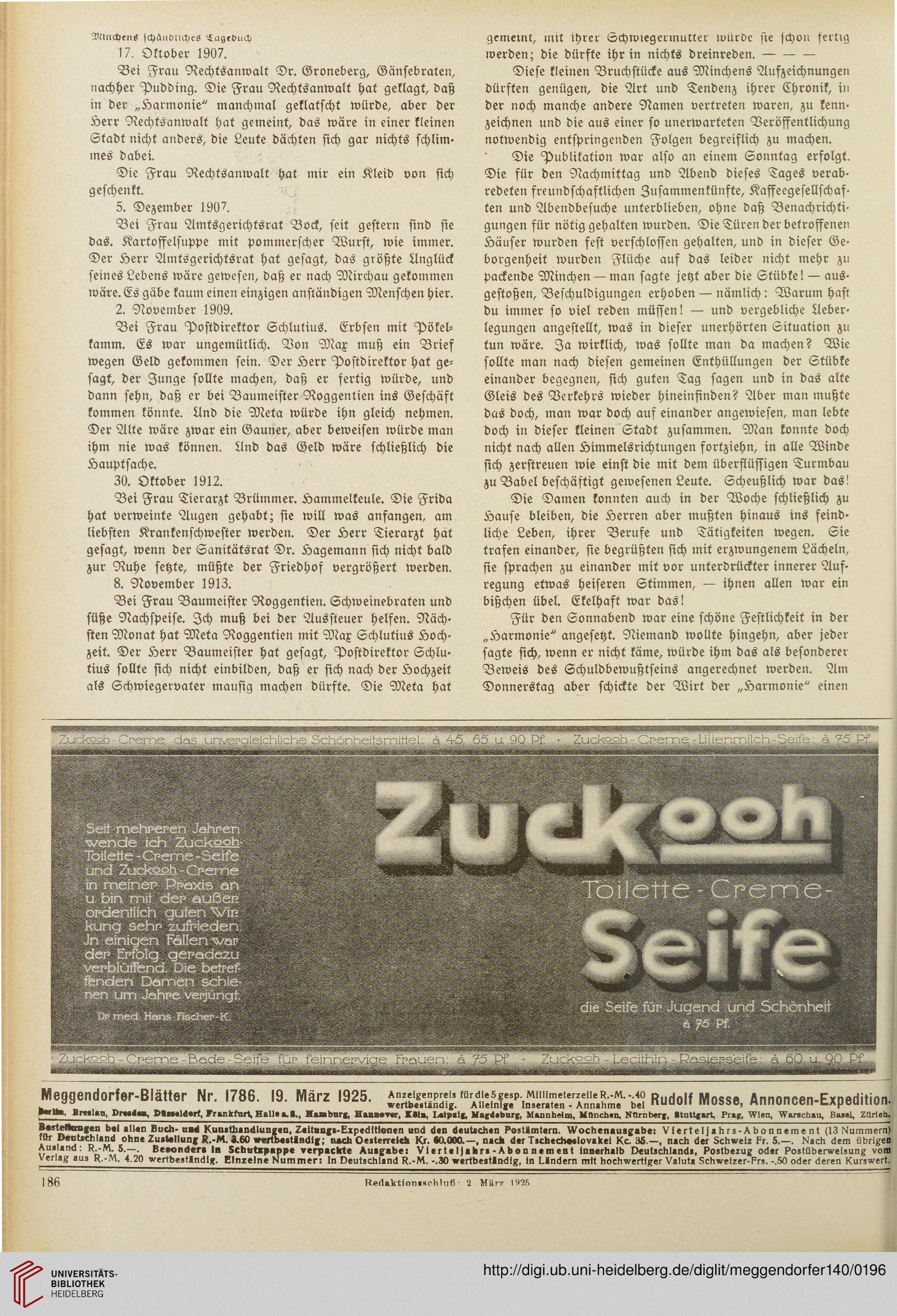Mlnchens schäiidNchcö Lagrdnch
17. Oklober 1907.
Bei Frau Rechtsanwalt Dr. Groneberg, Gänsebraten,
nachher Pudding. Die Frau Rechtsanwalt hat geklagt, daß
in der „Larmonie" manchmal geklatscht würde, aber der
Lerr Rechtsanwalt hat gemeint, das wäre in einer kleinen
Stadt nicht anders, die Leute dächten sich gar nichts schlim-
mes dabei.
Die Frau Rechtsanwalt hat mir ein Kleid von sich
geschenkt.
5. Dezember 190?.
Bei Frau Amtsgerichtsrat Bock, seit gestern stnd sie
das. Kartoffelsuppe mit pommerscher Wurst, wie immer.
Der Lerr Amtsgerichtsrat hat gesagt, das größte Anglück
seines Lebens wäre gewesen, daß er nach Mirchau gekommen
wäre.Es gäbe kaum einen einzigen anständiqen Menschen hier.
2. November 1909.
Bei Frau Poftdirektor Schlutius. Erbsen mit Pökel-
kamm. Es war ungemütlich. Von Max muß ein Brief
wegen Geld gekommen sein. Der Lerr Postdirektor hat ge-
sagt, der Zunge sollte machen, daß er fertig würde, und
dann sehn, daß er bei Baumeister Roggentien ins Geschäst
kommen könnte. And die Meta wllrde ihn gleich nehmen.
Der Alte wäre zwar ein Gauner, aber beweisen wllrde man
ihm nie was können. And das Geld wäre schließlich die
Lauptsache.
30. Oktober 1912.
Bei Frau Tierarzt Brümmer. Äammelkeule. Die Frida
hat verweinte Augen gehabt; sie will was anfangen, am
liebsten Krankenschwester werden. Der Lerr Tierarzt hat
gesagt, wenn der Sanitätsrat Dr. Lagemann sich nicht bald
zur Nuhe setzte, müßte der Friedhos vergrößert werden.
8. November 1913.
Bei Frau Baumeister Roggentien. Schweinebraten und
süße Nachspeise. Ich muß bei der Aussteuer helfen. Näch-
sten Monat hat Meta Roggentien mit Max Schlutius Loch-
zeit. Der Lerr Baumeister hat gesagt, Postdirektor Schlu-
tius sollte sich nicht einbilden, daß er sich nach der Lochzeit
als Schwiegervater mausig machen dürfte. Die Meta hat
gemeinl, mit ihrer Schwiegermuller würde sie schou serlig
werden; die dürfte ihr in nichts dreinreden.-
Diese kleinen Bruchstücke aus Minchens Aufzeichnungen
dürften genügen, die Art und Tendenz ihrer Chronik, in
der noch manche andere Namen vertreten waren, zu kenn-
zeichnen und die aus einer so unerwarteten Veröffentlichung
notwendig entspringenden Folgen begreiflich zu machen.
Die Publikation war also an einem Sonntag erfolgt.
Die für den Nachmittag und Abend dieses Tages verab-
redeten freundschaftlichen Zusammenkünfte, Kaffeegesellschaf-
ten und Abendbesuche unterblieben, ohne daß Benachrichti-
gungen für nötig gehalten wurden. Die Türen der betroffenen
Läuser wurden sest verschlossen gehalten, und in dieser Ge-
borgenheit wurden Flüche auf das leider nicht mehr zu
packende Minchen —man sagte jetzt aber die Stübke l — aus-
gestoßen, Beschuldigungen erhoben — nämlich: Warum hast
du immer so viel reden müffen! — und vergebliche Aeber-
legungen angestellt, was in dieser unerhörten Situation zu
tun wäre. Fa wirklich, was sollte man da machen? Wie
sollte man nach diesen gemeinen Enthüllungen der Stübke
einander begegnen, sich guten Tag sagen und in das alte
Gleis des Verkehrs wieder hineinfinden? Aber man mußte
das doch, man war doch aus einander angewiesen, man lebte
doch in dieser kleinen Stadt zusammen. Man konnte doch
nicht nach allen Limmelsrichtungen sortziehn, in alle Winde
sich zerstreuen wie einst die mit dem überflllssigen Turmbau
zu Babel beschäftigt gewesenen Leute. Scheußlich war das!
Die Damen konnten auch in der Woche schließlich zu
Lause bleiben, die Lerren aber mußten hinaus ins seind-
liche Leben, ihrer Beruse und Tätigkeiten wegen. Sie
trafen einander, sie begrüßten sich mit erzwungenem Lächeln,
sie sprachen zu einander mit vor unterdrückter innerer Auf-
regung etwas heiseren Stimmen, — ihnen allen war ein
bißchen übel. Ekelhaft war das!
Für den Sonnabend war eine schöne Festlichkeit in der
„Larmonie" angesetzt. Niemand wollte hingehn, aber jeder
sagte sich, wenn er nicht käme, würde ihm das als besonderer
Beweis des Schuldbewußtseins angerechnet werden. Am
Donnerstag aber schickte der Wirt der „Larmonie" einen
- Ulrsnnrüok-
3sit MStinepen Osiven
^vsncckS inbi L in.pcoOli.
loilstie -Sr-srrlS -ZSists
uncck Lieköoli- cHpsrns
in rnSinsn pffsxis sn
u, bin rnii ccksp suLsn
OpcZSrMnsi, ^utsn^/m
ssbin LufniScZSN
3n siniySn ffsllSN -s/s?
cZsr- knfslcz «zspscZsLu
vsndlüKSncfl. Ois betrsss
fsnccksn Osrnsn ssOiS-
nsn nnn Ostins vsi-Pnizt,
ld? rr>«ct. dl»r>s krsükSN-!<.
6is Zeiks sür 3uysnc! uncl LcUÖnineit
7
«°W°nä°U°r-8>LN°i- «I-, I78K, Ig, MLrr ,828. >t>°-s°, Lm>°°°°°-expsck,>°n,
L»o»»v»r, Ht», U»oiid»1w, ItNvcd»!», Mlri>d«rk, >tottss»rt, kr»», tVirn, lV»r,cd»u, 211rlod.
d«i ,ll«o Lucd-u»6 Xull»td»ll6Iull««ll, L«it»ll»»-Lrp«6lri«ll«ll uv6 <i«u «irutick«» po,tiimt«ru. tVocken»u,x»de; Vlertell»dr,-^bollll«mellt (13 dlummern)
- —^ ^ - n Vrend«»tt»«iiU; u»cd Oe»t«rr«i«It Kr. <6.000.—, a»cd «l«r ^»cd«cd»»lov»>l«i Kc. 3L —, ll»cd 6er 8cb«veir ?r. 5.—.
Uir Vevt»cdl»o6 odll« 2u»t«IiullE -.00 «er1d«»tt»6iE: n»cd Oe»t«rr«ied Kr. <6,000.—, ll»cd 6«r ^»cd«cd»»lov»ll«i Kc. 3L.—, ll»cd 6er Lcdrveir ?r. 5.—. I^Iick 6«m üdrixea
/tu,l,n6 i U.-M. 5.—. kexrnOei'» in 8edut»P»pp« verp»edt« ^u»x»d«, Vl«rt«Ij»dr»-Xdoo ll«mest illu«rk»ld Oeut»cdl»ll6», ?o»td«rux o6«r portübervei,ull§ vom
Verlsx su, p.-iVi. < 20 vertdesttnülx. Llnreln« kiummer: In Veut»cdl»n6 P.-51. -.36 «r«rtde»ttll6iz, tn dtn6ern mit kockvertixsr Vslut» 8cd«veirer-?r». -.50 o6er 6erell Xurrvert.
186
U.e6»dtjor>»!icdIutN 2 I92k>
17. Oklober 1907.
Bei Frau Rechtsanwalt Dr. Groneberg, Gänsebraten,
nachher Pudding. Die Frau Rechtsanwalt hat geklagt, daß
in der „Larmonie" manchmal geklatscht würde, aber der
Lerr Rechtsanwalt hat gemeint, das wäre in einer kleinen
Stadt nicht anders, die Leute dächten sich gar nichts schlim-
mes dabei.
Die Frau Rechtsanwalt hat mir ein Kleid von sich
geschenkt.
5. Dezember 190?.
Bei Frau Amtsgerichtsrat Bock, seit gestern stnd sie
das. Kartoffelsuppe mit pommerscher Wurst, wie immer.
Der Lerr Amtsgerichtsrat hat gesagt, das größte Anglück
seines Lebens wäre gewesen, daß er nach Mirchau gekommen
wäre.Es gäbe kaum einen einzigen anständiqen Menschen hier.
2. November 1909.
Bei Frau Poftdirektor Schlutius. Erbsen mit Pökel-
kamm. Es war ungemütlich. Von Max muß ein Brief
wegen Geld gekommen sein. Der Lerr Postdirektor hat ge-
sagt, der Zunge sollte machen, daß er fertig würde, und
dann sehn, daß er bei Baumeister Roggentien ins Geschäst
kommen könnte. And die Meta wllrde ihn gleich nehmen.
Der Alte wäre zwar ein Gauner, aber beweisen wllrde man
ihm nie was können. And das Geld wäre schließlich die
Lauptsache.
30. Oktober 1912.
Bei Frau Tierarzt Brümmer. Äammelkeule. Die Frida
hat verweinte Augen gehabt; sie will was anfangen, am
liebsten Krankenschwester werden. Der Lerr Tierarzt hat
gesagt, wenn der Sanitätsrat Dr. Lagemann sich nicht bald
zur Nuhe setzte, müßte der Friedhos vergrößert werden.
8. November 1913.
Bei Frau Baumeister Roggentien. Schweinebraten und
süße Nachspeise. Ich muß bei der Aussteuer helfen. Näch-
sten Monat hat Meta Roggentien mit Max Schlutius Loch-
zeit. Der Lerr Baumeister hat gesagt, Postdirektor Schlu-
tius sollte sich nicht einbilden, daß er sich nach der Lochzeit
als Schwiegervater mausig machen dürfte. Die Meta hat
gemeinl, mit ihrer Schwiegermuller würde sie schou serlig
werden; die dürfte ihr in nichts dreinreden.-
Diese kleinen Bruchstücke aus Minchens Aufzeichnungen
dürften genügen, die Art und Tendenz ihrer Chronik, in
der noch manche andere Namen vertreten waren, zu kenn-
zeichnen und die aus einer so unerwarteten Veröffentlichung
notwendig entspringenden Folgen begreiflich zu machen.
Die Publikation war also an einem Sonntag erfolgt.
Die für den Nachmittag und Abend dieses Tages verab-
redeten freundschaftlichen Zusammenkünfte, Kaffeegesellschaf-
ten und Abendbesuche unterblieben, ohne daß Benachrichti-
gungen für nötig gehalten wurden. Die Türen der betroffenen
Läuser wurden sest verschlossen gehalten, und in dieser Ge-
borgenheit wurden Flüche auf das leider nicht mehr zu
packende Minchen —man sagte jetzt aber die Stübke l — aus-
gestoßen, Beschuldigungen erhoben — nämlich: Warum hast
du immer so viel reden müffen! — und vergebliche Aeber-
legungen angestellt, was in dieser unerhörten Situation zu
tun wäre. Fa wirklich, was sollte man da machen? Wie
sollte man nach diesen gemeinen Enthüllungen der Stübke
einander begegnen, sich guten Tag sagen und in das alte
Gleis des Verkehrs wieder hineinfinden? Aber man mußte
das doch, man war doch aus einander angewiesen, man lebte
doch in dieser kleinen Stadt zusammen. Man konnte doch
nicht nach allen Limmelsrichtungen sortziehn, in alle Winde
sich zerstreuen wie einst die mit dem überflllssigen Turmbau
zu Babel beschäftigt gewesenen Leute. Scheußlich war das!
Die Damen konnten auch in der Woche schließlich zu
Lause bleiben, die Lerren aber mußten hinaus ins seind-
liche Leben, ihrer Beruse und Tätigkeiten wegen. Sie
trafen einander, sie begrüßten sich mit erzwungenem Lächeln,
sie sprachen zu einander mit vor unterdrückter innerer Auf-
regung etwas heiseren Stimmen, — ihnen allen war ein
bißchen übel. Ekelhaft war das!
Für den Sonnabend war eine schöne Festlichkeit in der
„Larmonie" angesetzt. Niemand wollte hingehn, aber jeder
sagte sich, wenn er nicht käme, würde ihm das als besonderer
Beweis des Schuldbewußtseins angerechnet werden. Am
Donnerstag aber schickte der Wirt der „Larmonie" einen
- Ulrsnnrüok-
3sit MStinepen Osiven
^vsncckS inbi L in.pcoOli.
loilstie -Sr-srrlS -ZSists
uncck Lieköoli- cHpsrns
in rnSinsn pffsxis sn
u, bin rnii ccksp suLsn
OpcZSrMnsi, ^utsn^/m
ssbin LufniScZSN
3n siniySn ffsllSN -s/s?
cZsr- knfslcz «zspscZsLu
vsndlüKSncfl. Ois betrsss
fsnccksn Osrnsn ssOiS-
nsn nnn Ostins vsi-Pnizt,
ld? rr>«ct. dl»r>s krsükSN-!<.
6is Zeiks sür 3uysnc! uncl LcUÖnineit
7
«°W°nä°U°r-8>LN°i- «I-, I78K, Ig, MLrr ,828. >t>°-s°, Lm>°°°°°-expsck,>°n,
L»o»»v»r, Ht», U»oiid»1w, ItNvcd»!», Mlri>d«rk, >tottss»rt, kr»», tVirn, lV»r,cd»u, 211rlod.
d«i ,ll«o Lucd-u»6 Xull»td»ll6Iull««ll, L«it»ll»»-Lrp«6lri«ll«ll uv6 <i«u «irutick«» po,tiimt«ru. tVocken»u,x»de; Vlertell»dr,-^bollll«mellt (13 dlummern)
- —^ ^ - n Vrend«»tt»«iiU; u»cd Oe»t«rr«i«It Kr. <6.000.—, a»cd «l«r ^»cd«cd»»lov»>l«i Kc. 3L —, ll»cd 6er 8cb«veir ?r. 5.—.
Uir Vevt»cdl»o6 odll« 2u»t«IiullE -.00 «er1d«»tt»6iE: n»cd Oe»t«rr«ied Kr. <6,000.—, ll»cd 6«r ^»cd«cd»»lov»ll«i Kc. 3L.—, ll»cd 6er Lcdrveir ?r. 5.—. I^Iick 6«m üdrixea
/tu,l,n6 i U.-M. 5.—. kexrnOei'» in 8edut»P»pp« verp»edt« ^u»x»d«, Vl«rt«Ij»dr»-Xdoo ll«mest illu«rk»ld Oeut»cdl»ll6», ?o»td«rux o6«r portübervei,ull§ vom
Verlsx su, p.-iVi. < 20 vertdesttnülx. Llnreln« kiummer: In Veut»cdl»n6 P.-51. -.36 «r«rtde»ttll6iz, tn dtn6ern mit kockvertixsr Vslut» 8cd«veirer-?r». -.50 o6er 6erell Xurrvert.
186
U.e6»dtjor>»!icdIutN 2 I92k>