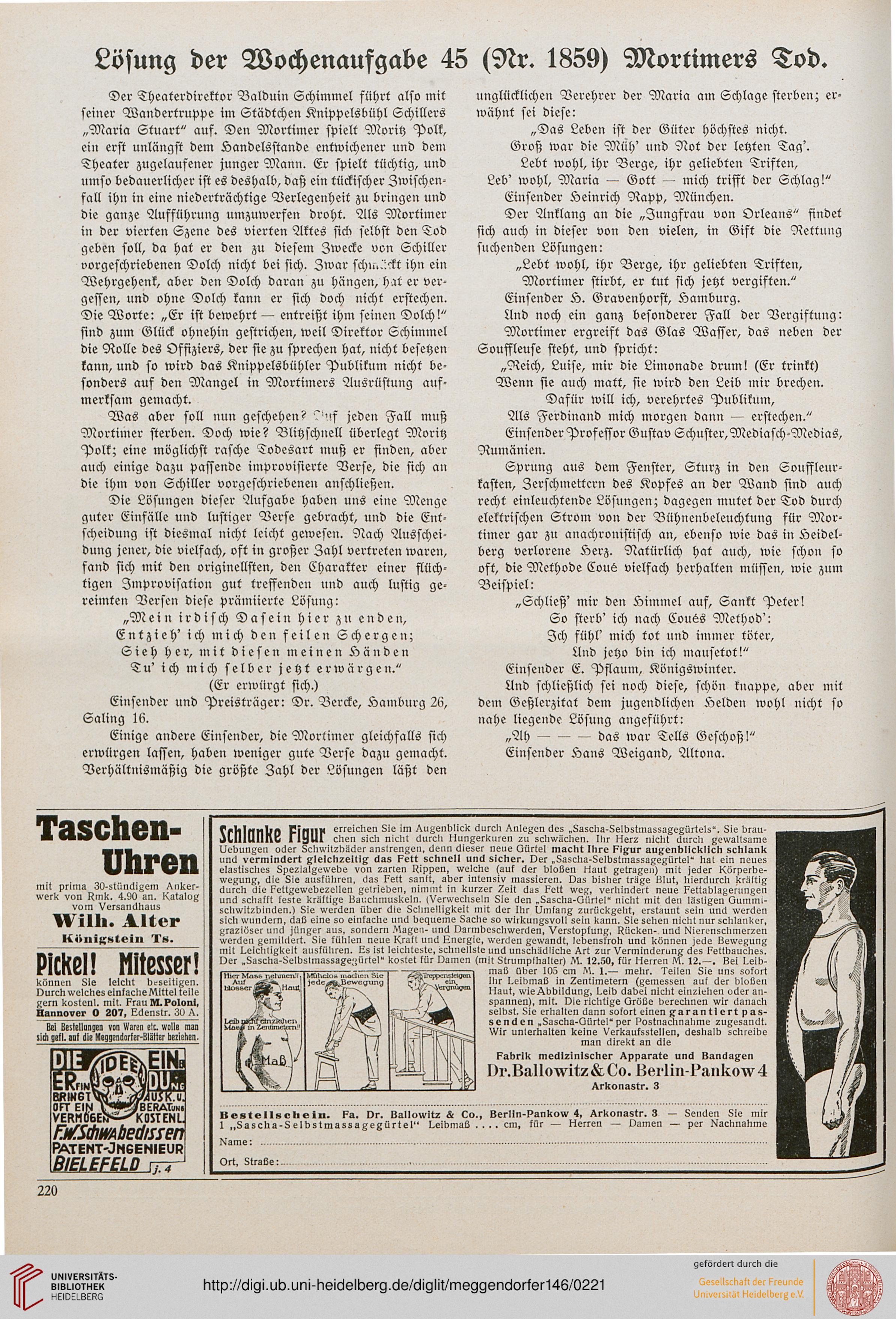Lösung der Wochenaufgabe 45 (Nr. 1859) Mortimers Tod.
Der Theaterdirektor Balduin Schimmel führt also mit
seiner Wandertruppe im Städtchen Knippclsbühl Schillers
„Maria Stuart" auf. Den Mortimer spielt Moritz Polk,
ei» erst unlängst dem Landelsstande entwichener und dem
Theater zugelausener junger Mann. Er spielt tüchtig, und
umso bedauerlicher ist es deshalb, daß cin tückischer Zwischen-
sall ihn in eine niederträchtige Verlegenheit zu bringen und
die ganze Aussührung umzuwerfen droht. Als Mortimer
in der vierten Szene des vierten Aktes sick selbst den Tod
gcben soch da hat er den zu diesem Zwecke von Schiller
vorgeschriebenen Dolch nicht bei sich. Zwar schu.ückt ihn ein
Wehrgehenk, aber den Dolch daran zu hängen, hat er ver-
gessen, und ohne Dolch kann er sich doch nicht ersteche».
Die Worte: „Er ist bewehrt — entreißt ihm seinen Dolch!"
sind zum Glück ohnehin gestrichen, weil Direktor Schimmel
die Nolle des Offiziers, der sie zu sprechen hat, nicht besetzen
kann, und so wird das Knippelsbühler Publikum nicht be-
sonders aus den Mangel in Mortimers Ausrüstung auf-
merksam gemacht.
Was aber soll nun geschehen? 7 ns jeden Fall mnß
Mortimer sterben. Doch wie? Blitzschnell überlegt Moritz
Polk; eine möglichst rasche Todesart muß er finden, aber
auch einige dazn paffende improvisierte Verse, die sich an
die ihm von Schiller vorgeschricbenen anschließen.
Die Lösungen dieser Ausgabe haben uns eine Menge
guter Einsälle und lustiger Verse gebracht, und die Ent-
scheidung ist diesmal nicht leicht gewesen. Nach Ausschei-
dung jener, die vielfach, ost in großer Zahl vertreten waren,
sand sich mit den originellsten, den Charakter einer flüch-
tigen Iinprovisation gut treffenden nnd auch lustig ge-
reimten Versen diese prämiierte Lösung:
„Mein irdisch Dasein hier zu enden,
Entzieh' ich mich den feilen Schergen;
Sieh her, mit diesen meinen Länden
Tu' ich mich selber jetzt erwärgen."
(Er crwürgt sich.)
Einsender und Preisträger: Dr. Bercke, Äamburg 26,
Saling 16.
Einige andere Einsender, die Mortimer gleichfalls sich
erwürgen laffen, haben weniger gute Verse dazu gemacht.
Verhältnismäßig die größte Zahl der Lösungen läßt den
unglücklichen Verehrer der Maria am Schlage sterben; er-
wähnt sei diese:
„Das Leben ist der Güter höchstes nicht.
Groß war die Müh' und Not der letzten Tag'.
Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Tristen,
Leb' wohl, Maria — Gott — mich trifft der Schlag!"
Einsender Leinrich Napp, München.
Der Anklang an die „Iungsrau von Orleans" findet
sich auch in dieser von den vielen, in Gift die Rettung
suchenden Lösungen:
„Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Tristen,
Mortimer stirbt, er tut sich jetzt vergiften."
Einsender Ä. Gravenhorst, Lamburg.
!lnd »och ein ganz besonderer Fall der Vergiftung:
Mortimer ergreist das Glas Waffer, das neben der
Souffleuse steht, und spricht:
„Neich, Luise, mir die Limonade drum! (Er trinkt)
Wenn sie auch matt, sie wird den Leib mir brechen.
Dafür will ich, verehrtes Publikum,
Als Ferdinand mich morgen dann — erstechen."
EinsenderProfessor Gustav Schuster,Mediasch-Medias,
Numänien.
Sprung aus dem Fenster, Stnrz in den Souffleur-
kasten, Zerschmettcrn des Kopses an der Wand sind auch
recht einleuchtende Lösungen; dagegen mutet der Tod durch
elektrischen Strom von der Bühnenbeleuchtung für Mor-
timer gar zu anachronistisch an, ebenso wie das in Äeidel-
berg verlorene Äerz. Natürlich hat auch, wie schon so
ost, die Methode Couä vielfach herhalten müssen, wie zum
Beispiel:
„Schließ' mir den Äimmel aus, Sankt Peter!
So sterb' ich nach Conös Method':
Ich fühl' mich tot und immer töter,
Und jetzo bin ich mausetot!"
Einsender E. Pflaum, Königswinter.
And schließlich sei noch diese, schö» knappe, aber mit
dem Geßlerzitat dem jugendlichen Kelden wohl nicht so
nahe liegende Lösung angeführt:
„Ah-das war Tells Geschoß!"
Einsender Äans Weigand, Alkona.
I'ssclisn-
vkrsn
mit primL ZO-stüncligem /rnker-
vverk von Hmk. 4.90 an. K.3t3loZ
vom Vers3näti3U8
HViU».
I«.
Mel! Nltener!
können 8ie leickt bc8eiti§en.
Ourcb >ve1cbe5 einkacbe iVUttel teile
^ern ko8tenI. mit. ?mu IN. kolonl,
Illsnnover v 207, Lc1en8tr. 30
kei öe^iellungeii von V/gren e>c. v/olie msn
nrii getl. 8ui liie tileggenlioi-tec-ölätter deneken.
WMkd
klNNV« erreicben 8ie im -Vu§enblick ciurcb ^nleZen cie8 „8L5cb3-8eId8tm3583§e§ürtel5". 8ie brau-
I 19U1 cben 8icb nicbt ciurcb ttun§ericuren ru 8cbvvrictien. Ibr bier^ nicbt ciurcb gevv3lt53me
I_lebun§en ocier 8cbwit2kricier 3N8tren8en. cienn ciie^er neue Oürtel macbt Ibre au^enbllckllcb 8cblnnk
unci vecminclert xsleicbreitixs 628 k^ett 8cbneII uncl 8>'cber. Oer „835cb3-8eIb5tm3883§eLürte1" b3t ein neue5
el38ti8cb68 8pe2i3l§evvebe von 23rien I^ippen, vvelcbe (3uk cier bloüen bi3ut Zetr3§en) mit jecier Körperbe-
vve§un§, ciie 8ie 3U8tükren, Ö38 ?ett 83ntt, 3ber inten8iv M385ieren. O35 bi8ber trri§e Llut, bieröurcb krrilti§
ciurcb ciie ^ett^evveberellen §etrieden, nimmt in kur^er 2eit Ü38 kett vve^, verbinciert neue Oett^bl^xerunZen
unci 8cbrrfft fe8te lcrriftiAe IZ3ucbmu8keln. (Vervvecb^eln 8ie cien „838cb3-0ürtel" nicbt mit clen Iri8ti8en Oummi-
8cbwitrbintien.) 8ie vvercien über ciie 8cl>nelli§lceit mit cler Ibr Omf3n§ rurück^elit, er5triunt 8ein unci vvercien
8icb vvunclern, ci3Ü eine 80 eink^cbe unci bequeme 83cbe 80 vviricun§8voll 5ein Ii3nn. 8ie 5eben nicbt nur 8clil3nker,
8r32iÖ5er unci jünxer riu8, 80nciern lVirixen- unci O3rmbe8cbvveräen, Ver^topkun^, I^ücken- unci dberen^cbmer^en
vvercien ^emilciert. 8ie tüblen neue Krutt unci LnerZie, vvercten Lsevv3ncit, leben^frob unci können jecie LevveZunZ
mit OeiclitiLkeit 3U8küIiren. O5 i5t leicbte^te, 8cbneil5te unci un5cli3lilicbe-Vrt 2ur Vermincierun§ cie8 ?ettb3ucli68.
Oer „835cb3-8elb5tm3853Aes;ürteI" ko?1et für Orimen (mit 8trumpfb3lter) iVI. 12.50, kür i4erren /VI. 12.—. Lei beib-
M3Ü über 105 cm lVl. 1.— mebr. I'eilen 8ie un8 8okort
llir beibmnÜ in 2entimelern (Zeme^^en 3ul cier bloüen
bi3ut, vvie^bdiläun^, beib ci3bei nicbt einrieben ocier 3N-
8p3nnen), mit. Oie ricbtiLe Oröüe derecbnen vvir ci3N3cb
8elb5t. 8ie erb3lten ci3nn ?okort einen xai'LnlIerl pas-
8enc1en „835cb3-0ürtel" per?08tn3cbn3lime 2uge83ncit.
V/ir unterii3lten keine Verk3uk88tellen, cie8li3lb 8cbreibe
M3N üirekt 3n ciie
babrik mecllrünl^cber ^pparate unci kanclaxen
I)i.LllbowilxL 60. Loi tin kaiikovv 4
^rkona5tr. 3
ba. Or. Lallovvltr L Oo., kerlln-pankovv 4, ^rkona8tr. 3 — 8encien 8ie mir
1 ..835cb3-8elb5lm3553^eLürtel" keibm3Ü .... cm, kür — tterren — O^men — per t§3cbn3bme
k^3me: ...
0rt, 8tr3Üe:...-.
220
Der Theaterdirektor Balduin Schimmel führt also mit
seiner Wandertruppe im Städtchen Knippclsbühl Schillers
„Maria Stuart" auf. Den Mortimer spielt Moritz Polk,
ei» erst unlängst dem Landelsstande entwichener und dem
Theater zugelausener junger Mann. Er spielt tüchtig, und
umso bedauerlicher ist es deshalb, daß cin tückischer Zwischen-
sall ihn in eine niederträchtige Verlegenheit zu bringen und
die ganze Aussührung umzuwerfen droht. Als Mortimer
in der vierten Szene des vierten Aktes sick selbst den Tod
gcben soch da hat er den zu diesem Zwecke von Schiller
vorgeschriebenen Dolch nicht bei sich. Zwar schu.ückt ihn ein
Wehrgehenk, aber den Dolch daran zu hängen, hat er ver-
gessen, und ohne Dolch kann er sich doch nicht ersteche».
Die Worte: „Er ist bewehrt — entreißt ihm seinen Dolch!"
sind zum Glück ohnehin gestrichen, weil Direktor Schimmel
die Nolle des Offiziers, der sie zu sprechen hat, nicht besetzen
kann, und so wird das Knippelsbühler Publikum nicht be-
sonders aus den Mangel in Mortimers Ausrüstung auf-
merksam gemacht.
Was aber soll nun geschehen? 7 ns jeden Fall mnß
Mortimer sterben. Doch wie? Blitzschnell überlegt Moritz
Polk; eine möglichst rasche Todesart muß er finden, aber
auch einige dazn paffende improvisierte Verse, die sich an
die ihm von Schiller vorgeschricbenen anschließen.
Die Lösungen dieser Ausgabe haben uns eine Menge
guter Einsälle und lustiger Verse gebracht, und die Ent-
scheidung ist diesmal nicht leicht gewesen. Nach Ausschei-
dung jener, die vielfach, ost in großer Zahl vertreten waren,
sand sich mit den originellsten, den Charakter einer flüch-
tigen Iinprovisation gut treffenden nnd auch lustig ge-
reimten Versen diese prämiierte Lösung:
„Mein irdisch Dasein hier zu enden,
Entzieh' ich mich den feilen Schergen;
Sieh her, mit diesen meinen Länden
Tu' ich mich selber jetzt erwärgen."
(Er crwürgt sich.)
Einsender und Preisträger: Dr. Bercke, Äamburg 26,
Saling 16.
Einige andere Einsender, die Mortimer gleichfalls sich
erwürgen laffen, haben weniger gute Verse dazu gemacht.
Verhältnismäßig die größte Zahl der Lösungen läßt den
unglücklichen Verehrer der Maria am Schlage sterben; er-
wähnt sei diese:
„Das Leben ist der Güter höchstes nicht.
Groß war die Müh' und Not der letzten Tag'.
Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Tristen,
Leb' wohl, Maria — Gott — mich trifft der Schlag!"
Einsender Leinrich Napp, München.
Der Anklang an die „Iungsrau von Orleans" findet
sich auch in dieser von den vielen, in Gift die Rettung
suchenden Lösungen:
„Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Tristen,
Mortimer stirbt, er tut sich jetzt vergiften."
Einsender Ä. Gravenhorst, Lamburg.
!lnd »och ein ganz besonderer Fall der Vergiftung:
Mortimer ergreist das Glas Waffer, das neben der
Souffleuse steht, und spricht:
„Neich, Luise, mir die Limonade drum! (Er trinkt)
Wenn sie auch matt, sie wird den Leib mir brechen.
Dafür will ich, verehrtes Publikum,
Als Ferdinand mich morgen dann — erstechen."
EinsenderProfessor Gustav Schuster,Mediasch-Medias,
Numänien.
Sprung aus dem Fenster, Stnrz in den Souffleur-
kasten, Zerschmettcrn des Kopses an der Wand sind auch
recht einleuchtende Lösungen; dagegen mutet der Tod durch
elektrischen Strom von der Bühnenbeleuchtung für Mor-
timer gar zu anachronistisch an, ebenso wie das in Äeidel-
berg verlorene Äerz. Natürlich hat auch, wie schon so
ost, die Methode Couä vielfach herhalten müssen, wie zum
Beispiel:
„Schließ' mir den Äimmel aus, Sankt Peter!
So sterb' ich nach Conös Method':
Ich fühl' mich tot und immer töter,
Und jetzo bin ich mausetot!"
Einsender E. Pflaum, Königswinter.
And schließlich sei noch diese, schö» knappe, aber mit
dem Geßlerzitat dem jugendlichen Kelden wohl nicht so
nahe liegende Lösung angeführt:
„Ah-das war Tells Geschoß!"
Einsender Äans Weigand, Alkona.
I'ssclisn-
vkrsn
mit primL ZO-stüncligem /rnker-
vverk von Hmk. 4.90 an. K.3t3loZ
vom Vers3näti3U8
HViU».
I«.
Mel! Nltener!
können 8ie leickt bc8eiti§en.
Ourcb >ve1cbe5 einkacbe iVUttel teile
^ern ko8tenI. mit. ?mu IN. kolonl,
Illsnnover v 207, Lc1en8tr. 30
kei öe^iellungeii von V/gren e>c. v/olie msn
nrii getl. 8ui liie tileggenlioi-tec-ölätter deneken.
WMkd
klNNV« erreicben 8ie im -Vu§enblick ciurcb ^nleZen cie8 „8L5cb3-8eId8tm3583§e§ürtel5". 8ie brau-
I 19U1 cben 8icb nicbt ciurcb ttun§ericuren ru 8cbvvrictien. Ibr bier^ nicbt ciurcb gevv3lt53me
I_lebun§en ocier 8cbwit2kricier 3N8tren8en. cienn ciie^er neue Oürtel macbt Ibre au^enbllckllcb 8cblnnk
unci vecminclert xsleicbreitixs 628 k^ett 8cbneII uncl 8>'cber. Oer „835cb3-8eIb5tm3883§eLürte1" b3t ein neue5
el38ti8cb68 8pe2i3l§evvebe von 23rien I^ippen, vvelcbe (3uk cier bloüen bi3ut Zetr3§en) mit jecier Körperbe-
vve§un§, ciie 8ie 3U8tükren, Ö38 ?ett 83ntt, 3ber inten8iv M385ieren. O35 bi8ber trri§e Llut, bieröurcb krrilti§
ciurcb ciie ^ett^evveberellen §etrieden, nimmt in kur^er 2eit Ü38 kett vve^, verbinciert neue Oett^bl^xerunZen
unci 8cbrrfft fe8te lcrriftiAe IZ3ucbmu8keln. (Vervvecb^eln 8ie cien „838cb3-0ürtel" nicbt mit clen Iri8ti8en Oummi-
8cbwitrbintien.) 8ie vvercien über ciie 8cl>nelli§lceit mit cler Ibr Omf3n§ rurück^elit, er5triunt 8ein unci vvercien
8icb vvunclern, ci3Ü eine 80 eink^cbe unci bequeme 83cbe 80 vviricun§8voll 5ein Ii3nn. 8ie 5eben nicbt nur 8clil3nker,
8r32iÖ5er unci jünxer riu8, 80nciern lVirixen- unci O3rmbe8cbvveräen, Ver^topkun^, I^ücken- unci dberen^cbmer^en
vvercien ^emilciert. 8ie tüblen neue Krutt unci LnerZie, vvercten Lsevv3ncit, leben^frob unci können jecie LevveZunZ
mit OeiclitiLkeit 3U8küIiren. O5 i5t leicbte^te, 8cbneil5te unci un5cli3lilicbe-Vrt 2ur Vermincierun§ cie8 ?ettb3ucli68.
Oer „835cb3-8elb5tm3853Aes;ürteI" ko?1et für Orimen (mit 8trumpfb3lter) iVI. 12.50, kür i4erren /VI. 12.—. Lei beib-
M3Ü über 105 cm lVl. 1.— mebr. I'eilen 8ie un8 8okort
llir beibmnÜ in 2entimelern (Zeme^^en 3ul cier bloüen
bi3ut, vvie^bdiläun^, beib ci3bei nicbt einrieben ocier 3N-
8p3nnen), mit. Oie ricbtiLe Oröüe derecbnen vvir ci3N3cb
8elb5t. 8ie erb3lten ci3nn ?okort einen xai'LnlIerl pas-
8enc1en „835cb3-0ürtel" per?08tn3cbn3lime 2uge83ncit.
V/ir unterii3lten keine Verk3uk88tellen, cie8li3lb 8cbreibe
M3N üirekt 3n ciie
babrik mecllrünl^cber ^pparate unci kanclaxen
I)i.LllbowilxL 60. Loi tin kaiikovv 4
^rkona5tr. 3
ba. Or. Lallovvltr L Oo., kerlln-pankovv 4, ^rkona8tr. 3 — 8encien 8ie mir
1 ..835cb3-8elb5lm3553^eLürtel" keibm3Ü .... cm, kür — tterren — O^men — per t§3cbn3bme
k^3me: ...
0rt, 8tr3Üe:...-.
220