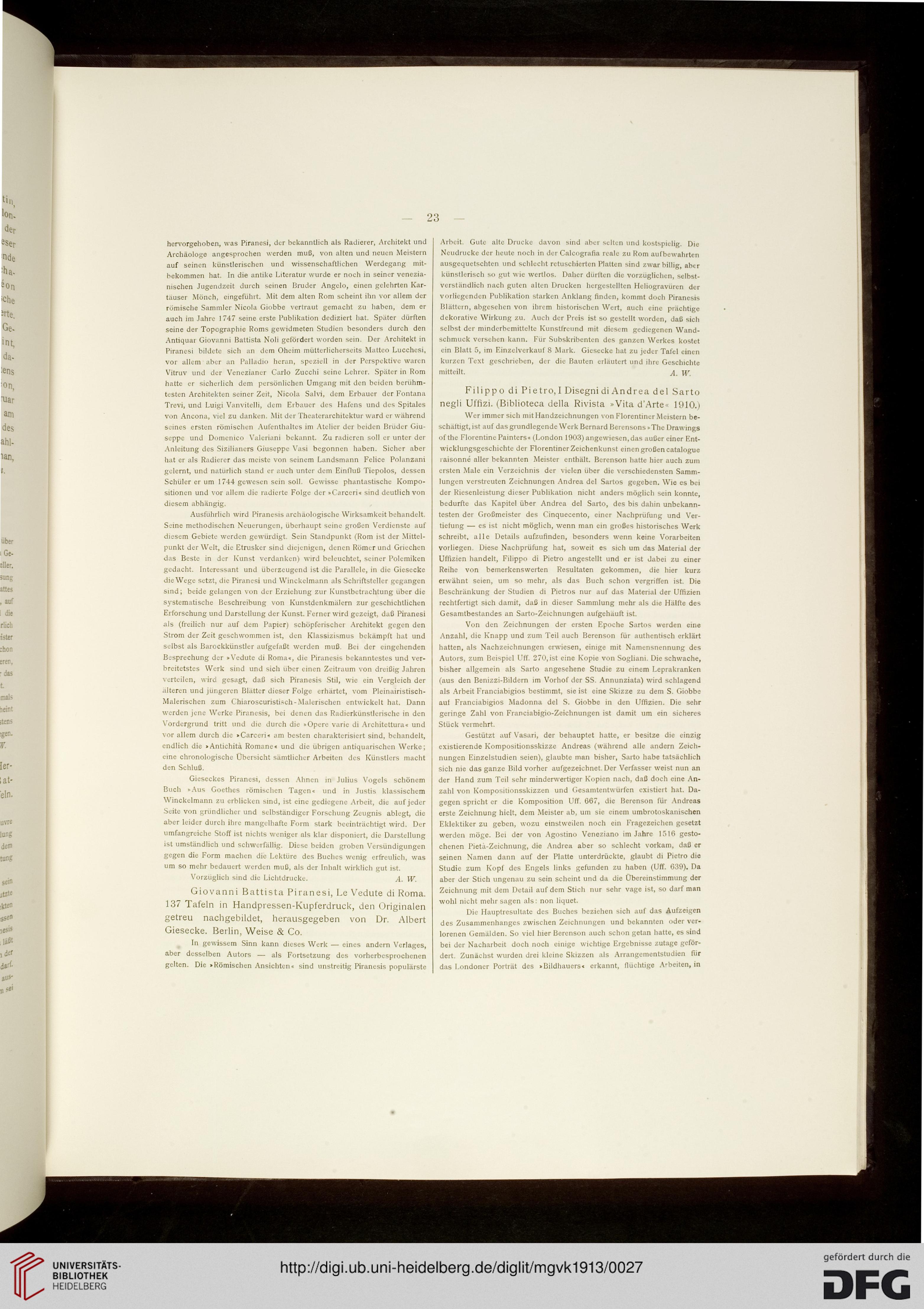23 —
hervorgehoben, was Piranesi, der bekanntlich als Radierer, Architekt und
Archäologe angesprochen werden muß, von alten und neuen Meistein
auf seinen künstlerischen und wissenschaftlichen Werdegang mit-
hekommen hat. In die antike Literatur wurde er noch in seiner venezia-
nischen Jugendzeit durch seinen Bruder Angelo, einen gelehrten Kar-
täuser Mönch, eingefühlt. Mit dem alten Rom scheint ihn vor allem der
römische Sammler Nicola Giobbe vertraut gemacht zu haben, dem er
auch im Jahre 1747 seine erste Publikation dediziert hat. Später dürften
seine der Topographie Roms gewidmeten Studien besonders durch den
Antiquar Giovanni Battista Noli gefordert worden sein. Der Architekt in
Piranesi bildete sich an dem Oheim mütterlicherseits Matteo Lucchesi,
vor allem aber an Palladio heran, speziell in der Perspektive waren
Vitruv und der Venezianer Carlo Zucchi seine Lehrer. Spater in Rom
hatte er sicherlich dem persönlichen Umgang mit den beiden berühm-
testen Architekten seiner Zeit, Nicola Salvi, dem Erbauer der Fontana
Trevi, und Luigi Vanvitelli, dem Erbauer des Hafens und des Spitales
von Ancona, viel zu danken. Mit der Theaterarchitektur ward er während
seines ersten römischen Aufenthaltes im Atelier der beiden Brüder Giu-
seppe und Domenico Valeriani bekannt. Zu radieren soll er unter der
Anleitung des Sizilianers Giuseppe Vasi begonnen haben. Sicher aber
hat er als Radierer das meiste von seinem Landsmann Feiice Polanzani
gelernt, und natürlich stand er auch unter dem Einfluß Tiepolos, dessen
Schüler er um 1744 gewesen sein soll. Gewisse phantastische Kompo-
sitionen und vor allem die radierte Folge der »Carceri« sind deutlich von
diesem abhängig.
Ausführlich wird Piranesis archäologische Wirksamkeit behandelt.
Seine methodischen Neuerungen, überhaupt seine großen Verdienste auf
diesem Gebiete werden gewürdigt. Sein Standpunkt (Rom ist der Mittel-
punkt der Welt, die Etrusker sind diejenigen, denen Römer und Griechen
das Beste in der Kunst verdanken) wird beleuchtet, seiner Polemiken
gedacht. Interessant und überzeugend ist die Parallele, in die Giesecke
die Wege setzt, die Piranesi und Winckclmann als Schriftsteller gegangen
sind; beide gelangen von der Erziehung zur Kunstbetrachtung über die
systematische Beschreibung von Kunstdenkmalern zur geschichtlichen
Erforschung und Darstellung der Kunst. Ferner wird gezeigt, daß Piranesi
als (freilich nur auf dem Papier) schöpferischer Architekt gegen den
Strom der Zeit geschwommen ist, den Klassizismus bekämpft hat und
selbst als Barockkünstler aufgefaßt werden muß. Bei der eingehenden
Besprechung der »Vedute di Roma«, die Piranesis bekanntestes und ver-
breitetstes Werk sind und sich über einen Zeitraum von dreißig Jahren
verteilen, wird gesagt, daß sich Piranesis Stil, wie ein Vergleich der
alteren und jüngeren Blätter dieser Folge erhärtet, vom Pleinairistisch-
Malerischen zum Chiaroscuristisch- Malerischen entwickelt hat. Dann
werden jene Werke Piranesis, bei denen das Radierkünstlerische in den
Vordergrund tritt und die durch die »Opere varie di Architettura« und
vor allem durch die »Carceri« am besten charakterisiert sind, behandelt,
endlich die »Antichitä Romane« und die übrigen antiquarischen Werke;
eine chronologische Übersicht sämtlicher Arbeiten des Künstlers macht
den Schluß.
Gieseckes Piranesi, dessen Ahnen in Julius Vogels schönem
Buch »Aus Goethes römischen Tagen« und in Justis klassischem
Winckelmann zu erblicken sind, ist eine gediegene Arbeit, die auf jeder
Seite von gründlicher und selbständiger Forschung Zeugnis ablegt, die
aber leider durch ihre mangelhafte Form stark beeinträchtigt wird. Der
umfangreiche Stoff ist nichts weniger als klar disponiert, die Darstellung
ist umständlich und schwei fällig. Diese beiden groben Versündigungen
gegen die Form machen die Lektüre des Buches wenig erfreulich, was
um so mehr bedauert werden muß, als der Inhalt wirklich gut ist.
Vorzüglich sind die Lichtdrucke. A. W.
Giovanni Battista Piranesi, Le Vedute di Roma.
137 Tafeln in Handpressen-Kupferdruck, den Originalen
getreu nachgebildet, herausgegeben von Dr. Albert
Giesecke. Berlin, Weise & Co.
In gewissem Sinn kann dieses Werk — eines andern Verlages,
aber desselben Autors — als Fortsetzung des vorherbesprochenen
gelten. Die »Römischen Ansichten« sind unstreitig Piranesis populärste
Arbeit. Gute alte Drucke davon sind aber selten und kostspielig. Die
Neudrucke der heute noch in der Calcografia reale zu Rom aufbewahrten
ausgequetschten und schlecht retuschierten Platten sind zwar billig, aber
künstlerisch so gut wie wertlos. Daher dürften die vorzüglichen, selbst-
verständlich nach guten alten Drucken hergestellten Heliogravüren der
vorliegenden Publikation starken Anklang finden, kommt doch Piranesis
Blättern, abgesehen von ihrem historischen Wert, auch eine prächtige
dekorative Wirkung zu. Auch der Preis ist so gestellt worden, daß sich
selbst der minderbemittelte Kunstfreund mit diesem gediegenen Wand-
schmuck versehen kann. Für Subskribenten des ganzen Werkes kostet
ein Blatt 5, im Einzelverkauf 8 Mark. Giesecke hat zu jeder Tafel einen
kurzen Text geschrieben, der die Bauten erläutert und ihre Geschichte
mitteilt. a. W.
Filippo di Pietro, I Disegni di Andrea del Sarto
negli Uffizi. (Biblioteca della Rivista »Vita d'Arte- 1910.)
Wer immer sieh mit Handzeichnungen von Florentiner Meistern be-
schäftigt, ist auf das grundlegende Werk Bernard Berensons » The Drawings
of the FlorentinePainters« (London 1903) angewiesen, das außer einer Ent-
wicklungsgeschichte der Florentiner Zeichenkunst einen großen catalogue
raisonne aller bekannten Meister enthält. Berenson hatte hier auch zum
ersten Male ein Verzeichnis der vielen über die verschiedensten Samm-
lungen verstreuten Zeichnungen Andrea del Sartos gegeben. Wie es bei
der Riesenleistung dieser Publikation nicht anders möglich sein konnte,
bedurfte das Kapitel über Andrea del Sarto, des bis dahin unbekann-
testen der Großmeister des Cinquecento, einer Nachprüfung und Ver-
tiefung — es ist nicht möglich, wenn man ein großes historisches Werk
schreibt, alle Details aufzufinden, besonders wenn keine Vorarbeiten
vorliegen. Diese Nachprüfung hat, soweit es sich um das Material der
Uffizien handelt, Filippo di Pietro angestellt und er ist dabei zu einer
Reihe von bemerkenswerten Resultaten gekommen, die hier kurz
erwähnt seien, um so mehr, als das Buch schon vergriffen ist. Die
Beschränkung der Studien di Pietros nur auf das Material der Uffizien
rechtfertigt sich damit, daß in dieser Sammlung mehr als die Hälfte des
Gesamtbestandes an Sarto-Zeichnungen aufgehäuft ist.
Von den Zeichnungen der ersten Epoche Sartos werden eine
Anzahl, die Knapp und zum Teil auch Berenson für authentisch erklärt
hatten, als Nachzeichnungen erwiesen, einige mit Namensnennung des
Autors, zum Beispiel Ulf. 270, ist eine Kopie von Sogliani. Die schwache,
bisher allgemein als Sarto angesehene Studie zu einem Leprakranken
(aus den Benizzi-Bildern im Vorhof der SS. Annunziata) wird schlagend
als Arbeit Franciabigios bestimmt, sie ist eine Skizze zu dem S. Giobbe
auf Franciabigios Madonna del S. Giobbe in den Uffizien. Die sehr
geringe Zahl von Franciabigio-Zeichnungen ist damit um ein sicheres
Stück vermehrt.
Gestützt auf Vasari, der behauptet hatte, er besitze die einzig
existierende Kompositionsskizze Andreas (während alle andern Zeich-
nungen Einzelstudien seien), glaubte man bisher, Sarto habe tatsächlich
sich nie das ganze Bild vorher aufgezeichnet. Der Verfasser weist nun an
der Hand zum Teil sehr minderwertiger Kopien nach, daß doch eine An-
zahl von Kompositionsskizzen und Gesamtentwuilcn existiert hat. Da-
gegen spricht er die Komposition Uff. 667, die Berenson für Andreas
erste Zeichnung hielt, dem Meister ab, um sie einem umbrotoskanischen
Eklektiker zu geben, wozu einstweilen noch ein Fragezeichen gesetzt
werden möge. Bei der von Agostino Veneziano im Jahre 1516 gesto-
chenen Pieta-Zeichnung, die Andrea aber so schlecht vorkam, daß er
seinen Namen dann auf der Platte unterdrückte, glaubt di Pietro die
Studie zum Kopf des Engels links gefunden zu haben (Uff. 639). Da
aber der Stich ungenau zu sein scheint und da die Übereinstimmung der
Zeichnung mit dem Detail auf dem Stich nur sehr vage ist, so darf man
wohl nicht mehr sagen als: non liquet.
Die Hauptresultate des Buches beziehen sich auf das Aufzeigen
des Zusammenhanges zwischen Zeichnungen und bekannten oder ver-
lorenen Gemälden. So viel hier Berenson auch schon getan hatte, es sind
bei der Nacharbeit doch noch einige wichtige Ergebnisse zutage geför-
dert. Zunächst wurden drei kleine Skizzen als Arrangementstudien für
das Londoner Porträt des »Bildhauers« erkannt, flüchtige Arbeiterin
hervorgehoben, was Piranesi, der bekanntlich als Radierer, Architekt und
Archäologe angesprochen werden muß, von alten und neuen Meistein
auf seinen künstlerischen und wissenschaftlichen Werdegang mit-
hekommen hat. In die antike Literatur wurde er noch in seiner venezia-
nischen Jugendzeit durch seinen Bruder Angelo, einen gelehrten Kar-
täuser Mönch, eingefühlt. Mit dem alten Rom scheint ihn vor allem der
römische Sammler Nicola Giobbe vertraut gemacht zu haben, dem er
auch im Jahre 1747 seine erste Publikation dediziert hat. Später dürften
seine der Topographie Roms gewidmeten Studien besonders durch den
Antiquar Giovanni Battista Noli gefordert worden sein. Der Architekt in
Piranesi bildete sich an dem Oheim mütterlicherseits Matteo Lucchesi,
vor allem aber an Palladio heran, speziell in der Perspektive waren
Vitruv und der Venezianer Carlo Zucchi seine Lehrer. Spater in Rom
hatte er sicherlich dem persönlichen Umgang mit den beiden berühm-
testen Architekten seiner Zeit, Nicola Salvi, dem Erbauer der Fontana
Trevi, und Luigi Vanvitelli, dem Erbauer des Hafens und des Spitales
von Ancona, viel zu danken. Mit der Theaterarchitektur ward er während
seines ersten römischen Aufenthaltes im Atelier der beiden Brüder Giu-
seppe und Domenico Valeriani bekannt. Zu radieren soll er unter der
Anleitung des Sizilianers Giuseppe Vasi begonnen haben. Sicher aber
hat er als Radierer das meiste von seinem Landsmann Feiice Polanzani
gelernt, und natürlich stand er auch unter dem Einfluß Tiepolos, dessen
Schüler er um 1744 gewesen sein soll. Gewisse phantastische Kompo-
sitionen und vor allem die radierte Folge der »Carceri« sind deutlich von
diesem abhängig.
Ausführlich wird Piranesis archäologische Wirksamkeit behandelt.
Seine methodischen Neuerungen, überhaupt seine großen Verdienste auf
diesem Gebiete werden gewürdigt. Sein Standpunkt (Rom ist der Mittel-
punkt der Welt, die Etrusker sind diejenigen, denen Römer und Griechen
das Beste in der Kunst verdanken) wird beleuchtet, seiner Polemiken
gedacht. Interessant und überzeugend ist die Parallele, in die Giesecke
die Wege setzt, die Piranesi und Winckclmann als Schriftsteller gegangen
sind; beide gelangen von der Erziehung zur Kunstbetrachtung über die
systematische Beschreibung von Kunstdenkmalern zur geschichtlichen
Erforschung und Darstellung der Kunst. Ferner wird gezeigt, daß Piranesi
als (freilich nur auf dem Papier) schöpferischer Architekt gegen den
Strom der Zeit geschwommen ist, den Klassizismus bekämpft hat und
selbst als Barockkünstler aufgefaßt werden muß. Bei der eingehenden
Besprechung der »Vedute di Roma«, die Piranesis bekanntestes und ver-
breitetstes Werk sind und sich über einen Zeitraum von dreißig Jahren
verteilen, wird gesagt, daß sich Piranesis Stil, wie ein Vergleich der
alteren und jüngeren Blätter dieser Folge erhärtet, vom Pleinairistisch-
Malerischen zum Chiaroscuristisch- Malerischen entwickelt hat. Dann
werden jene Werke Piranesis, bei denen das Radierkünstlerische in den
Vordergrund tritt und die durch die »Opere varie di Architettura« und
vor allem durch die »Carceri« am besten charakterisiert sind, behandelt,
endlich die »Antichitä Romane« und die übrigen antiquarischen Werke;
eine chronologische Übersicht sämtlicher Arbeiten des Künstlers macht
den Schluß.
Gieseckes Piranesi, dessen Ahnen in Julius Vogels schönem
Buch »Aus Goethes römischen Tagen« und in Justis klassischem
Winckelmann zu erblicken sind, ist eine gediegene Arbeit, die auf jeder
Seite von gründlicher und selbständiger Forschung Zeugnis ablegt, die
aber leider durch ihre mangelhafte Form stark beeinträchtigt wird. Der
umfangreiche Stoff ist nichts weniger als klar disponiert, die Darstellung
ist umständlich und schwei fällig. Diese beiden groben Versündigungen
gegen die Form machen die Lektüre des Buches wenig erfreulich, was
um so mehr bedauert werden muß, als der Inhalt wirklich gut ist.
Vorzüglich sind die Lichtdrucke. A. W.
Giovanni Battista Piranesi, Le Vedute di Roma.
137 Tafeln in Handpressen-Kupferdruck, den Originalen
getreu nachgebildet, herausgegeben von Dr. Albert
Giesecke. Berlin, Weise & Co.
In gewissem Sinn kann dieses Werk — eines andern Verlages,
aber desselben Autors — als Fortsetzung des vorherbesprochenen
gelten. Die »Römischen Ansichten« sind unstreitig Piranesis populärste
Arbeit. Gute alte Drucke davon sind aber selten und kostspielig. Die
Neudrucke der heute noch in der Calcografia reale zu Rom aufbewahrten
ausgequetschten und schlecht retuschierten Platten sind zwar billig, aber
künstlerisch so gut wie wertlos. Daher dürften die vorzüglichen, selbst-
verständlich nach guten alten Drucken hergestellten Heliogravüren der
vorliegenden Publikation starken Anklang finden, kommt doch Piranesis
Blättern, abgesehen von ihrem historischen Wert, auch eine prächtige
dekorative Wirkung zu. Auch der Preis ist so gestellt worden, daß sich
selbst der minderbemittelte Kunstfreund mit diesem gediegenen Wand-
schmuck versehen kann. Für Subskribenten des ganzen Werkes kostet
ein Blatt 5, im Einzelverkauf 8 Mark. Giesecke hat zu jeder Tafel einen
kurzen Text geschrieben, der die Bauten erläutert und ihre Geschichte
mitteilt. a. W.
Filippo di Pietro, I Disegni di Andrea del Sarto
negli Uffizi. (Biblioteca della Rivista »Vita d'Arte- 1910.)
Wer immer sieh mit Handzeichnungen von Florentiner Meistern be-
schäftigt, ist auf das grundlegende Werk Bernard Berensons » The Drawings
of the FlorentinePainters« (London 1903) angewiesen, das außer einer Ent-
wicklungsgeschichte der Florentiner Zeichenkunst einen großen catalogue
raisonne aller bekannten Meister enthält. Berenson hatte hier auch zum
ersten Male ein Verzeichnis der vielen über die verschiedensten Samm-
lungen verstreuten Zeichnungen Andrea del Sartos gegeben. Wie es bei
der Riesenleistung dieser Publikation nicht anders möglich sein konnte,
bedurfte das Kapitel über Andrea del Sarto, des bis dahin unbekann-
testen der Großmeister des Cinquecento, einer Nachprüfung und Ver-
tiefung — es ist nicht möglich, wenn man ein großes historisches Werk
schreibt, alle Details aufzufinden, besonders wenn keine Vorarbeiten
vorliegen. Diese Nachprüfung hat, soweit es sich um das Material der
Uffizien handelt, Filippo di Pietro angestellt und er ist dabei zu einer
Reihe von bemerkenswerten Resultaten gekommen, die hier kurz
erwähnt seien, um so mehr, als das Buch schon vergriffen ist. Die
Beschränkung der Studien di Pietros nur auf das Material der Uffizien
rechtfertigt sich damit, daß in dieser Sammlung mehr als die Hälfte des
Gesamtbestandes an Sarto-Zeichnungen aufgehäuft ist.
Von den Zeichnungen der ersten Epoche Sartos werden eine
Anzahl, die Knapp und zum Teil auch Berenson für authentisch erklärt
hatten, als Nachzeichnungen erwiesen, einige mit Namensnennung des
Autors, zum Beispiel Ulf. 270, ist eine Kopie von Sogliani. Die schwache,
bisher allgemein als Sarto angesehene Studie zu einem Leprakranken
(aus den Benizzi-Bildern im Vorhof der SS. Annunziata) wird schlagend
als Arbeit Franciabigios bestimmt, sie ist eine Skizze zu dem S. Giobbe
auf Franciabigios Madonna del S. Giobbe in den Uffizien. Die sehr
geringe Zahl von Franciabigio-Zeichnungen ist damit um ein sicheres
Stück vermehrt.
Gestützt auf Vasari, der behauptet hatte, er besitze die einzig
existierende Kompositionsskizze Andreas (während alle andern Zeich-
nungen Einzelstudien seien), glaubte man bisher, Sarto habe tatsächlich
sich nie das ganze Bild vorher aufgezeichnet. Der Verfasser weist nun an
der Hand zum Teil sehr minderwertiger Kopien nach, daß doch eine An-
zahl von Kompositionsskizzen und Gesamtentwuilcn existiert hat. Da-
gegen spricht er die Komposition Uff. 667, die Berenson für Andreas
erste Zeichnung hielt, dem Meister ab, um sie einem umbrotoskanischen
Eklektiker zu geben, wozu einstweilen noch ein Fragezeichen gesetzt
werden möge. Bei der von Agostino Veneziano im Jahre 1516 gesto-
chenen Pieta-Zeichnung, die Andrea aber so schlecht vorkam, daß er
seinen Namen dann auf der Platte unterdrückte, glaubt di Pietro die
Studie zum Kopf des Engels links gefunden zu haben (Uff. 639). Da
aber der Stich ungenau zu sein scheint und da die Übereinstimmung der
Zeichnung mit dem Detail auf dem Stich nur sehr vage ist, so darf man
wohl nicht mehr sagen als: non liquet.
Die Hauptresultate des Buches beziehen sich auf das Aufzeigen
des Zusammenhanges zwischen Zeichnungen und bekannten oder ver-
lorenen Gemälden. So viel hier Berenson auch schon getan hatte, es sind
bei der Nacharbeit doch noch einige wichtige Ergebnisse zutage geför-
dert. Zunächst wurden drei kleine Skizzen als Arrangementstudien für
das Londoner Porträt des »Bildhauers« erkannt, flüchtige Arbeiterin