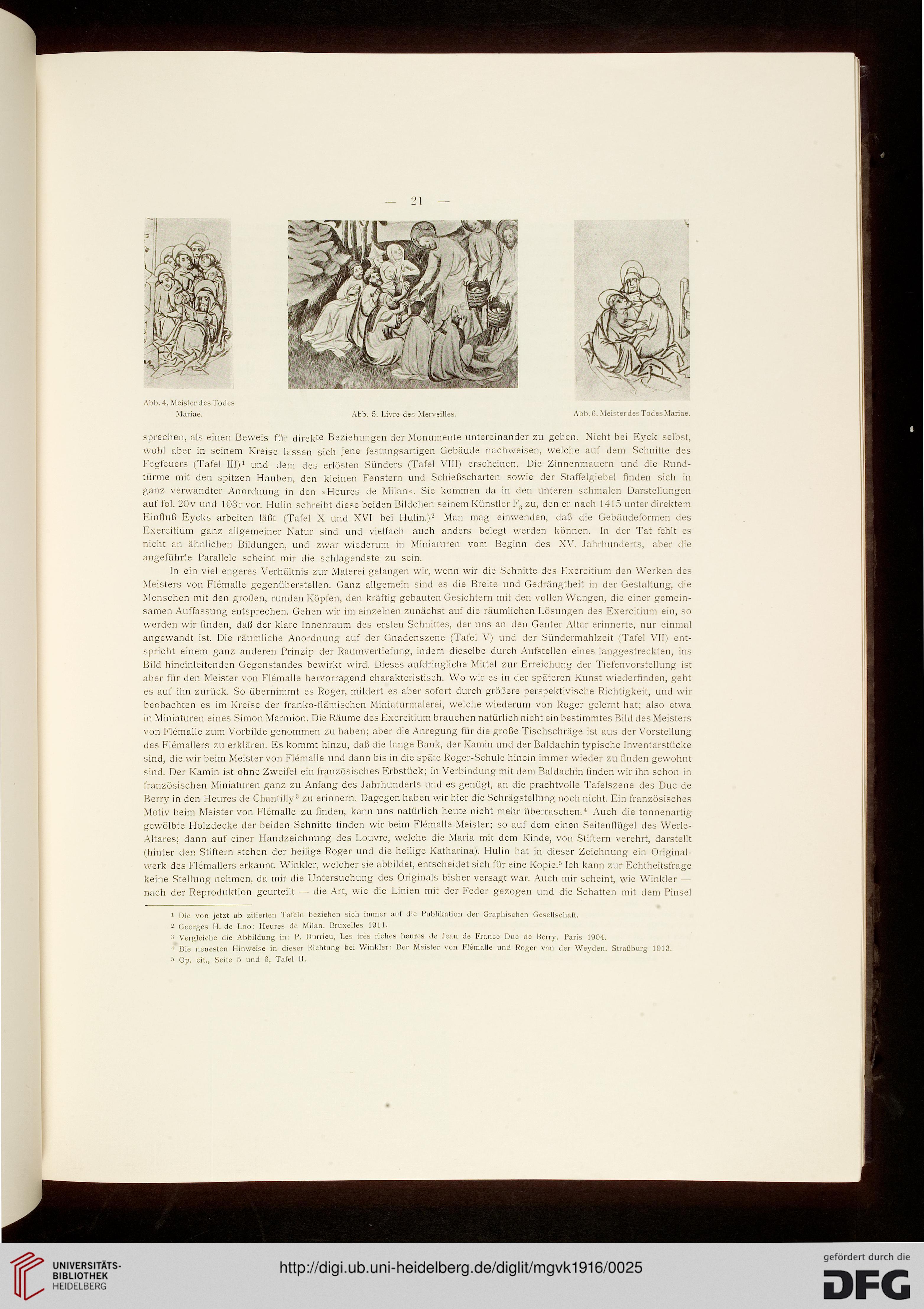21
Abb. 4. Meister des Todes
Mariae.
Abb. 5. Livre des Meiveil
Abb. 6. Meister des Todes Mariae.
sprechen, als einen Beweis für direkte Beziehungen der Monumente untereinander zu geben. Nicht bei Eyck selbst,
wohl aber in seinem Kreise hissen sich jene festungsartigen Gebäude nachweisen, welche auf dem Schnitte des
Kegfeuers (Tafel Uli1 und dem des erlösten Sünders (Tafel Villi erscheinen. Die Zinnenmauern und die Rund-
türme mit den spitzen Hauben, den kleinen Fenstern und Schießscharten sowie der Staffelgiebel finden sich in
ganz verwandter Anordnung in den »Heures de Milan«. Sie kommen da in den unteren schmalen Darstellungen
auf fol. 20v und 103r vor. Hulin schreibt diese beiden Bildchen seinem Künstler F„ zu, den er nach 1415 unter direktem
Einfluß Eycks arbeiten laßt (Tafel X und XVI bei Hulin.)2 Man mag einwenden, daß die Gebäudeformen des
Exercitium ganz allgemeiner Natur sind und vielfach auch anders belegt werden können. In der Tat fehlt es
nicht an ähnlichen Bildungen, und zwar wiederum in Miniaturen vom Beginn des XV. Jahrhunderts, aber die
angeführte Parallele scheint mir die schlagendste zu sein.
In ein viel engeres Verhältnis zur Malerei gelangen wir, wenn wir die Schnitte des Exercitium den Werken des
Meisters von Flemalle gegenüberstellen. Ganz allgemein sind es die Breite und Gedrängtheit in der Gestaltung, die
Menschen mit den großen, runden Köpfen, den kräftig gebauten Gesichtern mit den vollen Wangen, die einer gemein-
samen Auffassung entsprechen. Gehen wir im einzelnen zunächst auf die räumlichen Lösungen des Exercitium ein, so
werden wir finden, daß der klare Innenraum des ersten Schnittes, der uns an den Genter Altar erinnerte, nur einmal
angewandt ist. Die räumliche Anordnung auf der Gnadenszene (Tafel V) und der Sündermahlzeit (Tafel VII) ent-
spricht einem ganz anderen Prinzip der Raumvertiefung, indem dieselbe durch Aufstellen eines langgestreckten, ins
Bild hineinleitenden Gegenstandes bewirkt wird. Dieses aufdringliche Mittel zur Erreichung der Tiefenvorstellung ist
aber für den Meister von Flemalle hervorragend charakteristisch. Wo wir es in der späteren Kunst wiederfinden, geht
es auf ihn zurück. So übernimmt es Roger, mildert es aber sofort durch größere perspektivische Richtigkeit, und wir
beobachten es im Kreise der franko-flämischen Miniaturmalerei, welche wiederum von Roger gelernt hat; also etwa
in Miniaturen eines Simon Marmion. Die Räume des Exercitium brauchen natürlich nicht ein bestimmtes Bild des Meisters
von Flemalle zum Vorbilde genommen zu haben; aber die Anregung für die große Tischschräge ist aus der Vorstellung
des Flemallers zu erklären. Es kommt hinzu, daß die lange Bank, der Kamin und der Baldachin typische Inventarstücke
sind, die wir beim Meister von Flemalle und dann bis in die späte Roger-Schule hinein immer wieder zu finden gewohnt
sind. Der Kamin ist ohne Zweifel ein französisches Erbstück; in Verbindung mit dem Baldachin finden wir ihn schon in
französischen Miniaturen ganz zu Anfang des Jahrhunderts und es genügt, an die prachtvolle Tafelszene des Duc de
Berry in den Heures de Chantilly3 zu erinnern. Dagegen haben wir hier die Schrägstellung noch nicht. Ein französisches
Motiv beim Meister von Flemalle zu finden, kann uns natürlich heute nicht mehr überraschen.' Auch die tonnenartig
gewölbte Holzdecke der beiden Schnitte finden wir beim Flemalle-Meister; so auf dem einen Seitenflügel des Werle-
Altares; dann auf einer Handzeichnung des Louvre, welche die Maria mit dem Kinde, von Stiftern verehrt, darstellt
(hinter den Stiftern stehen der heilige Roger und die heilige Katharina). Hulin hat in dieser Zeichnung ein Original-
werk des Flemallers erkannt. Winkler, welcher sie abbildet, entscheidet sich für eine Kopie.5 Ich kann zur Echtheitsfrage
keine Stellung nehmen, da mir die Untersuchung des Originals bisher versagt war. Auch mir scheint, wie Winkler —
nach der Reproduktion geurteilt — die Art, wie die Linien mit der Feder gezogen und die Schatten mit dem Pinsel
1 Die von jetzt ab zitierten Tafeln beziehen sich immer auf die Publikation der Graphischen Gesellschaft.
- Georges H. de Loo: Heures de Milan. Bruxelles 1911.
'■' Vergleiche die Abbildung in: P. Durrieu, I.es tres riches heures de Jean de France Duc de Berry. Paris 1004.
I Die neuesten Hinweise in dieser Richtung bei Winkler: Der Meister von Flemalle und Roger van der Weyden. Strafjbu
S Op. cit., Seite 5 und 6, Tafel II.
Abb. 4. Meister des Todes
Mariae.
Abb. 5. Livre des Meiveil
Abb. 6. Meister des Todes Mariae.
sprechen, als einen Beweis für direkte Beziehungen der Monumente untereinander zu geben. Nicht bei Eyck selbst,
wohl aber in seinem Kreise hissen sich jene festungsartigen Gebäude nachweisen, welche auf dem Schnitte des
Kegfeuers (Tafel Uli1 und dem des erlösten Sünders (Tafel Villi erscheinen. Die Zinnenmauern und die Rund-
türme mit den spitzen Hauben, den kleinen Fenstern und Schießscharten sowie der Staffelgiebel finden sich in
ganz verwandter Anordnung in den »Heures de Milan«. Sie kommen da in den unteren schmalen Darstellungen
auf fol. 20v und 103r vor. Hulin schreibt diese beiden Bildchen seinem Künstler F„ zu, den er nach 1415 unter direktem
Einfluß Eycks arbeiten laßt (Tafel X und XVI bei Hulin.)2 Man mag einwenden, daß die Gebäudeformen des
Exercitium ganz allgemeiner Natur sind und vielfach auch anders belegt werden können. In der Tat fehlt es
nicht an ähnlichen Bildungen, und zwar wiederum in Miniaturen vom Beginn des XV. Jahrhunderts, aber die
angeführte Parallele scheint mir die schlagendste zu sein.
In ein viel engeres Verhältnis zur Malerei gelangen wir, wenn wir die Schnitte des Exercitium den Werken des
Meisters von Flemalle gegenüberstellen. Ganz allgemein sind es die Breite und Gedrängtheit in der Gestaltung, die
Menschen mit den großen, runden Köpfen, den kräftig gebauten Gesichtern mit den vollen Wangen, die einer gemein-
samen Auffassung entsprechen. Gehen wir im einzelnen zunächst auf die räumlichen Lösungen des Exercitium ein, so
werden wir finden, daß der klare Innenraum des ersten Schnittes, der uns an den Genter Altar erinnerte, nur einmal
angewandt ist. Die räumliche Anordnung auf der Gnadenszene (Tafel V) und der Sündermahlzeit (Tafel VII) ent-
spricht einem ganz anderen Prinzip der Raumvertiefung, indem dieselbe durch Aufstellen eines langgestreckten, ins
Bild hineinleitenden Gegenstandes bewirkt wird. Dieses aufdringliche Mittel zur Erreichung der Tiefenvorstellung ist
aber für den Meister von Flemalle hervorragend charakteristisch. Wo wir es in der späteren Kunst wiederfinden, geht
es auf ihn zurück. So übernimmt es Roger, mildert es aber sofort durch größere perspektivische Richtigkeit, und wir
beobachten es im Kreise der franko-flämischen Miniaturmalerei, welche wiederum von Roger gelernt hat; also etwa
in Miniaturen eines Simon Marmion. Die Räume des Exercitium brauchen natürlich nicht ein bestimmtes Bild des Meisters
von Flemalle zum Vorbilde genommen zu haben; aber die Anregung für die große Tischschräge ist aus der Vorstellung
des Flemallers zu erklären. Es kommt hinzu, daß die lange Bank, der Kamin und der Baldachin typische Inventarstücke
sind, die wir beim Meister von Flemalle und dann bis in die späte Roger-Schule hinein immer wieder zu finden gewohnt
sind. Der Kamin ist ohne Zweifel ein französisches Erbstück; in Verbindung mit dem Baldachin finden wir ihn schon in
französischen Miniaturen ganz zu Anfang des Jahrhunderts und es genügt, an die prachtvolle Tafelszene des Duc de
Berry in den Heures de Chantilly3 zu erinnern. Dagegen haben wir hier die Schrägstellung noch nicht. Ein französisches
Motiv beim Meister von Flemalle zu finden, kann uns natürlich heute nicht mehr überraschen.' Auch die tonnenartig
gewölbte Holzdecke der beiden Schnitte finden wir beim Flemalle-Meister; so auf dem einen Seitenflügel des Werle-
Altares; dann auf einer Handzeichnung des Louvre, welche die Maria mit dem Kinde, von Stiftern verehrt, darstellt
(hinter den Stiftern stehen der heilige Roger und die heilige Katharina). Hulin hat in dieser Zeichnung ein Original-
werk des Flemallers erkannt. Winkler, welcher sie abbildet, entscheidet sich für eine Kopie.5 Ich kann zur Echtheitsfrage
keine Stellung nehmen, da mir die Untersuchung des Originals bisher versagt war. Auch mir scheint, wie Winkler —
nach der Reproduktion geurteilt — die Art, wie die Linien mit der Feder gezogen und die Schatten mit dem Pinsel
1 Die von jetzt ab zitierten Tafeln beziehen sich immer auf die Publikation der Graphischen Gesellschaft.
- Georges H. de Loo: Heures de Milan. Bruxelles 1911.
'■' Vergleiche die Abbildung in: P. Durrieu, I.es tres riches heures de Jean de France Duc de Berry. Paris 1004.
I Die neuesten Hinweise in dieser Richtung bei Winkler: Der Meister von Flemalle und Roger van der Weyden. Strafjbu
S Op. cit., Seite 5 und 6, Tafel II.