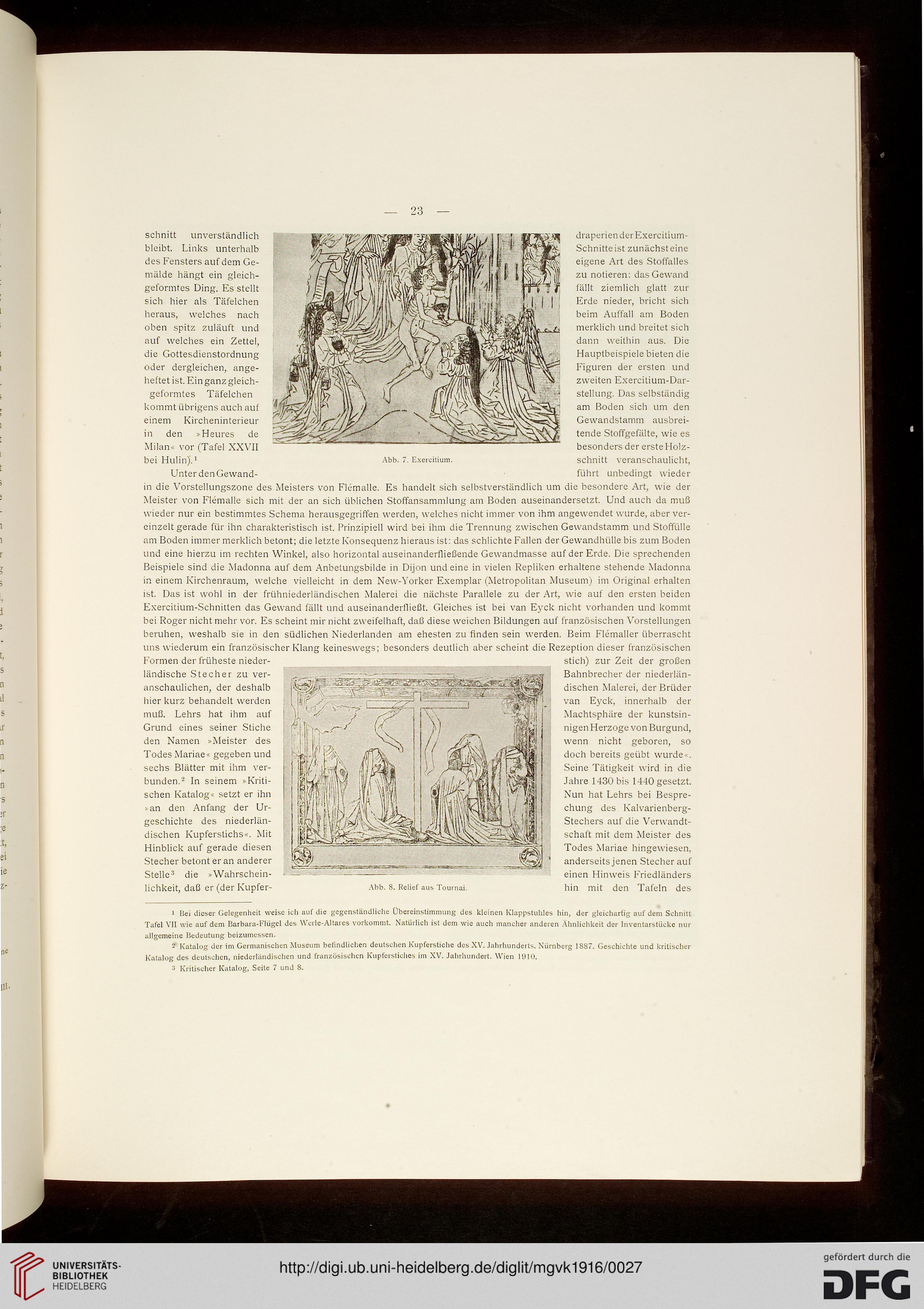23
schnitt unverständlich
bleibt. Links unterhalb
des Fensters auf dem Ge-
mälde hängt ein gleich-
geformtes Ding. Es stellt
sich hier als Täfelchen
heraus, welches nach
oben spitz zuläuft und
auf welches ein Zettel,
die Gottesdienstordnung
oder dergleichen, ange-
heftet ist. Ein ganz gleich-
geformtes Täfelchen
kommt übrigens auch auf
einem Kircheninterieur
in den »Heures de
Milan« vor (Tafel XXVII
bei Hulin).1
Unter den Gewand-
Abb. 7. Exercitium.
draperienderExercitium-
Schnitte ist zunächst eine
eigene Art des Stoffalles
zu notieren: das Gewand
fällt ziemlich glatt zur
Erde nieder, bricht sich
beim Auffall am Boden
merklich und breitet sich
dann weithin aus. Die
Hauptbeispiele bieten die
Figuren der ersten und
zweiten Exercitium-Dar-
stellung. Das selbständig
am Boden sich um den
Gewandstamm ausbrei-
tende Stoffgefälte, wie es
besonders der erste Holz-
schnitt veranschaulicht,
führt unbedingt wieder
in die Vorstellungszone des Meisters von Flemalle. Es handelt sich selbstverständlich um die besondere Art, wie der
Meister von Flemalle sich mit der an sich üblichen Stoffansammlung am Boden auseinandersetzt. Und auch da muß
wieder nur ein bestimmtes Schema herausgegriffen werden, welches nicht immer von ihm angewendet wurde, aber ver-
einzelt gerade für ihn charakteristisch ist. Prinzipiell wird bei ihm die Trennung zwischen Gewandstamm und Stoffülle
am Boden immer merklich betont; die letzte Konsequenz hieraus ist: das schlichte Fallen der Gewandhülle bis zum Boden
und eine hierzu im rechten Winkel, also horizontal auseinanderfließende Gewandmasse auf der Erde. Die sprechenden
Beispiele sind die Madonna auf dem Anbetungsbilde in Dijon und eine in vielen Repliken erhaltene stehende Madonna
in einem Kirchenraum, welche vielleicht in dem New-Yorker Exemplar (Metropolitan Museum) im Original erhalten
ist. Das ist wohl in der frühniederländischen Malerei die nächste Parallele zu der Art, wie auf den ersten beiden
Exercitium-Schnitten das Gewand fällt und auseinanderfließt. Gleiches ist bei van Eyck nicht vorhanden und kommt
bei Roger nicht mehr vor. Es scheint mir nicht zweifelhaft, daß diese weichen Bildungen auf französischen Vorstellungen
beruhen, weshalb sie in den südlichen Niederlanden am ehesten zu finden sein werden. Beim Flemaller überrascht
uns wiederum ein französischer Klang keineswegs; besonders deutlich aber scheint die Rezeption dieser französischen
Formen der früheste nieder-
ländische Stecher zu ver-
anschaulichen, der deshalb
hier kurz behandelt werden
muß. Lehrs hat ihm auf
Grund eines seiner Stiche
den Namen »Meister des
Todes Mariae« gegeben und
sechs Blätter mit ihm ver-
bunden.2 In seinem »Kriti-
schen Katalog« setzt er ihn
> an den Anfang der Ur-
geschichte des niederlän-
dischen Kupferstichs«. Mit
Hinblick auf gerade diesen
Stecher betont er an anderer
Stelle3 die »Wahrschein-
lichkeit, daß er (der Kupfer-
sJsfü
Abb. S. Relief aus Tournai.
stich) zur Zeit der großen
Bahnbrecher der niederlän-
dischen Malerei, der Brüder
van Eyck, innerhalb der
Machtsphäre der kunstsin-
nigen Herzoge von Burgund,
wenn nicht geboren, so
doch bereits geübt wurde«.
Seine Tätigkeit wird in die
Jahre 1430 bis 1440 gesetzt.
Nun hat Lehrs bei Bespre-
chung des Kalvarienberg-
Stechers auf die Verwandt-
schaft mit dem Meister des
Todes Mariae hingewiesen,
anderseits jenen Stecher auf
einen Hinweis Friedländers
hin mit den Tafeln des
i Bei dieser Gelegenheit weise ich auf die gegenständliche Übereinstimmung des kleinen Klappstuhles hin, der gleichartig auf dein Schnitt
Tafel VII wie auf dem Barbara-Flügel des Wcrle-Altares vorkommt. Natürlich ist dem wie auch mancher anderen Ähnlichkeit der Inventarstücke nur
allgemeine Bedeutung beizumessen.
- Katalog der im Germanischen Museum befindlichen deutschen Kupferstiche des XV. Jahrhunderts. Nürnberg 1887. Geschichte und kritischer
Katalog des deutschen, niederländischen und französischen Kupferstiches im XV. Jahrhundert. Wien 1910.
'■> Kritischer Katalog, Seite 7 und 8.
schnitt unverständlich
bleibt. Links unterhalb
des Fensters auf dem Ge-
mälde hängt ein gleich-
geformtes Ding. Es stellt
sich hier als Täfelchen
heraus, welches nach
oben spitz zuläuft und
auf welches ein Zettel,
die Gottesdienstordnung
oder dergleichen, ange-
heftet ist. Ein ganz gleich-
geformtes Täfelchen
kommt übrigens auch auf
einem Kircheninterieur
in den »Heures de
Milan« vor (Tafel XXVII
bei Hulin).1
Unter den Gewand-
Abb. 7. Exercitium.
draperienderExercitium-
Schnitte ist zunächst eine
eigene Art des Stoffalles
zu notieren: das Gewand
fällt ziemlich glatt zur
Erde nieder, bricht sich
beim Auffall am Boden
merklich und breitet sich
dann weithin aus. Die
Hauptbeispiele bieten die
Figuren der ersten und
zweiten Exercitium-Dar-
stellung. Das selbständig
am Boden sich um den
Gewandstamm ausbrei-
tende Stoffgefälte, wie es
besonders der erste Holz-
schnitt veranschaulicht,
führt unbedingt wieder
in die Vorstellungszone des Meisters von Flemalle. Es handelt sich selbstverständlich um die besondere Art, wie der
Meister von Flemalle sich mit der an sich üblichen Stoffansammlung am Boden auseinandersetzt. Und auch da muß
wieder nur ein bestimmtes Schema herausgegriffen werden, welches nicht immer von ihm angewendet wurde, aber ver-
einzelt gerade für ihn charakteristisch ist. Prinzipiell wird bei ihm die Trennung zwischen Gewandstamm und Stoffülle
am Boden immer merklich betont; die letzte Konsequenz hieraus ist: das schlichte Fallen der Gewandhülle bis zum Boden
und eine hierzu im rechten Winkel, also horizontal auseinanderfließende Gewandmasse auf der Erde. Die sprechenden
Beispiele sind die Madonna auf dem Anbetungsbilde in Dijon und eine in vielen Repliken erhaltene stehende Madonna
in einem Kirchenraum, welche vielleicht in dem New-Yorker Exemplar (Metropolitan Museum) im Original erhalten
ist. Das ist wohl in der frühniederländischen Malerei die nächste Parallele zu der Art, wie auf den ersten beiden
Exercitium-Schnitten das Gewand fällt und auseinanderfließt. Gleiches ist bei van Eyck nicht vorhanden und kommt
bei Roger nicht mehr vor. Es scheint mir nicht zweifelhaft, daß diese weichen Bildungen auf französischen Vorstellungen
beruhen, weshalb sie in den südlichen Niederlanden am ehesten zu finden sein werden. Beim Flemaller überrascht
uns wiederum ein französischer Klang keineswegs; besonders deutlich aber scheint die Rezeption dieser französischen
Formen der früheste nieder-
ländische Stecher zu ver-
anschaulichen, der deshalb
hier kurz behandelt werden
muß. Lehrs hat ihm auf
Grund eines seiner Stiche
den Namen »Meister des
Todes Mariae« gegeben und
sechs Blätter mit ihm ver-
bunden.2 In seinem »Kriti-
schen Katalog« setzt er ihn
> an den Anfang der Ur-
geschichte des niederlän-
dischen Kupferstichs«. Mit
Hinblick auf gerade diesen
Stecher betont er an anderer
Stelle3 die »Wahrschein-
lichkeit, daß er (der Kupfer-
sJsfü
Abb. S. Relief aus Tournai.
stich) zur Zeit der großen
Bahnbrecher der niederlän-
dischen Malerei, der Brüder
van Eyck, innerhalb der
Machtsphäre der kunstsin-
nigen Herzoge von Burgund,
wenn nicht geboren, so
doch bereits geübt wurde«.
Seine Tätigkeit wird in die
Jahre 1430 bis 1440 gesetzt.
Nun hat Lehrs bei Bespre-
chung des Kalvarienberg-
Stechers auf die Verwandt-
schaft mit dem Meister des
Todes Mariae hingewiesen,
anderseits jenen Stecher auf
einen Hinweis Friedländers
hin mit den Tafeln des
i Bei dieser Gelegenheit weise ich auf die gegenständliche Übereinstimmung des kleinen Klappstuhles hin, der gleichartig auf dein Schnitt
Tafel VII wie auf dem Barbara-Flügel des Wcrle-Altares vorkommt. Natürlich ist dem wie auch mancher anderen Ähnlichkeit der Inventarstücke nur
allgemeine Bedeutung beizumessen.
- Katalog der im Germanischen Museum befindlichen deutschen Kupferstiche des XV. Jahrhunderts. Nürnberg 1887. Geschichte und kritischer
Katalog des deutschen, niederländischen und französischen Kupferstiches im XV. Jahrhundert. Wien 1910.
'■> Kritischer Katalog, Seite 7 und 8.