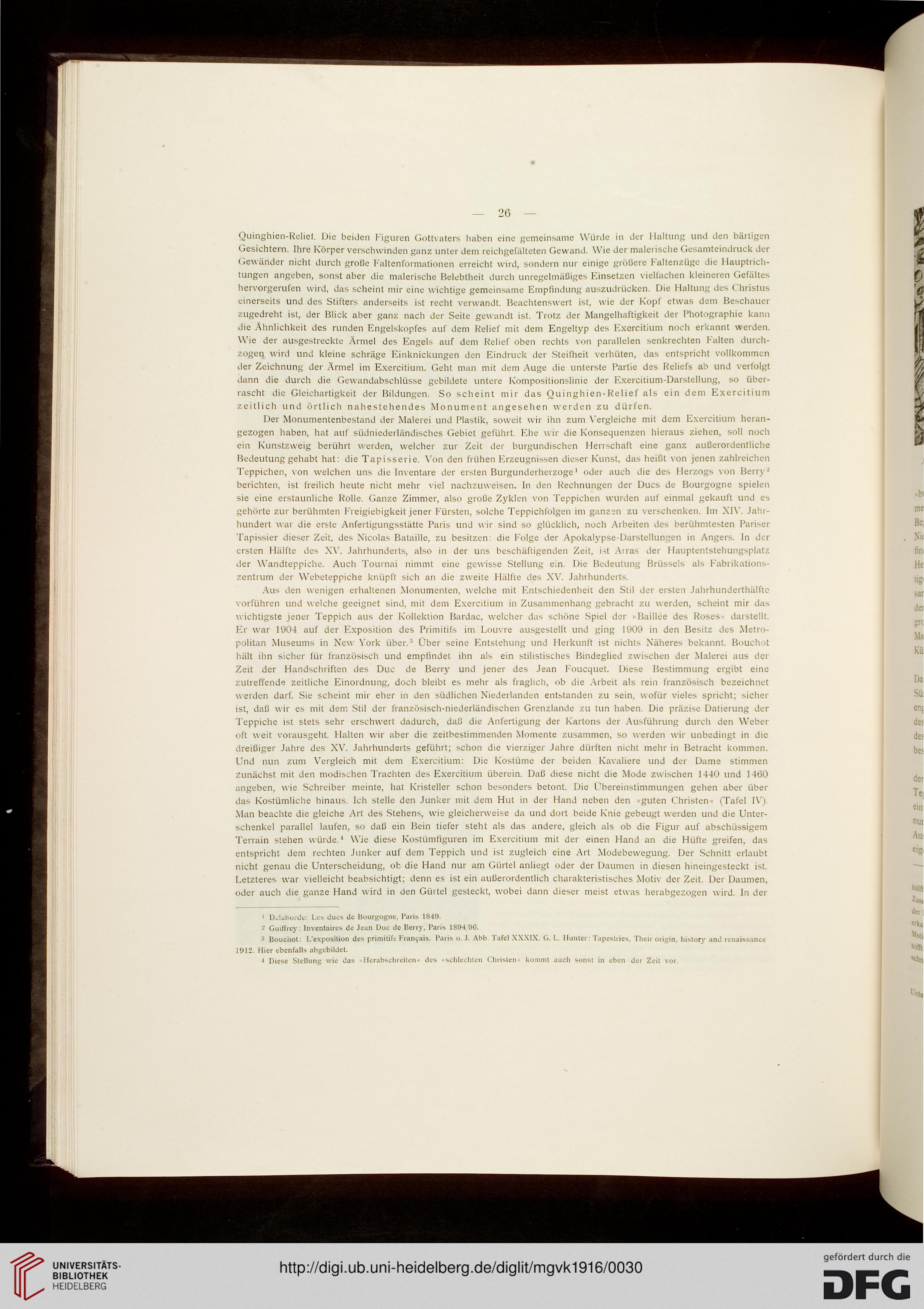— 26 —
Quinghien-Reliet. Die beiden Figuren Gottvaters haben eine gemeinsame Würde in der Haltung und den bärtigen
Gesichtern. Ihre Körper verschwinden ganz unter dem reichgefälteten Gewand. Wie der malerische Gesamteindruck der
Gewänder nicht durch große Paltenformationen erreicht wird, sondern nur einige größere Faltenzüge die Hauptrich-
tungen angeben, sonst aber die malerische Belebtheit durch unregelmäßiges Einsetzen viellachen kleineren Gefältes
hervorgerufen wird, das scheint mir eine wichtige gemeinsame Empfindung auszudrücken. Die Haltung des Christus
einerseits und des Stifters anderseits ist recht verwandt. Beachtenswert ist, wie der Kopf etwas dem Beschauer
zugedreht ist, der Blick aber ganz nach der Seite gewandt ist. Trotz der Mangelhaftigkeit der Photographie kann
die Ähnlichkeit des runden Engelskopfes auf dem Relief mit dem Engeltyp des Exercitium noch erkannt werden.
Wie der ausgestreckte Ärmel des Engels auf dem Relief oben rechts von parallelen senkrechten Falten durch-
zogen wird und kleine schräge Einknickungen den Eindruck der Steifheit verhüten, das entspricht vollkommen
der Zeichnung der Ärmel im Exercitium. Geht man mit dem Äuge die unterste Partie des Reliefs ab und verfolgt
dann die durch die Gewandabschlüsse gebildete untere Kompositionslinie der Exercitium-Darstellung, so über-
rascht die Gleichartigkeit der Bildungen. So scheint mir das Ouingbien-Relief als ein dem Exercitium
zeitlich und örtlich nahestehendes Monument angesehen werden zu dürfen.
Der Monumentenbestand der Malerei und Plastik, soweit wir ihn zum Vergleiche mit dem Exercitium heran-
gezogen haben, hat auf südniederländisches Gebiet geführt. Ehe wir die Konsequenzen hieraus ziehen, soll noch
ein Kunstzweig berührt werden, welcher zur Zeit der burgundischen Herrschaft eine ganz außerordentliche
Bedeutung gehabt hat: die Tapisserie. Von den frühen Erzeugnissen dieser Kunst, das heißt von jenen zahlreichen
Teppichen, von welchen uns die Inventare der eisten Burgunderherzoge' oder auch die des Herzogs von Berry"
berichten, ist freilich heute nicht mehr viel nachzuweisen. In den Rechnungen der Duos de Bourgogne spielen
sie eine erstaunliche Rolle. Ganze Zimmer, also große Zyklen von Teppichen wurden aul einmal gekauft und es
gehörte zur berühmten Freigiebigkeit jener Fürsten, solche Teppichfolgen im ganzen zu verschenken. Im XIV. Jahr-
hundert war die erste Anfertigungsstätte Paris und wir sind so glücklich, noch Arbeiten des berühmtesten Parisei
Tapissier dieser Zeit, des Nicolas Bataille, zu besitzen: die Folge der Apokalypse-Darstellungen in Angers. In der
ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts, also in der uns beschäftigenden Zeit, ist Anas der Hauptentstehungsplatz
der Wandteppiche. Auch Tournai nimmt eine gewisse Stellung ein. Die Bedeutung Brüssels als Fabrikations-
zentrum der Webeteppiche knüpft sich an die zweite Hälfte des XV*. Jahrhunderts.
Aus den wenigen erhaltenen Monumenten, welche mit Entschiedenheit den Stil der ersten Jahrhunderthälfte
vorführen und welche geeignet sind, mit dem Exercitium in Zusammenhang gebracht zu werden, scheint mir das
wichtigste jener Teppich aus der Kollektion Bardac, welcher das schöne Spiel der »Baillee des Roses darstellt.
Er war 1904 auf der Exposition des Primitifs im Louvre ausgestellt und ging 1009 in den Besitz des Metro-
politan Museums in New York über." Über seine Entstehung und Herkunft ist nichts Näheres bekannt. Bouchüt
hält ihn sicher für französisch und empfindet ihn als ein stilistisches Bindeglied zwischen der Malerei aus der
Zeit der Handschriften des Duc de Berry und jener des Jean Foucquet. Diese Bestimmung ergibt eine
zutreffende zeitliche Einordnung, doch bleibt es mehr als fraglich, ob die Arbeit als rein französisch bezeichnet
werden darf. Sie scheint mir eher in den südlichen Niederlanden entstanden zu sein, wofür vieles spricht; sicher
ist, daß wir es mit dem Stil der französisch-niederländischen Grenzlande zu tun haben. Die präzise Datierung der
Teppiche ist stets sehr erschwert dadurch, daß die Anfertigung der Kartons der Ausführung durch den Weber
oft weit vorausgeht. Halten wir aber die zeitbestimmenden Momente zusammen, so werden wir unbedingt in die
dreißiger Jahre des XV. Jahrhunderts geführt; schon die vierziger Jahre dürften nicht mehr in Betracht kommen.
Und nun zum Vergleich mit dem Exercitium: Die Kostüme der beiden Kavaliere und der Dame stimmen
zunächst mit den modischen Trachten des Exercitium überein. Daß diese nicht die Mode zwischen 1440 und 1 Ion
angeben, wie Schreiber meinte, hat Kristeller schon besonders betont. Die Übereinstimmungen gehen aber über
das Kostümliche hinaus. Ich stelle den Junker mit dem Hut in der Hand neben den guten Christen« (Tafel IVi
Man beachte die gleiche Art des Stehens, wie gleicherweise da und dort beide Knie gebeugt werden und die Unter-
schenkel parallel laufen, so daß ein Bein tiefer steht als das andere, gleich als ob die Figur auf abschüssigem
Terrain stehen würde.' Wie diese Kostümfiguren im Exercitium mit der einen Hand an die Hüfte greifen, das
entspricht dem rechten Junker auf dem Teppich und ist zugleich eine Art Modebewegung. Der Schnitt erlaubt
nicht genau die Unterscheidung, ob die Hand nur am Gürtel anliegt oder der Daumen in diesen hineingesteckt ist.
Letzteres war vielleicht beabsichtigt; denn es ist ein außerordentlich charakteristisches Motiv der Zeit. Der Daumen,
oder auch die ganze Hand wird in den Gürtel gesteckt, wobei dann dieser meist etwas herabgezogen wird. In der
i Ddaburdt Lcs ducs de Bourgogne, Paris 1849.
- Guiffrcy: Inventaires de Jean Due de Berry, Paris 1894 CJC.
3 üouchot: L'exposiüon des primitifs Francais. Paris o. J. Abb Tafel XXXIX. G. L Iluntci : I apestries, Theii origin, lustory and renaissance
Hier ebenfalls abgebildet,
i Diese Stellung wie das Herabscbreiten« des schlechten Christen kommt aueli sonst in eben dei Zeil vor.
Quinghien-Reliet. Die beiden Figuren Gottvaters haben eine gemeinsame Würde in der Haltung und den bärtigen
Gesichtern. Ihre Körper verschwinden ganz unter dem reichgefälteten Gewand. Wie der malerische Gesamteindruck der
Gewänder nicht durch große Paltenformationen erreicht wird, sondern nur einige größere Faltenzüge die Hauptrich-
tungen angeben, sonst aber die malerische Belebtheit durch unregelmäßiges Einsetzen viellachen kleineren Gefältes
hervorgerufen wird, das scheint mir eine wichtige gemeinsame Empfindung auszudrücken. Die Haltung des Christus
einerseits und des Stifters anderseits ist recht verwandt. Beachtenswert ist, wie der Kopf etwas dem Beschauer
zugedreht ist, der Blick aber ganz nach der Seite gewandt ist. Trotz der Mangelhaftigkeit der Photographie kann
die Ähnlichkeit des runden Engelskopfes auf dem Relief mit dem Engeltyp des Exercitium noch erkannt werden.
Wie der ausgestreckte Ärmel des Engels auf dem Relief oben rechts von parallelen senkrechten Falten durch-
zogen wird und kleine schräge Einknickungen den Eindruck der Steifheit verhüten, das entspricht vollkommen
der Zeichnung der Ärmel im Exercitium. Geht man mit dem Äuge die unterste Partie des Reliefs ab und verfolgt
dann die durch die Gewandabschlüsse gebildete untere Kompositionslinie der Exercitium-Darstellung, so über-
rascht die Gleichartigkeit der Bildungen. So scheint mir das Ouingbien-Relief als ein dem Exercitium
zeitlich und örtlich nahestehendes Monument angesehen werden zu dürfen.
Der Monumentenbestand der Malerei und Plastik, soweit wir ihn zum Vergleiche mit dem Exercitium heran-
gezogen haben, hat auf südniederländisches Gebiet geführt. Ehe wir die Konsequenzen hieraus ziehen, soll noch
ein Kunstzweig berührt werden, welcher zur Zeit der burgundischen Herrschaft eine ganz außerordentliche
Bedeutung gehabt hat: die Tapisserie. Von den frühen Erzeugnissen dieser Kunst, das heißt von jenen zahlreichen
Teppichen, von welchen uns die Inventare der eisten Burgunderherzoge' oder auch die des Herzogs von Berry"
berichten, ist freilich heute nicht mehr viel nachzuweisen. In den Rechnungen der Duos de Bourgogne spielen
sie eine erstaunliche Rolle. Ganze Zimmer, also große Zyklen von Teppichen wurden aul einmal gekauft und es
gehörte zur berühmten Freigiebigkeit jener Fürsten, solche Teppichfolgen im ganzen zu verschenken. Im XIV. Jahr-
hundert war die erste Anfertigungsstätte Paris und wir sind so glücklich, noch Arbeiten des berühmtesten Parisei
Tapissier dieser Zeit, des Nicolas Bataille, zu besitzen: die Folge der Apokalypse-Darstellungen in Angers. In der
ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts, also in der uns beschäftigenden Zeit, ist Anas der Hauptentstehungsplatz
der Wandteppiche. Auch Tournai nimmt eine gewisse Stellung ein. Die Bedeutung Brüssels als Fabrikations-
zentrum der Webeteppiche knüpft sich an die zweite Hälfte des XV*. Jahrhunderts.
Aus den wenigen erhaltenen Monumenten, welche mit Entschiedenheit den Stil der ersten Jahrhunderthälfte
vorführen und welche geeignet sind, mit dem Exercitium in Zusammenhang gebracht zu werden, scheint mir das
wichtigste jener Teppich aus der Kollektion Bardac, welcher das schöne Spiel der »Baillee des Roses darstellt.
Er war 1904 auf der Exposition des Primitifs im Louvre ausgestellt und ging 1009 in den Besitz des Metro-
politan Museums in New York über." Über seine Entstehung und Herkunft ist nichts Näheres bekannt. Bouchüt
hält ihn sicher für französisch und empfindet ihn als ein stilistisches Bindeglied zwischen der Malerei aus der
Zeit der Handschriften des Duc de Berry und jener des Jean Foucquet. Diese Bestimmung ergibt eine
zutreffende zeitliche Einordnung, doch bleibt es mehr als fraglich, ob die Arbeit als rein französisch bezeichnet
werden darf. Sie scheint mir eher in den südlichen Niederlanden entstanden zu sein, wofür vieles spricht; sicher
ist, daß wir es mit dem Stil der französisch-niederländischen Grenzlande zu tun haben. Die präzise Datierung der
Teppiche ist stets sehr erschwert dadurch, daß die Anfertigung der Kartons der Ausführung durch den Weber
oft weit vorausgeht. Halten wir aber die zeitbestimmenden Momente zusammen, so werden wir unbedingt in die
dreißiger Jahre des XV. Jahrhunderts geführt; schon die vierziger Jahre dürften nicht mehr in Betracht kommen.
Und nun zum Vergleich mit dem Exercitium: Die Kostüme der beiden Kavaliere und der Dame stimmen
zunächst mit den modischen Trachten des Exercitium überein. Daß diese nicht die Mode zwischen 1440 und 1 Ion
angeben, wie Schreiber meinte, hat Kristeller schon besonders betont. Die Übereinstimmungen gehen aber über
das Kostümliche hinaus. Ich stelle den Junker mit dem Hut in der Hand neben den guten Christen« (Tafel IVi
Man beachte die gleiche Art des Stehens, wie gleicherweise da und dort beide Knie gebeugt werden und die Unter-
schenkel parallel laufen, so daß ein Bein tiefer steht als das andere, gleich als ob die Figur auf abschüssigem
Terrain stehen würde.' Wie diese Kostümfiguren im Exercitium mit der einen Hand an die Hüfte greifen, das
entspricht dem rechten Junker auf dem Teppich und ist zugleich eine Art Modebewegung. Der Schnitt erlaubt
nicht genau die Unterscheidung, ob die Hand nur am Gürtel anliegt oder der Daumen in diesen hineingesteckt ist.
Letzteres war vielleicht beabsichtigt; denn es ist ein außerordentlich charakteristisches Motiv der Zeit. Der Daumen,
oder auch die ganze Hand wird in den Gürtel gesteckt, wobei dann dieser meist etwas herabgezogen wird. In der
i Ddaburdt Lcs ducs de Bourgogne, Paris 1849.
- Guiffrcy: Inventaires de Jean Due de Berry, Paris 1894 CJC.
3 üouchot: L'exposiüon des primitifs Francais. Paris o. J. Abb Tafel XXXIX. G. L Iluntci : I apestries, Theii origin, lustory and renaissance
Hier ebenfalls abgebildet,
i Diese Stellung wie das Herabscbreiten« des schlechten Christen kommt aueli sonst in eben dei Zeil vor.