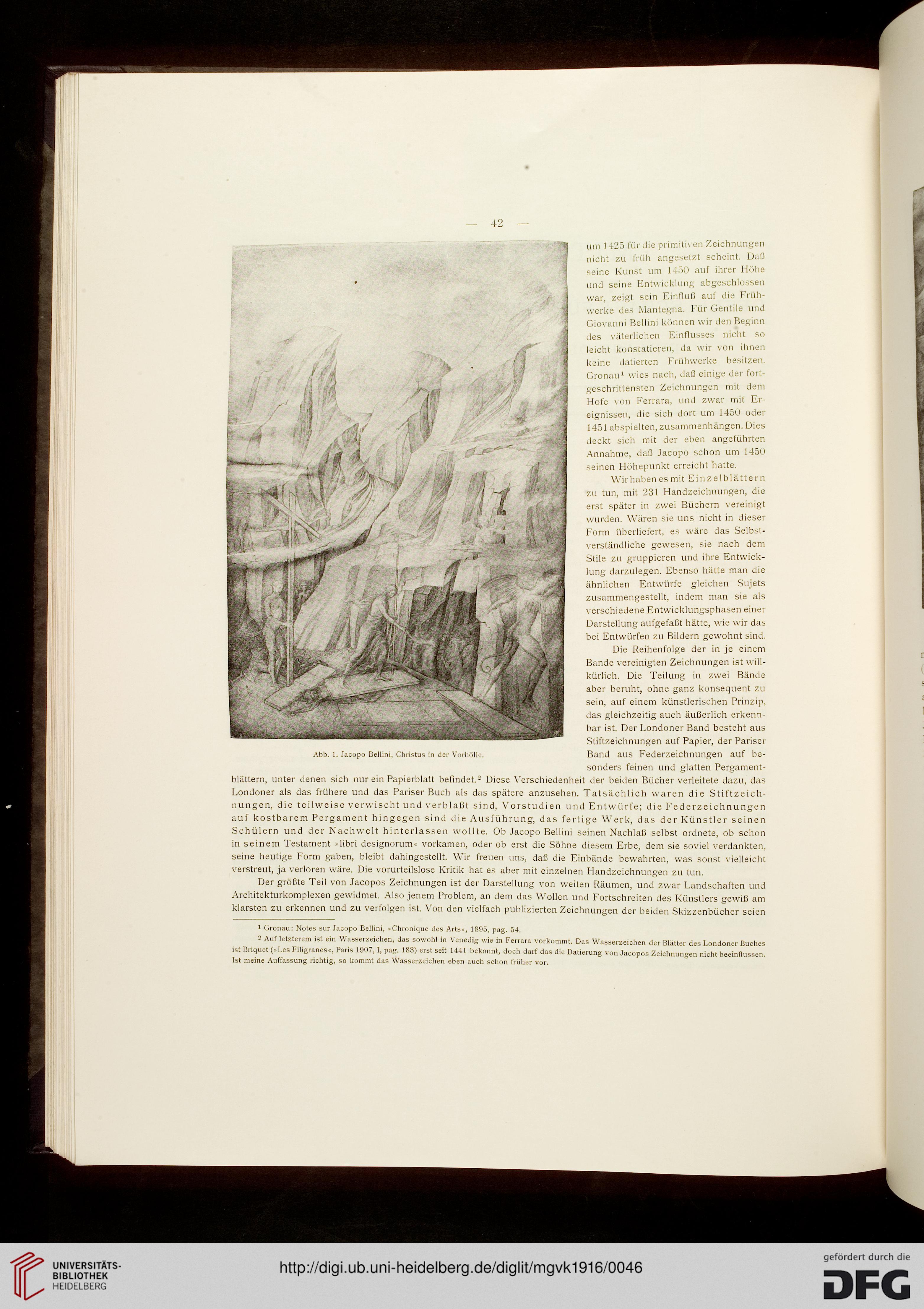— 42 —
.<*»
I
in
um 1 425 für die primitiven Zeichnungen
nicht zu früh angesetzt scheint. Daß
seine Kunst um 14.30 auf ihrer Höhe
und seine Entwicklung abgeschlossen
war, zeigt sein Einfluß auf die Früh-
werke des Mantegna. Für Gentile und
Giovanni Bellini können wir den Beginn
des väterlichen Einflusses nicht so
leicht konstatieren, da wir von ihnen
keine datierten Frühwerke besitzen.
Gronau1 wies nach, daß einige der fort-
geschrittensten Zeichnungen mit dem
Hofe von Ferrara, und zwar mit Er-
eignissen, die sich dort um 1450 oder
1451 abspielten,zusammenhängen. Dies
deckt sich mit der eben angeführten
Annahme, daß Jacopo schon um 1450
seinen Höhepunkt erreicht hatte.
Wir haben es mit E i n z e 1 b 1 ä 11 e r n
zu tun, mit 231 Handzeichnungen, die
erst später in zwei Büchern vereinigt
wurden. Wären sie uns nicht in dieser
Form überliefert, es wäre das Selbst-
verständliche gewesen, sie nach dem
Stile zu gruppieren und ihre Entwick-
lung darzulegen. Ebenso hätte man die
ähnlichen Entwürfe gleichen Sujets
zusammengestellt, indem man sie als
verschiedene Entwicklungsphasen einer
Darstellung aufgefaßt hätte, wie wir das
bei Entwürfen zu Bildern gewohnt sind.
Die Reihenfolge der in je einem
Bande vereinigten Zeichnungen ist will-
kürlieh. Die Teilung in zwei Bände
aber beruht, ohne ganz konsequent zu
sein, auf einem künstlerischen Prinzip,
das gleichzeitig auch äußerlich erkenn-
bar ist. Der Londoner Band besteht aus
Stiftzeichnungen auf Papier, der Pariser
Band aus Federzeichnungen auf be-
sonders feinen und glatten Pergament-
blättern, unter denen sich nur ein Papierblatt befindet."- Diese Verschiedenheit der beiden Bücher verleitete dazu, das
Londoner als das frühere und das Pariser Buch als das spätere anzusehen. Tatsächlich waren die Stiftzeich-
nungen, die teilweise verwischt und verblaßt sind, Vorstudien und Entwürfe; die Federzeichnungen
auf kostbarem Pergament hingegen sind die Ausführung, das fertige Werk, das der Künstler seinen
Schülern und der Nachwelt hinterlassen wollte. Ob Jacopo Bellini seinen Nachlaß selbst ordnete, ob schon
in seinem Testament »libri designorum« vorkamen, oder ob erst die Söhne diesem Erbe, dem sie soviel verdankten,
seine heutige Form gaben, bleibt dahingestellt. Wir freuen uns, daß die Einbände bewahrten, was sonst vielleicht
verstreut, ja verloren wäre. Die vorurteilslose Kritik hat es aber mit einzelnen Handzeichnungen zu tun.
Der größte Teil von Jacopos Zeichnungen ist der Darstellung von weiten Räumen, und zwar Landschaften und
Architekturkomplexen gewidmet. Also jenem Problem, an dem das Wollen und Fortschreiten des Künstlers gewiß am
klarsten zu erkennen und zu verfolgen ist. Von den vielfach publizierten Zeichnungen der beiden Skizzenbücher seien
i
Abb. 1. Jacopo Bellini, Christus in der Vorhölle.
i Gronau: Notes sur Jacopo Bellini, »Chronique des Arts«, 1895, pag, 54,
2 Auf letzterem ist ein Wasserzeichen, das sowohl in Venedig wie in Ferrara vorkommt. Das Wasserzeichen der Blatter des Londoner Buches
ist Briquet (>Les Filigranes«, Paris 1907,1, Pag. 183) erst seit 1441 bekannt, doch darf das die Datierung von Jacopos Zeichnungen nicht beeinflussen.
Ist meine Auffassung richtig, so kommt das Wasserzeichen eben auch schon früher vor.
.<*»
I
in
um 1 425 für die primitiven Zeichnungen
nicht zu früh angesetzt scheint. Daß
seine Kunst um 14.30 auf ihrer Höhe
und seine Entwicklung abgeschlossen
war, zeigt sein Einfluß auf die Früh-
werke des Mantegna. Für Gentile und
Giovanni Bellini können wir den Beginn
des väterlichen Einflusses nicht so
leicht konstatieren, da wir von ihnen
keine datierten Frühwerke besitzen.
Gronau1 wies nach, daß einige der fort-
geschrittensten Zeichnungen mit dem
Hofe von Ferrara, und zwar mit Er-
eignissen, die sich dort um 1450 oder
1451 abspielten,zusammenhängen. Dies
deckt sich mit der eben angeführten
Annahme, daß Jacopo schon um 1450
seinen Höhepunkt erreicht hatte.
Wir haben es mit E i n z e 1 b 1 ä 11 e r n
zu tun, mit 231 Handzeichnungen, die
erst später in zwei Büchern vereinigt
wurden. Wären sie uns nicht in dieser
Form überliefert, es wäre das Selbst-
verständliche gewesen, sie nach dem
Stile zu gruppieren und ihre Entwick-
lung darzulegen. Ebenso hätte man die
ähnlichen Entwürfe gleichen Sujets
zusammengestellt, indem man sie als
verschiedene Entwicklungsphasen einer
Darstellung aufgefaßt hätte, wie wir das
bei Entwürfen zu Bildern gewohnt sind.
Die Reihenfolge der in je einem
Bande vereinigten Zeichnungen ist will-
kürlieh. Die Teilung in zwei Bände
aber beruht, ohne ganz konsequent zu
sein, auf einem künstlerischen Prinzip,
das gleichzeitig auch äußerlich erkenn-
bar ist. Der Londoner Band besteht aus
Stiftzeichnungen auf Papier, der Pariser
Band aus Federzeichnungen auf be-
sonders feinen und glatten Pergament-
blättern, unter denen sich nur ein Papierblatt befindet."- Diese Verschiedenheit der beiden Bücher verleitete dazu, das
Londoner als das frühere und das Pariser Buch als das spätere anzusehen. Tatsächlich waren die Stiftzeich-
nungen, die teilweise verwischt und verblaßt sind, Vorstudien und Entwürfe; die Federzeichnungen
auf kostbarem Pergament hingegen sind die Ausführung, das fertige Werk, das der Künstler seinen
Schülern und der Nachwelt hinterlassen wollte. Ob Jacopo Bellini seinen Nachlaß selbst ordnete, ob schon
in seinem Testament »libri designorum« vorkamen, oder ob erst die Söhne diesem Erbe, dem sie soviel verdankten,
seine heutige Form gaben, bleibt dahingestellt. Wir freuen uns, daß die Einbände bewahrten, was sonst vielleicht
verstreut, ja verloren wäre. Die vorurteilslose Kritik hat es aber mit einzelnen Handzeichnungen zu tun.
Der größte Teil von Jacopos Zeichnungen ist der Darstellung von weiten Räumen, und zwar Landschaften und
Architekturkomplexen gewidmet. Also jenem Problem, an dem das Wollen und Fortschreiten des Künstlers gewiß am
klarsten zu erkennen und zu verfolgen ist. Von den vielfach publizierten Zeichnungen der beiden Skizzenbücher seien
i
Abb. 1. Jacopo Bellini, Christus in der Vorhölle.
i Gronau: Notes sur Jacopo Bellini, »Chronique des Arts«, 1895, pag, 54,
2 Auf letzterem ist ein Wasserzeichen, das sowohl in Venedig wie in Ferrara vorkommt. Das Wasserzeichen der Blatter des Londoner Buches
ist Briquet (>Les Filigranes«, Paris 1907,1, Pag. 183) erst seit 1441 bekannt, doch darf das die Datierung von Jacopos Zeichnungen nicht beeinflussen.
Ist meine Auffassung richtig, so kommt das Wasserzeichen eben auch schon früher vor.