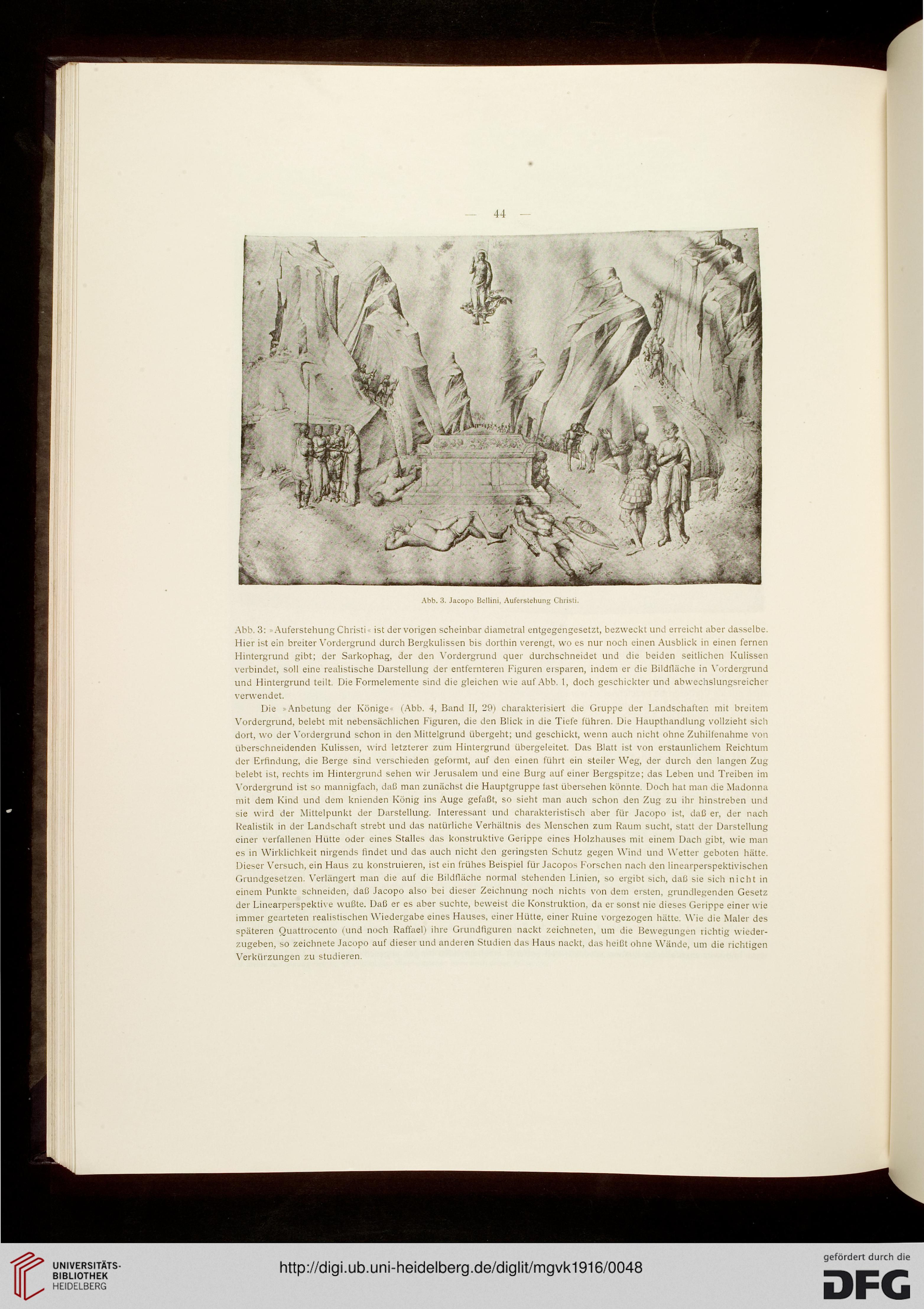44
Abb. 3. Jacopr
Abb. 3: Auferstehung Christi ist der vorigen scheinbar diametral entgegengesetzt, bezweckt und erreicht aber dasselbe.
Hier ist ein breiter Vordergrund durch Bergkulissen bis dorthin verengt, wo es nur noch einen Ausblick in einen fernen
Hintergrund gibt; der Sarkophag, der den Vordergrund quer durchschneidet und die beiden seitlichen Kulissen
verbindet, soll eine realistische Darstellung der entfernteren Figuren ersparen, indem er die BildfUiche in Vordergrund
und Hintergrund teilt. Die Formelemente sind die gleichen wie auf Abb. 1, doch geschickter und abwechslungsreicher
verwendet.
Die -Anbetung der Könige (Abb. 4, Band II, 29) charakterisiert die Gruppe der Landschafter, mit breitem
Vordergrund, belebt mit nebensächlichen Figuren, die den Blick in die Tiefe führen. Die Haupthandlung vollzieht sich
dort, wo der Vordergi und schon in den Mittelgrund übergeht; und geschickt, wenn auch nicht ohne Zuhilfenahme von
überschneidenden Kulissen, wird letzterer zum Hintergrund übergeleitet. Das Blatt ist von erstaunlichem Reichtum
der Erfindung, die Berge sind verschieden geformt, auf den einen führt ein steiler Weg, der durch den langen Zug
belebt ist, rechts im Hintergrund sehen wir Jerusalem und eine Burg auf einer Bergspitze; das Leben und Treiben im
Vordergrund ist so mannigfach, daß man zunächst die Hauptgruppe fast übersehen könnte. Doch hat man die Madonna
mit dem Kind und dem knienden König ins Auge gefaßt, so sieht man auch schon den Zug zu ihr hinstreben und
sie wird der Mittelpunkt der Darstellung. Interessant und charakteristisch aber für Jacopo ist, daß er, der nach
Realistik in der Landschaft strebt und das natürliche Verhältnis des Menschen zum Raum sucht, statt der Darstellung
einer verfallenen Hütte oder eines Stalles das konstruktive Gerippe eines Holzhauses mit einem Dach gibt, wie man
es in Wirklichkeit nirgends findet und das auch nicht den geringsten Schutz gegen Wind und Wetter geboten hätte.
Dieser Versuch, ein Haus zu konstruieren, ist cm frühes Beispiel für Jacopos Forschen nach den linearperspektivischen
Grundgesetzen. Verlängert man die auf die Bildfläche normal stehenden Linien, so ergibt sich, daß sie sich nicht in
einem Punkte schneiden, daß Jacopo also bei dieser Zeichnung noch nichts von dem ersten, grundlegenden Gesetz
der Linearperspektive wußte. Daß er es aber suchte, beweist die Konstruktion, da er sonst nie dieses Gerippe einer wie
immer gearteten realistischen Wiedergabe eines Hauses, einer Hütte, einer Ruine vorgezogen hätte. Wie die Maler des
späteren Quattrocento mnd noch Raffaeli ihre Grundfiguren nackt zeichneten, um die Bewegungen richtig wieder-
zugeben, so zeichnete Jacopo auf dieser und anderen Studien das Haus nackt, das heißt ohne Wände, um die richtigen
Verkürzungen zu studieren.
Abb. 3. Jacopr
Abb. 3: Auferstehung Christi ist der vorigen scheinbar diametral entgegengesetzt, bezweckt und erreicht aber dasselbe.
Hier ist ein breiter Vordergrund durch Bergkulissen bis dorthin verengt, wo es nur noch einen Ausblick in einen fernen
Hintergrund gibt; der Sarkophag, der den Vordergrund quer durchschneidet und die beiden seitlichen Kulissen
verbindet, soll eine realistische Darstellung der entfernteren Figuren ersparen, indem er die BildfUiche in Vordergrund
und Hintergrund teilt. Die Formelemente sind die gleichen wie auf Abb. 1, doch geschickter und abwechslungsreicher
verwendet.
Die -Anbetung der Könige (Abb. 4, Band II, 29) charakterisiert die Gruppe der Landschafter, mit breitem
Vordergrund, belebt mit nebensächlichen Figuren, die den Blick in die Tiefe führen. Die Haupthandlung vollzieht sich
dort, wo der Vordergi und schon in den Mittelgrund übergeht; und geschickt, wenn auch nicht ohne Zuhilfenahme von
überschneidenden Kulissen, wird letzterer zum Hintergrund übergeleitet. Das Blatt ist von erstaunlichem Reichtum
der Erfindung, die Berge sind verschieden geformt, auf den einen führt ein steiler Weg, der durch den langen Zug
belebt ist, rechts im Hintergrund sehen wir Jerusalem und eine Burg auf einer Bergspitze; das Leben und Treiben im
Vordergrund ist so mannigfach, daß man zunächst die Hauptgruppe fast übersehen könnte. Doch hat man die Madonna
mit dem Kind und dem knienden König ins Auge gefaßt, so sieht man auch schon den Zug zu ihr hinstreben und
sie wird der Mittelpunkt der Darstellung. Interessant und charakteristisch aber für Jacopo ist, daß er, der nach
Realistik in der Landschaft strebt und das natürliche Verhältnis des Menschen zum Raum sucht, statt der Darstellung
einer verfallenen Hütte oder eines Stalles das konstruktive Gerippe eines Holzhauses mit einem Dach gibt, wie man
es in Wirklichkeit nirgends findet und das auch nicht den geringsten Schutz gegen Wind und Wetter geboten hätte.
Dieser Versuch, ein Haus zu konstruieren, ist cm frühes Beispiel für Jacopos Forschen nach den linearperspektivischen
Grundgesetzen. Verlängert man die auf die Bildfläche normal stehenden Linien, so ergibt sich, daß sie sich nicht in
einem Punkte schneiden, daß Jacopo also bei dieser Zeichnung noch nichts von dem ersten, grundlegenden Gesetz
der Linearperspektive wußte. Daß er es aber suchte, beweist die Konstruktion, da er sonst nie dieses Gerippe einer wie
immer gearteten realistischen Wiedergabe eines Hauses, einer Hütte, einer Ruine vorgezogen hätte. Wie die Maler des
späteren Quattrocento mnd noch Raffaeli ihre Grundfiguren nackt zeichneten, um die Bewegungen richtig wieder-
zugeben, so zeichnete Jacopo auf dieser und anderen Studien das Haus nackt, das heißt ohne Wände, um die richtigen
Verkürzungen zu studieren.