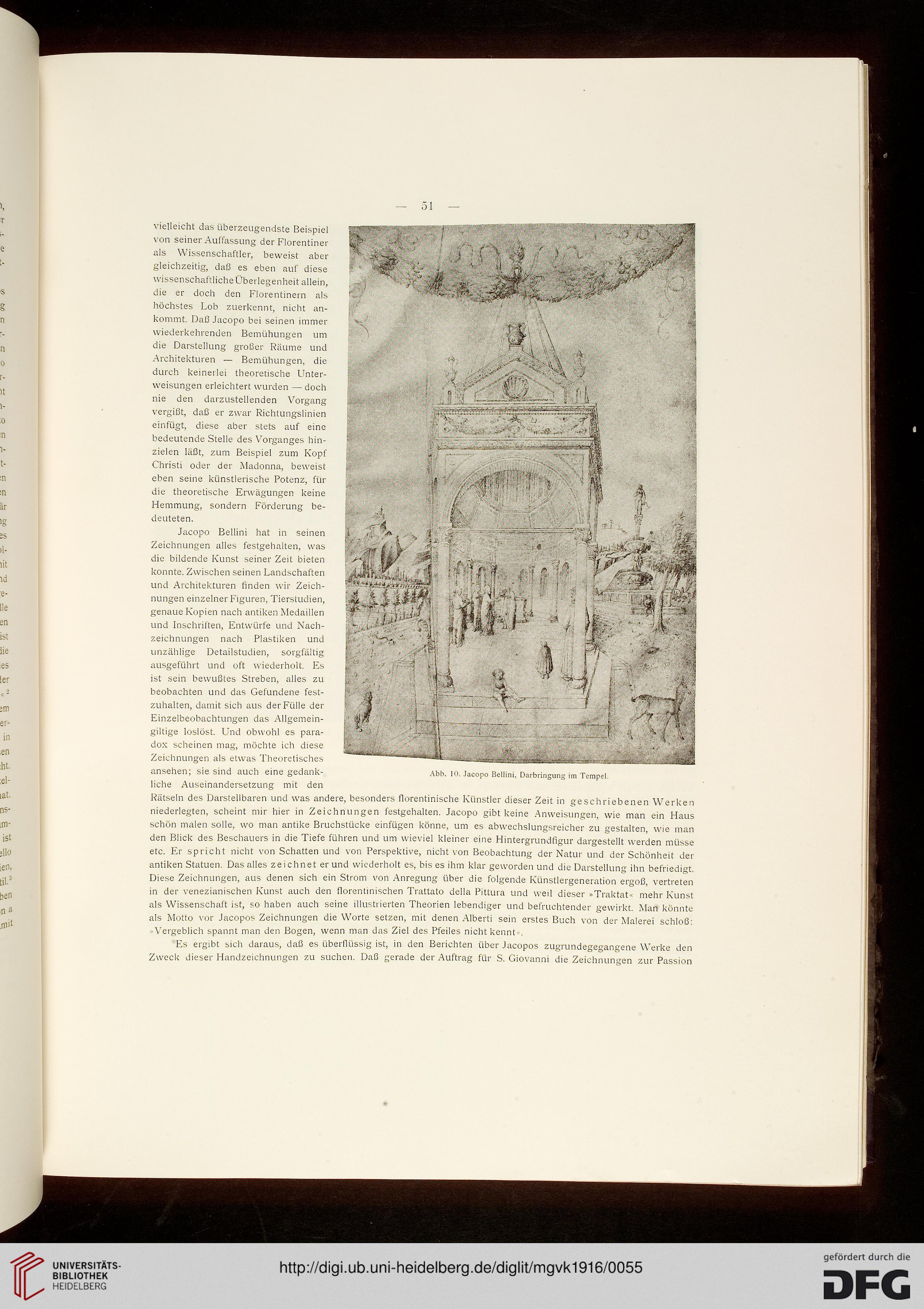51
vielleicht das überzeugendste Beispiel
von seiner Auffassung der Florentiner
als Wissenschaftler, beweist aber
gleichzeitig, daß es eben auf diese
wissenschaftliche Überlegenheit allein,
die er doch den Florentinern als
höchstes Lob zuerkennt, nicht an-
kommt. Daß Jacopo bei seinen immer
wiederkehrenden Bemühungen um
die Darstellung großer Räume und
Architekturen — Bemühungen, die
durch keinerlei theoretische Unter-
weisungen erleichtert wurden — doch
nie den darzustellenden Vorgang
vergißt, daß er zwar Richtungslinien
einfügt, diese aber stets auf eine
bedeutende Stelle des Vorganges hin-
zielen läßt, zum Beispiel zum Kopf
Christi oder der Madonna, beweist
eben seine künstlerische Potenz, für
die theoretische Erwägungen keine
Hemmung, sondern Förderung be-
deuteten.
Jacopo Bellini hat in seinen
Zeichnungen alles festgehalten, was
die bildende Kunst seiner Zeit bieten
konnte. Zwischen seinen Landschaften
und Architekturen finden wir Zeich-
nungen einzelner Figuren, Tierstudien,
genaue Kopien nach antiken Medaillen
und Inschriften, Entwürfe und Nach-
zeichnungen nach Plastiken und
unzählige Detailstudien, sorgfältig
ausgeführt und oft wiederholt. Es
ist sein bewußtes Streben, alles zu
beobachten und das Gefundene fest-
zuhalten, damit sich aus der Fülle der
Einzelbeobachtungen das Allgemein-
giltige loslöst. Und obwohl es para-
dox scheinen mag, möchte ich diese
Zeichnungen als etwas Theoretisches
ansehen; sie sind auch eine gedank-
liche Auseinandersetzung mit den
Rätseln des Darstellbaren und was andere, besonders florentinische Künstler dieser Zeit in geschriebenen Werken
niederlegten, scheint mir hier in Zeichnungen festgehalten. Jacopo gibt keine Anweisungen, wie man ein Haus
schön malen solle, wo man antike Bruchstücke einfügen könne, um es abwechslungsreicher zu gestalten, wie man
den Blick des Beschauers in die Tiefe führen und um wieviel kleiner eine Hintergrundfigur dargestellt werden müsse
etc. Er spricht nicht von Schatten und von Perspektive, nicht von Beobachtung der Natur und der Schönheit der
antiken Statuen. Das alles zeichnet er und wiederholt es, bis es ihm klar geworden und die Darstellung ihn befriedigt.
Diese Zeichnungen, aus denen sich ein Strom von Anregung über die folgende Künstlergeneration ergoß, vertreten
in der venezianischen Kunst auch den florentinischen Trattato della Pittura und weil dieser »Traktat« mehr Kunst
als Wissenschaft ist, so haben auch seine illustrierten Theorien lebendiger und befruchtender gewirkt. Man könnte
als Motto vor Jacopos Zeichnungen die Worte setzen, mit denen Alberti sein erstes Buch von der Malerei schloß:
»Vergeblich spannt man den Bogen, wenn man das Ziel des Pfeiles nicht kennt-.
'Es ergibt sich daraus, daß es überflüssig ist, in den Berichten über Jacopos zugrundegegangene Werke den
Zweck dieser Handzeichnungen zu suchen. Daß gerade der Auftrag für S.Giovanni die Zeichnungen zur Passion
m
m
. i
Abb. 10. Jacopo Bellini, Darbringung im Tempel.
vielleicht das überzeugendste Beispiel
von seiner Auffassung der Florentiner
als Wissenschaftler, beweist aber
gleichzeitig, daß es eben auf diese
wissenschaftliche Überlegenheit allein,
die er doch den Florentinern als
höchstes Lob zuerkennt, nicht an-
kommt. Daß Jacopo bei seinen immer
wiederkehrenden Bemühungen um
die Darstellung großer Räume und
Architekturen — Bemühungen, die
durch keinerlei theoretische Unter-
weisungen erleichtert wurden — doch
nie den darzustellenden Vorgang
vergißt, daß er zwar Richtungslinien
einfügt, diese aber stets auf eine
bedeutende Stelle des Vorganges hin-
zielen läßt, zum Beispiel zum Kopf
Christi oder der Madonna, beweist
eben seine künstlerische Potenz, für
die theoretische Erwägungen keine
Hemmung, sondern Förderung be-
deuteten.
Jacopo Bellini hat in seinen
Zeichnungen alles festgehalten, was
die bildende Kunst seiner Zeit bieten
konnte. Zwischen seinen Landschaften
und Architekturen finden wir Zeich-
nungen einzelner Figuren, Tierstudien,
genaue Kopien nach antiken Medaillen
und Inschriften, Entwürfe und Nach-
zeichnungen nach Plastiken und
unzählige Detailstudien, sorgfältig
ausgeführt und oft wiederholt. Es
ist sein bewußtes Streben, alles zu
beobachten und das Gefundene fest-
zuhalten, damit sich aus der Fülle der
Einzelbeobachtungen das Allgemein-
giltige loslöst. Und obwohl es para-
dox scheinen mag, möchte ich diese
Zeichnungen als etwas Theoretisches
ansehen; sie sind auch eine gedank-
liche Auseinandersetzung mit den
Rätseln des Darstellbaren und was andere, besonders florentinische Künstler dieser Zeit in geschriebenen Werken
niederlegten, scheint mir hier in Zeichnungen festgehalten. Jacopo gibt keine Anweisungen, wie man ein Haus
schön malen solle, wo man antike Bruchstücke einfügen könne, um es abwechslungsreicher zu gestalten, wie man
den Blick des Beschauers in die Tiefe führen und um wieviel kleiner eine Hintergrundfigur dargestellt werden müsse
etc. Er spricht nicht von Schatten und von Perspektive, nicht von Beobachtung der Natur und der Schönheit der
antiken Statuen. Das alles zeichnet er und wiederholt es, bis es ihm klar geworden und die Darstellung ihn befriedigt.
Diese Zeichnungen, aus denen sich ein Strom von Anregung über die folgende Künstlergeneration ergoß, vertreten
in der venezianischen Kunst auch den florentinischen Trattato della Pittura und weil dieser »Traktat« mehr Kunst
als Wissenschaft ist, so haben auch seine illustrierten Theorien lebendiger und befruchtender gewirkt. Man könnte
als Motto vor Jacopos Zeichnungen die Worte setzen, mit denen Alberti sein erstes Buch von der Malerei schloß:
»Vergeblich spannt man den Bogen, wenn man das Ziel des Pfeiles nicht kennt-.
'Es ergibt sich daraus, daß es überflüssig ist, in den Berichten über Jacopos zugrundegegangene Werke den
Zweck dieser Handzeichnungen zu suchen. Daß gerade der Auftrag für S.Giovanni die Zeichnungen zur Passion
m
m
. i
Abb. 10. Jacopo Bellini, Darbringung im Tempel.