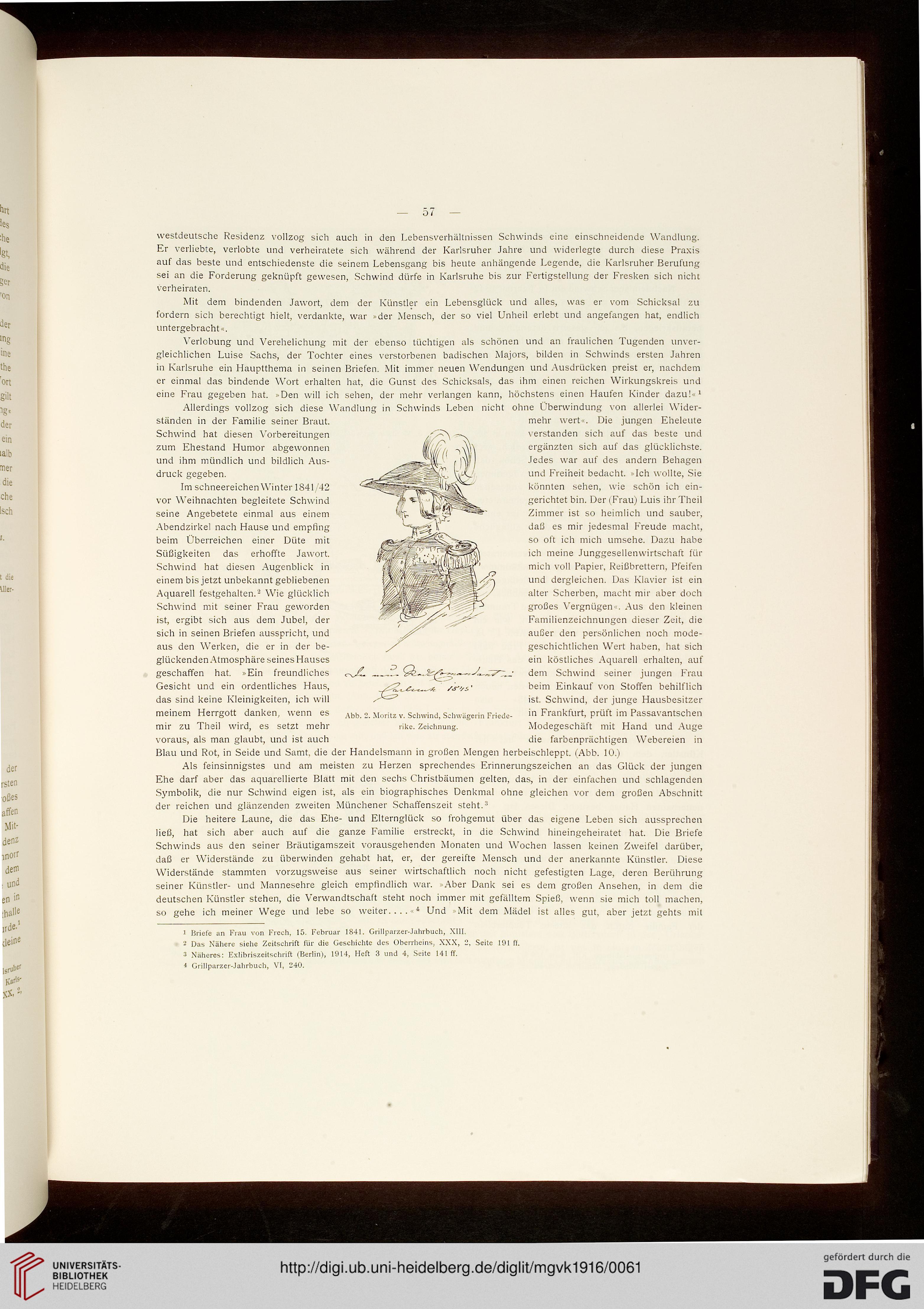öl —
westdeutsche Residenz vollzog sich auch in den Lebensverhältnissen Schwinds eine einschneidende Wandlung.
Er verliebte, verlobte und verheiratete sich während der Karlsruher Jahre und widerlegte durch diese Praxis
auf das beste und entschiedenste die seinem Lebensgang bis heute anhängende Legende, die Karlsruher Berufung
sei an die Forderung geknüpft gewesen, Schwind dürfe in Karlsruhe bis zur Fertigstellung der Fresken sich nicht
verheiraten.
Mit dem bindenden Jawort, dem der Künstler ein Lebensglück und alles, was er vom Schicksal zu
fordern sich berechtigt hielt, verdankte, war »der Mensch, der so viel Unheil erlebt und angefangen hat, endlich
untergebracht«.
Verlobung und Verehelichung mit der ebenso tüchtigen als schönen und an fraulichen Tugenden unver-
gleichlichen Luise Sachs, der Tochter eines verstorbenen badischen Majors, bilden in Schwinds ersten Jahren
in Karlsruhe ein Hauptthema in seinen Briefen. Mit immer neuen Wendungen und Ausdrücken preist er, nachdem
er einmal das bindende Wort erhalten hat, die Gunst des Schicksals, das ihm einen reichen Wirkungskreis und
eine Frau gegeben hat. »Den will ich sehen, der mehr verlangen kann, höchstens einen Haufen Kinder dazu!«1
Allerdings vollzog sich diese Wandlung in Schwinds Leben nicht ohne Überwindung von allerlei Wider-
ständen in der Familie seiner Braut.
Schwind hat diesen Vorbereitungen
zum Ehestand Humor abgewonnen
und ihm mündlich und bildlich Aus-
druck gegeben.
Im schneereichen Winter 1841/42
vor Weihnachten begleitete Schwind
seine Angebetete einmal aus einem
Abendzirkel nach Hause und empfing
beim Überreichen einer Düte mit
Süßigkeiten das erhoffte Jawort.
Schwind hat diesen Augenblick in
einem bis jetzt unbekannt gebliebenen
Aquarell festgehalten.- Wie glücklich
Schwind mit seiner Frau geworden
ist, ergibt sich aus dem Jubel, der
sich in seinen Briefen ausspricht, und
aus den Werken, die er in der be-
glückenden Atmosphäre seines Hauses
geschaffen hat. »Ein freundliches
Gesicht und ein ordentliches Haus,
das sind keine Kleinigkeiten, ich will
meinem Herrgott danken, wenn es
mir zu Theil wird, es setzt mehr
voraus, als man glaubt, und ist auch
^Z
&
^~~
---i^x
Abb. 2. Moritz v. Schwind, Schwägerin Friede
rike. Zeichnung.
mehr werte. Die jungen Eheleute
verstanden sich auf das beste und
ergänzten sich auf das glücklichste.
Jedes war auf des andern Behagen
und Freiheit bedacht. »Ich wollte, Sie
könnten sehen, wie schön ich ein-
gerichtet bin. Der (Frau) Luis ihr Theil
Zimmer ist so heimlich und sauber,
daß es mir jedesmal Freude macht,
so oft ich mich umsehe. Dazu habe
ich meine Junggesellenwirtschaft für
mich voll Papier, Reißbrettern, Pfeifen
und dergleichen. Das Klavier ist ein
alter Scherben, macht mir aber doch
großes Vergnügen«. Aus den kleinen
Familienzeichnungen dieser Zeit, die
außer den persönlichen noch mode-
geschichtlichen Wert haben, hat sich
ein köstliches Aquarell erhalten, auf
dem Schwind seiner jungen Frau
beim Einkauf von Stoffen behilflich
ist. Schwind, der junge Hausbesitzer
in Frankfurt, prüft im Passavantschen
Modegeschäft mit Hand und Auge
die farbenprächtigen Webereien in
Blau und Rot, in Seide und Samt, die der Handelsmann in großen Mengen herbeischleppt. (Abb. 10.)
Als feinsinnigstes und am meisten zu Herzen sprechendes Erinnerungszeichen an das Glück der jungen
Ehe darf aber das aquarellierte Blatt mit den sechs Christbäumen gelten, das, in der einfachen und schlagenden
Symbolik, die nur Schwind eigen ist, als ein biographisches Denkmal ohne gleichen vor dem großen Abschnitt
der reichen und glänzenden zweiten Münchener Schaffenszeit steht."
Die heitere Laune, die das Ehe- und Elternglück so frohgemut über das eigene Leben sich aussprechen
ließ, hat sich aber auch auf die ganze Familie erstreckt, in die Schwind hineingeheiratet hat. Die Briefe
Schwinds aus den seiner Bräutigamszeit vorausgehenden Monaten und Wochen lassen keinen Zweifel darüber,
daß er Widerstände zu überwinden gehabt hat, er, der gereifte Mensch und der anerkannte Künstler. Diese
Widerstände stammten vorzugsweise aus seiner wirtschaftlich noch nicht gefestigten Lage, deren Berührung
seiner Künstler- und Mannesehre gleich empfindlich war. Aber Dank sei es dem großen Ansehen, in dem die
deutschen Künstler stehen, die Verwandtschaft steht noch immer mit gefälltem Spieß, wenn sie mich toll machen,
so gehe ich meiner Wege und lebe so weiter....-4 Und -Mit dem Mädel ist alles gut, aber jetzt gehts mit
1 Briefe an Frau von Frech, 15. Februar 184!. Grillparzer-Jahrbuch, XIII.
2 Das Nähere siehe Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, XXX, 2, Seite 191 ff.
3 Näheres: Exlibriszeitschrift (Berlin), 1914, Heft 3 und 4, Seite 141 ff.
■1 Grillparzer-Jahrbuch, VI, 240.
.JalllJäiiss
lllllllffl?
ms :■
westdeutsche Residenz vollzog sich auch in den Lebensverhältnissen Schwinds eine einschneidende Wandlung.
Er verliebte, verlobte und verheiratete sich während der Karlsruher Jahre und widerlegte durch diese Praxis
auf das beste und entschiedenste die seinem Lebensgang bis heute anhängende Legende, die Karlsruher Berufung
sei an die Forderung geknüpft gewesen, Schwind dürfe in Karlsruhe bis zur Fertigstellung der Fresken sich nicht
verheiraten.
Mit dem bindenden Jawort, dem der Künstler ein Lebensglück und alles, was er vom Schicksal zu
fordern sich berechtigt hielt, verdankte, war »der Mensch, der so viel Unheil erlebt und angefangen hat, endlich
untergebracht«.
Verlobung und Verehelichung mit der ebenso tüchtigen als schönen und an fraulichen Tugenden unver-
gleichlichen Luise Sachs, der Tochter eines verstorbenen badischen Majors, bilden in Schwinds ersten Jahren
in Karlsruhe ein Hauptthema in seinen Briefen. Mit immer neuen Wendungen und Ausdrücken preist er, nachdem
er einmal das bindende Wort erhalten hat, die Gunst des Schicksals, das ihm einen reichen Wirkungskreis und
eine Frau gegeben hat. »Den will ich sehen, der mehr verlangen kann, höchstens einen Haufen Kinder dazu!«1
Allerdings vollzog sich diese Wandlung in Schwinds Leben nicht ohne Überwindung von allerlei Wider-
ständen in der Familie seiner Braut.
Schwind hat diesen Vorbereitungen
zum Ehestand Humor abgewonnen
und ihm mündlich und bildlich Aus-
druck gegeben.
Im schneereichen Winter 1841/42
vor Weihnachten begleitete Schwind
seine Angebetete einmal aus einem
Abendzirkel nach Hause und empfing
beim Überreichen einer Düte mit
Süßigkeiten das erhoffte Jawort.
Schwind hat diesen Augenblick in
einem bis jetzt unbekannt gebliebenen
Aquarell festgehalten.- Wie glücklich
Schwind mit seiner Frau geworden
ist, ergibt sich aus dem Jubel, der
sich in seinen Briefen ausspricht, und
aus den Werken, die er in der be-
glückenden Atmosphäre seines Hauses
geschaffen hat. »Ein freundliches
Gesicht und ein ordentliches Haus,
das sind keine Kleinigkeiten, ich will
meinem Herrgott danken, wenn es
mir zu Theil wird, es setzt mehr
voraus, als man glaubt, und ist auch
^Z
&
^~~
---i^x
Abb. 2. Moritz v. Schwind, Schwägerin Friede
rike. Zeichnung.
mehr werte. Die jungen Eheleute
verstanden sich auf das beste und
ergänzten sich auf das glücklichste.
Jedes war auf des andern Behagen
und Freiheit bedacht. »Ich wollte, Sie
könnten sehen, wie schön ich ein-
gerichtet bin. Der (Frau) Luis ihr Theil
Zimmer ist so heimlich und sauber,
daß es mir jedesmal Freude macht,
so oft ich mich umsehe. Dazu habe
ich meine Junggesellenwirtschaft für
mich voll Papier, Reißbrettern, Pfeifen
und dergleichen. Das Klavier ist ein
alter Scherben, macht mir aber doch
großes Vergnügen«. Aus den kleinen
Familienzeichnungen dieser Zeit, die
außer den persönlichen noch mode-
geschichtlichen Wert haben, hat sich
ein köstliches Aquarell erhalten, auf
dem Schwind seiner jungen Frau
beim Einkauf von Stoffen behilflich
ist. Schwind, der junge Hausbesitzer
in Frankfurt, prüft im Passavantschen
Modegeschäft mit Hand und Auge
die farbenprächtigen Webereien in
Blau und Rot, in Seide und Samt, die der Handelsmann in großen Mengen herbeischleppt. (Abb. 10.)
Als feinsinnigstes und am meisten zu Herzen sprechendes Erinnerungszeichen an das Glück der jungen
Ehe darf aber das aquarellierte Blatt mit den sechs Christbäumen gelten, das, in der einfachen und schlagenden
Symbolik, die nur Schwind eigen ist, als ein biographisches Denkmal ohne gleichen vor dem großen Abschnitt
der reichen und glänzenden zweiten Münchener Schaffenszeit steht."
Die heitere Laune, die das Ehe- und Elternglück so frohgemut über das eigene Leben sich aussprechen
ließ, hat sich aber auch auf die ganze Familie erstreckt, in die Schwind hineingeheiratet hat. Die Briefe
Schwinds aus den seiner Bräutigamszeit vorausgehenden Monaten und Wochen lassen keinen Zweifel darüber,
daß er Widerstände zu überwinden gehabt hat, er, der gereifte Mensch und der anerkannte Künstler. Diese
Widerstände stammten vorzugsweise aus seiner wirtschaftlich noch nicht gefestigten Lage, deren Berührung
seiner Künstler- und Mannesehre gleich empfindlich war. Aber Dank sei es dem großen Ansehen, in dem die
deutschen Künstler stehen, die Verwandtschaft steht noch immer mit gefälltem Spieß, wenn sie mich toll machen,
so gehe ich meiner Wege und lebe so weiter....-4 Und -Mit dem Mädel ist alles gut, aber jetzt gehts mit
1 Briefe an Frau von Frech, 15. Februar 184!. Grillparzer-Jahrbuch, XIII.
2 Das Nähere siehe Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, XXX, 2, Seite 191 ff.
3 Näheres: Exlibriszeitschrift (Berlin), 1914, Heft 3 und 4, Seite 141 ff.
■1 Grillparzer-Jahrbuch, VI, 240.
.JalllJäiiss
lllllllffl?
ms :■