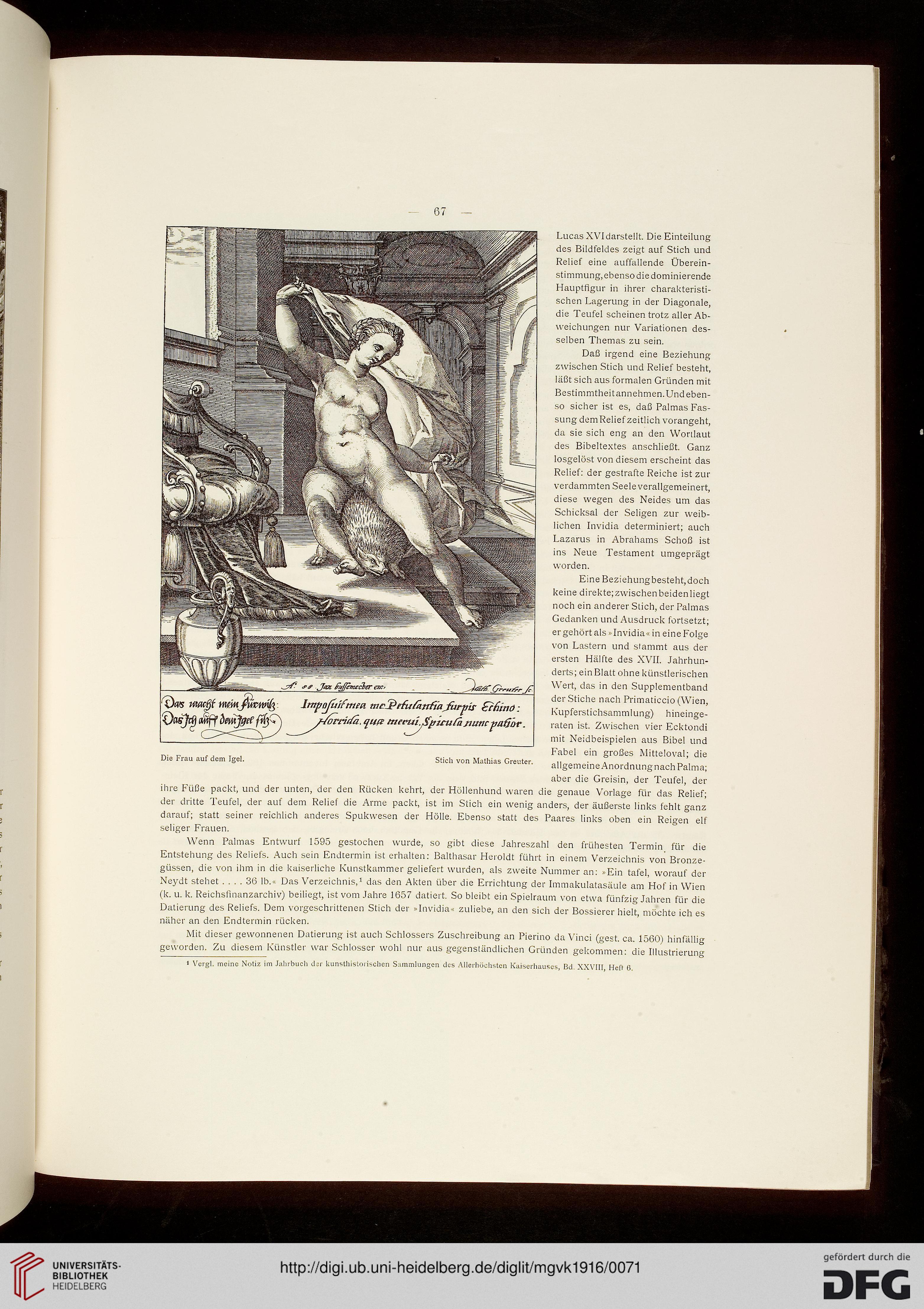67
Lucas XVI darstellt. Die Einteilung
des Bildfeldes zeigt auf Stich und
Relief eine auffallende Überein-
stimmung, ebenso die dominierende
Hauptfigur in ihrer charakteristi-
schen Lagerung in der Diagonale,
die Teufel scheinen trotz aller Ab-
weichungen nur Variationen des-
selben Themas zu sein.
Daß irgend eine Beziehung
zwischen Stich und Relief besteht,
läßt sich aus formalen Gründen mit
Bestimmtheit annehmen.Und eben-
so sieber ist es, daß Palmas Fas-
sung dem Relief zeitlich vorangeht,
da sie sich eng an den Wonlaut
des Bibeltextes anschließt. Ganz
losgelöst von diesem erscheint das
Relief: der gestrafte Reiche ist zur
verdammten Seele verallgemeinert,
diese wegen des Neides um das
Schicksal der Seligen zur weib-
lichen Invidia determiniert; auch
Lazarus in Abrahams Schoß ist
ins Neue Testament umgeprägt
worden.
EineBeziehungbesteht,doch
keine direkte; zwischen beiden liegt
noch ein anderer Stich, der Palmas
Gedanken und Ausdruck fortsetzt;
er gehört als »Invidia« in eine Folge
von Lastern und stammt aus der
ersten Hälfte des XVII. Jahrhun-
derts; ein Blatt ohne künstlerischen
Wert, das in den Supplementband
der Stiche nach Primaticcio(Wien,
Kupfersticbsammlung) hineinge-
raten ist. Zwischen vier Ecktondi
mit Neidbeispielen aus Bibel und
Fabel ein großes Mitteloval; die
allgemeine Anordnung nach Palma;
aber die Greisin, der Teufel, der
ihre Füße packt, und der unten, der den Rücken kehrt, der Höllenhund waren die genaue Vorlage für das Relief;
der dritte Teufel, der auf dem Relief die Arme packt, ist im Stich ein wenig anders, der äußerste links fehlt ganz
darauf; statt seiner reichlich anderes Spukwesen der Hölle. Ebenso statt des Paares links oben ein Reigen elf
seliger Frauen.
Wenn Palmas Entwurf 1595 gestochen wurde, so gibt diese Jahreszahl den frühesten Termini für die
Entstehung des Reliefs. Auch sein Endtermin ist erhalten: Balthasar Heroldt führt in einem Verzeichnis von Bronze-
güssen, die von ihm in die kaiserliche Kunstkammer geliefert wurden, als zweite Nummer an: »Ein tafel, worauf der
Neydt stehet .... 36 Ib.« Das Verzeichnis,1 das den Akten über die Errichtung der Immakulatasäule am Hof in Wien
(k. u. k. Reichsfinanzarchiv) beiliegt, ist vom Jahre 1657 datiert. So bleibt ein Spielraum von etwa fünfzig Jahren für die
Datierung des Reliefs. Dem vorgeschrittenen Stich der »Invidia« zuliebe, an den sich der Bossierer hielt, möchte ich es
näher an den Endtermin rücken.
Mit dieser gewonnenen Datierung ist auch Schlossers Zuschreibung an Pierino da Vinci (gest. ca. 1560) hinfällig
geworden. Zu diesem Künstler war Schlosser wohl nur aus gegenständlichen Gründen gekommen: die Illustrierung
i Vergl. meine Notiz im Jahrbuch der Ifunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Bd. XXVIII, Heft 0.
es Jtat fußcmecherexc>
-_ _^jsa?-^.-.
Ittwo/uifmea mdprfu/äirfiajarpis £c6inc);
/ortidä, qute titeruißpuiifii nuncpafibr:
Die Frau auf dem Igel.
Stich von Mathias Greuter.
Lucas XVI darstellt. Die Einteilung
des Bildfeldes zeigt auf Stich und
Relief eine auffallende Überein-
stimmung, ebenso die dominierende
Hauptfigur in ihrer charakteristi-
schen Lagerung in der Diagonale,
die Teufel scheinen trotz aller Ab-
weichungen nur Variationen des-
selben Themas zu sein.
Daß irgend eine Beziehung
zwischen Stich und Relief besteht,
läßt sich aus formalen Gründen mit
Bestimmtheit annehmen.Und eben-
so sieber ist es, daß Palmas Fas-
sung dem Relief zeitlich vorangeht,
da sie sich eng an den Wonlaut
des Bibeltextes anschließt. Ganz
losgelöst von diesem erscheint das
Relief: der gestrafte Reiche ist zur
verdammten Seele verallgemeinert,
diese wegen des Neides um das
Schicksal der Seligen zur weib-
lichen Invidia determiniert; auch
Lazarus in Abrahams Schoß ist
ins Neue Testament umgeprägt
worden.
EineBeziehungbesteht,doch
keine direkte; zwischen beiden liegt
noch ein anderer Stich, der Palmas
Gedanken und Ausdruck fortsetzt;
er gehört als »Invidia« in eine Folge
von Lastern und stammt aus der
ersten Hälfte des XVII. Jahrhun-
derts; ein Blatt ohne künstlerischen
Wert, das in den Supplementband
der Stiche nach Primaticcio(Wien,
Kupfersticbsammlung) hineinge-
raten ist. Zwischen vier Ecktondi
mit Neidbeispielen aus Bibel und
Fabel ein großes Mitteloval; die
allgemeine Anordnung nach Palma;
aber die Greisin, der Teufel, der
ihre Füße packt, und der unten, der den Rücken kehrt, der Höllenhund waren die genaue Vorlage für das Relief;
der dritte Teufel, der auf dem Relief die Arme packt, ist im Stich ein wenig anders, der äußerste links fehlt ganz
darauf; statt seiner reichlich anderes Spukwesen der Hölle. Ebenso statt des Paares links oben ein Reigen elf
seliger Frauen.
Wenn Palmas Entwurf 1595 gestochen wurde, so gibt diese Jahreszahl den frühesten Termini für die
Entstehung des Reliefs. Auch sein Endtermin ist erhalten: Balthasar Heroldt führt in einem Verzeichnis von Bronze-
güssen, die von ihm in die kaiserliche Kunstkammer geliefert wurden, als zweite Nummer an: »Ein tafel, worauf der
Neydt stehet .... 36 Ib.« Das Verzeichnis,1 das den Akten über die Errichtung der Immakulatasäule am Hof in Wien
(k. u. k. Reichsfinanzarchiv) beiliegt, ist vom Jahre 1657 datiert. So bleibt ein Spielraum von etwa fünfzig Jahren für die
Datierung des Reliefs. Dem vorgeschrittenen Stich der »Invidia« zuliebe, an den sich der Bossierer hielt, möchte ich es
näher an den Endtermin rücken.
Mit dieser gewonnenen Datierung ist auch Schlossers Zuschreibung an Pierino da Vinci (gest. ca. 1560) hinfällig
geworden. Zu diesem Künstler war Schlosser wohl nur aus gegenständlichen Gründen gekommen: die Illustrierung
i Vergl. meine Notiz im Jahrbuch der Ifunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Bd. XXVIII, Heft 0.
es Jtat fußcmecherexc>
-_ _^jsa?-^.-.
Ittwo/uifmea mdprfu/äirfiajarpis £c6inc);
/ortidä, qute titeruißpuiifii nuncpafibr:
Die Frau auf dem Igel.
Stich von Mathias Greuter.