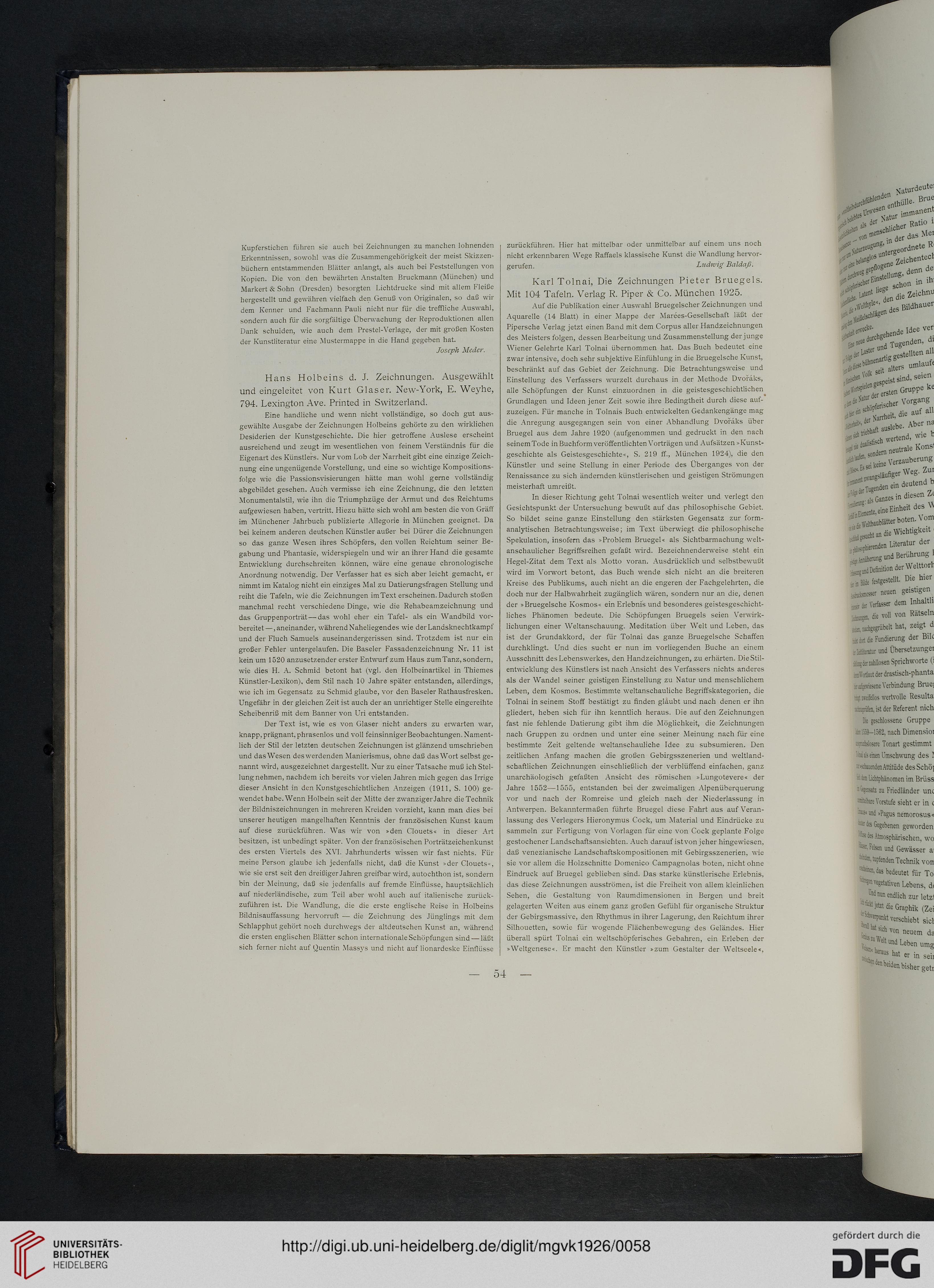Kupferstichen führen sie auch bei Zeichnungen zu manchen lohnenden
Erkenntnissen, sowohl was die Zusammengehörigkeit der meist Skizzen-
büchern entstammenden Blätter anlangt, als auch bei Feststellungen von
Kopien. Die von den bewährten Anstalten Bruckmann (München) und
Markert & Sohn (Dresden) besorgten Lichtdrucke sind mit allem Fleiße
hergestellt und gewähren vielfach den Genuß von Originalen, so daß wil-
dem Kenner und Fachmann Pauli nicht nur für die treffliche Auswahl,
sondern auch für die sorgfältige Überwachung der Reproduktionen allen
Dank schulden, wie auch dem Prestel-Verlage, der mit großen Kosten
der Kunstliteratur eine .Mustermappe in die Hand gegeben hat
Joseph Meder.
Hans Holbeins d. J. Zeichnungen. Ausgewählt
und eingeleitet von Kurt Glaser. New-York, E. Weyhe,
794. Lexington Ave. Printed in Switzerland.
Eine handliche und wenn nicht vollständige, so doch gut aus-
gewählte Ausgabe der Zeichnungen Holbeins gehörte zu den wirklichen
Desiderien der Kunstgeschichte. Die hier getroffene Auslese erscheint
ausreichend und zeugt im wesentlichen von feinem Verständnis für die
Eigenart des Künstlers. Nur vom Lob der Narrheit gibt eine einzige Zeich-
nung eine ungenügende Vorstellung, und eine so wichtige Kompositions-
folge wie die Passionsvisierungen hätte man wohl gerne vollständig
abgebildet gesehen. Auch vermisse ich eine Zeichnung, die den letzten
Monumentalstil, wie ihn die Triumphzüge der Armut und des Reichtums
aufgewiesen haben, vertritt. Hiezu hätte sich wohl am besten die von Gräff
im Münchencr Jahrbuch publizierte Allegorie in München geeignet. Da
bei keinem anderen deutschen Künstler außer bei Dürer die Zeichnungen
so das ganze Wesen ihres Schöpfers, den vollen Reichtum seiner Be-
gabung und Phantasie, widerspiegeln und wir an ihrer Hand die gesamte
Entwicklung durchschreiten können, wäre eine genaue chronologische
Anordnung notwendig. Der Verfasser hat es sich aber leicht gemacht, er
nimmt im Katalog nicht ein einziges Mal zu Datierungsfragen Stellung und
reiht die Tafeln, wie die Zeichnungen imText erscheinen. Dadurch stoßen
manchmal recht verschiedene Dinge, wie die Rehabeamzeichnung und
das Gruppenporträt—das wrohl eher ein Tafel- als ein Wandbild vor-
bereitet—, aneinander, während Naheliegendes wie der Landsknechtkampl"
und der Fluch Samuels auseinandergerissen sind. Trotzdem ist nur ein
großer Fehler untergelaufen. Die Baseler Fassadenzeichnung Nr. 11 ist
kein um 1520 anzusetzender erster Entwurf zum Haus zumTanz, sondern,
wie dies H. A. Schmid betont hat (vgl. den Holbeinartikcl in Thiemes
Künstler-Lexikon), dem Stil nach 10 Jahre später entstanden, allerdings,
wie ich im Gegensatz zu Schmid glaube, vor den Baseler Rathausfresken.
Ungefähr in der gleichen Zeit ist auch der an unrichtiger Stelle eingereihte
Scheibenriß mit dem Banner von Uri entstanden.
Der Text ist, wie es von Glaser nicht anders zu erwarten war,
knapp, prägnant, phrasenlos und voll feinsinniger Beobachtungen. Nament-
lich der Stil der letzten deutschen Zeichnungen ist glänzend umschrieben
und das Wesen des werdenden Manierismus, ohne daß das Wort selbst ge-
nannt wird, ausgezeichnet dargestellt. Nur zu einer Tatsache muß ich Stel-
lung nehmen, nachdem ich bereits vor vielen Jahren mich gegen das Irrige
dieser Ansicht in den Kunstgeschichtlichen Anzeigen (1911, S. 100) ge-
wendet habe.Wenn Holbein seit der Mitte der zwanziger Jahre die Technik
der Bildniszeichnungen in mehreren Kreiden vorzieht, kann man dies bei
unserer heutigen mangelhaften Kenntnis der französischen Kunst kaum
auf diese zurückführen. Was wir von »den Clouets« in dieser Art
besitzen, ist unbedingt später. Von der französischen Porträtzeichenkunst
des ersten Viertels des XVI. Jahrhunderts wissen wir fast nichts. Für
meine Person glaube ich jedenfalls nicht, daß die Kunst »der Clouets*,
wie sie erst seit den dreißiger Jahren greifbar wird, autochthon ist, sondern
bin der Meinung, daß sie jedenfalls auf fremde Einflüsse, hauptsächlich
auf niederländische, zum Teil aber wohl auch auf italienische zurück-
zuführen ist. Die Wandlung, die die erste englische Reise in Holbeins
Bildnisauffassimg hervorruft — die Zeichnung des Jünglings mit dem
Schlapphut gehört noch durchwegs der altdeutschen Kunst an, während
die ersten englischen Blätter schon internationale Schöpfungen sind —läßt
sich ferner nicht auf Quentin Massys und nicht auf lionardeske Einflüsse
zurückführen. Hier hat mittelbar oder unmittelbar auf einem uns noch
nicht erkennbaren Wege Raffaels klassische Kunst die Wandlung hervor-
gerufen. Ludwig Baldaß.
Karl Tolnai, Die Zeichnungen Pieter Bruegels.
Mit 104 Tafeln. Verlag R. Piper & Co. München 1925.
Auf die Publikation einer Auswahl Bruegelscher Zeichnungen und
Aquarelle (14 Blatt) in einer Mappe der Marees-Gesellschaft läßt der
Pipersche Verlag jetzt einen Band mit dem Corpus aller Handzeichnungen
des Meisters folgen, dessen Bearbeitung und Zusammenstellung der junge
Wiener Gelehrte Karl Tolnai übernommen hat. Das Buch bedeutet eine
zwar intensive, doch sehr subjektive Einfühlung in die Bruegelsche Kunst,
beschränkt auf das Gebiet der Zeichnung. Die Betrachtungsweise und
Einstellung des Verfassers wurzelt durchaus in der Methode Dvohiks,
alle Schöpfungen der Kunst einzuordnen in die geistesgeschichtlichen
Grundlagen und Ideen jener Zeit sowie ihre Bedingtheit durch diese auf-
zuzeigen. Für manche in Tolnais Buch entwickelten Gedankengänge mag
die Anregung ausgegangen sein von einer Abhandlung Dvoraks über
Bruegel aus dem Jahre 1920 (aufgenommen und gedruckt in den nach
seinemTode in Buchform veröffentlichten Vorträgen und Aufsätzen »Kunst-
geschichte als Geistesgeschichte<, S. 219 ff.. München 1924), die den
Künstler und seine Stellung in einer Periode des Überganges von der
Renaissance zu sich ändernden künstlerischen und geistigen Strömungen
meisterhaft umreißt.
In dieser Richtung geht Tolnai wesentlich weiter und verlegt den
Gesichtspunkt der Untersuchung bewußt auf das philosophische Gebiet.
So bildet seine ganze Einstellung den stärksten Gegensatz zur form-
analytischen Betrachtungsweise; im Text überwiegt die philosophische
Spekulation, insofern das "Problem Bruegel« als Sichtbarmachung welt-
anschaulicher Begriffsreihen gefaßt wird. Bezeichnenderweise steht ein
Hegel-Zitat dem Text als Motto voran. Ausdrücklich und selbstbewußt
wird im Vorwort betont, das Buch wende sich nicht an die breiteren
Kreise des Publikums, auch nicht an die engeren der Fachgelehrten, die
doch nur der Halbwahrheit zugänglich wären, sondern nur an die, denen
der »Bruegelsche Kosmos« ein Erlebnis und besonderes geistesgeschicht-
liches Phänomen bedeute. Die Schöpfungen Bruegels seien Verwirk-
lichungen einer Weltanschauung. Meditation über Welt und Leben, das
ist der Grundakkord, der für Tolnai das ganze Bruegelsche Schaffen
durchklingt. Und dies sucht er nun im vorliegenden Buche an einem
Ausschnitt des Lebenswerkes, den Handzeichnungen, zu erhärten. Die Stil-
entwicklung des Künstlers ist nach Ansicht des Verfassers nichts anderes
als der Wandel seiner geistigen Einstellung zu Natur und menschlichem
Leben, dem Kosmos. Bestimmte weltanschauliche Begriffskategorien, die
Tolnai in seinem Stoff bestätigt zu finden glaubt und nach denen er ihn
gliedert, heben sich für ihn kenntlich heraus. Die auf den Zeichnungen
fast nie fehlende Datierung gibt ihm die Möglichkeit, die Zeichnungen
nach Gruppen zu ordnen und unter eine seiner Meinung nach für eine
bestimmte Zeit geltende weltanschauliche Idee zu subsumieren. Den
zeitlichen Anfang machen die großen Gebirgsszenerien und weltland-
schaftlichen Zeichnungen einschließlich der verblüffend einfachen, ganz
unarchäologisch gefaßten Ansicht des römischen »Lungotevere« der
Jahre 1552—1555, entstanden bei der zweimaligen Alpenüberquerung
vor und nach der Romreise und gleich nach der Niederlassung in
Antwerpen. Bekanntermaßen führte Bruegel diese Fahrt aus auf Veran-
lassung des Verlegers Hieronymus Cock, um Material und Eindrücke zu
sammeln zur Fertigung von Vorlagen für eine von Cock geplante Folge
gestochener Landschaftsansichten. Auch darauf ist von jeher hingewiesen,
daß venezianische Landschaftskompositionen mit Gebirgsszenerien, wie
sie vor allem die Holzschnitte Domenico Campagnolas boten, nicht ohne
Eindruck auf Bruegel geblieben sind. Das starke künstlerische Erlebnis,
das diese Zeichnungen ausströmen, ist die Freiheit von allem kleinlichen
Sehen, die Gestaltung von Raumdimensionen in Bergen und breit
gelagerten Weiten aus einem ganz großen Gefühl für organische Struktur
der Gebirgsmassive, den Rhythmus in ihrer Lagerung, den Reichtum ihrer
Silhouetten, sowie für wogende Flächenbewegung des Geländes. Hier
überall spürt Tolnai ein weltschöpferisches Gebahren, ein Erleben der
»Weltgenese«. Er macht den Künstler »zum Gestalter der Weltseele«,
Erkenntnissen, sowohl was die Zusammengehörigkeit der meist Skizzen-
büchern entstammenden Blätter anlangt, als auch bei Feststellungen von
Kopien. Die von den bewährten Anstalten Bruckmann (München) und
Markert & Sohn (Dresden) besorgten Lichtdrucke sind mit allem Fleiße
hergestellt und gewähren vielfach den Genuß von Originalen, so daß wil-
dem Kenner und Fachmann Pauli nicht nur für die treffliche Auswahl,
sondern auch für die sorgfältige Überwachung der Reproduktionen allen
Dank schulden, wie auch dem Prestel-Verlage, der mit großen Kosten
der Kunstliteratur eine .Mustermappe in die Hand gegeben hat
Joseph Meder.
Hans Holbeins d. J. Zeichnungen. Ausgewählt
und eingeleitet von Kurt Glaser. New-York, E. Weyhe,
794. Lexington Ave. Printed in Switzerland.
Eine handliche und wenn nicht vollständige, so doch gut aus-
gewählte Ausgabe der Zeichnungen Holbeins gehörte zu den wirklichen
Desiderien der Kunstgeschichte. Die hier getroffene Auslese erscheint
ausreichend und zeugt im wesentlichen von feinem Verständnis für die
Eigenart des Künstlers. Nur vom Lob der Narrheit gibt eine einzige Zeich-
nung eine ungenügende Vorstellung, und eine so wichtige Kompositions-
folge wie die Passionsvisierungen hätte man wohl gerne vollständig
abgebildet gesehen. Auch vermisse ich eine Zeichnung, die den letzten
Monumentalstil, wie ihn die Triumphzüge der Armut und des Reichtums
aufgewiesen haben, vertritt. Hiezu hätte sich wohl am besten die von Gräff
im Münchencr Jahrbuch publizierte Allegorie in München geeignet. Da
bei keinem anderen deutschen Künstler außer bei Dürer die Zeichnungen
so das ganze Wesen ihres Schöpfers, den vollen Reichtum seiner Be-
gabung und Phantasie, widerspiegeln und wir an ihrer Hand die gesamte
Entwicklung durchschreiten können, wäre eine genaue chronologische
Anordnung notwendig. Der Verfasser hat es sich aber leicht gemacht, er
nimmt im Katalog nicht ein einziges Mal zu Datierungsfragen Stellung und
reiht die Tafeln, wie die Zeichnungen imText erscheinen. Dadurch stoßen
manchmal recht verschiedene Dinge, wie die Rehabeamzeichnung und
das Gruppenporträt—das wrohl eher ein Tafel- als ein Wandbild vor-
bereitet—, aneinander, während Naheliegendes wie der Landsknechtkampl"
und der Fluch Samuels auseinandergerissen sind. Trotzdem ist nur ein
großer Fehler untergelaufen. Die Baseler Fassadenzeichnung Nr. 11 ist
kein um 1520 anzusetzender erster Entwurf zum Haus zumTanz, sondern,
wie dies H. A. Schmid betont hat (vgl. den Holbeinartikcl in Thiemes
Künstler-Lexikon), dem Stil nach 10 Jahre später entstanden, allerdings,
wie ich im Gegensatz zu Schmid glaube, vor den Baseler Rathausfresken.
Ungefähr in der gleichen Zeit ist auch der an unrichtiger Stelle eingereihte
Scheibenriß mit dem Banner von Uri entstanden.
Der Text ist, wie es von Glaser nicht anders zu erwarten war,
knapp, prägnant, phrasenlos und voll feinsinniger Beobachtungen. Nament-
lich der Stil der letzten deutschen Zeichnungen ist glänzend umschrieben
und das Wesen des werdenden Manierismus, ohne daß das Wort selbst ge-
nannt wird, ausgezeichnet dargestellt. Nur zu einer Tatsache muß ich Stel-
lung nehmen, nachdem ich bereits vor vielen Jahren mich gegen das Irrige
dieser Ansicht in den Kunstgeschichtlichen Anzeigen (1911, S. 100) ge-
wendet habe.Wenn Holbein seit der Mitte der zwanziger Jahre die Technik
der Bildniszeichnungen in mehreren Kreiden vorzieht, kann man dies bei
unserer heutigen mangelhaften Kenntnis der französischen Kunst kaum
auf diese zurückführen. Was wir von »den Clouets« in dieser Art
besitzen, ist unbedingt später. Von der französischen Porträtzeichenkunst
des ersten Viertels des XVI. Jahrhunderts wissen wir fast nichts. Für
meine Person glaube ich jedenfalls nicht, daß die Kunst »der Clouets*,
wie sie erst seit den dreißiger Jahren greifbar wird, autochthon ist, sondern
bin der Meinung, daß sie jedenfalls auf fremde Einflüsse, hauptsächlich
auf niederländische, zum Teil aber wohl auch auf italienische zurück-
zuführen ist. Die Wandlung, die die erste englische Reise in Holbeins
Bildnisauffassimg hervorruft — die Zeichnung des Jünglings mit dem
Schlapphut gehört noch durchwegs der altdeutschen Kunst an, während
die ersten englischen Blätter schon internationale Schöpfungen sind —läßt
sich ferner nicht auf Quentin Massys und nicht auf lionardeske Einflüsse
zurückführen. Hier hat mittelbar oder unmittelbar auf einem uns noch
nicht erkennbaren Wege Raffaels klassische Kunst die Wandlung hervor-
gerufen. Ludwig Baldaß.
Karl Tolnai, Die Zeichnungen Pieter Bruegels.
Mit 104 Tafeln. Verlag R. Piper & Co. München 1925.
Auf die Publikation einer Auswahl Bruegelscher Zeichnungen und
Aquarelle (14 Blatt) in einer Mappe der Marees-Gesellschaft läßt der
Pipersche Verlag jetzt einen Band mit dem Corpus aller Handzeichnungen
des Meisters folgen, dessen Bearbeitung und Zusammenstellung der junge
Wiener Gelehrte Karl Tolnai übernommen hat. Das Buch bedeutet eine
zwar intensive, doch sehr subjektive Einfühlung in die Bruegelsche Kunst,
beschränkt auf das Gebiet der Zeichnung. Die Betrachtungsweise und
Einstellung des Verfassers wurzelt durchaus in der Methode Dvohiks,
alle Schöpfungen der Kunst einzuordnen in die geistesgeschichtlichen
Grundlagen und Ideen jener Zeit sowie ihre Bedingtheit durch diese auf-
zuzeigen. Für manche in Tolnais Buch entwickelten Gedankengänge mag
die Anregung ausgegangen sein von einer Abhandlung Dvoraks über
Bruegel aus dem Jahre 1920 (aufgenommen und gedruckt in den nach
seinemTode in Buchform veröffentlichten Vorträgen und Aufsätzen »Kunst-
geschichte als Geistesgeschichte<, S. 219 ff.. München 1924), die den
Künstler und seine Stellung in einer Periode des Überganges von der
Renaissance zu sich ändernden künstlerischen und geistigen Strömungen
meisterhaft umreißt.
In dieser Richtung geht Tolnai wesentlich weiter und verlegt den
Gesichtspunkt der Untersuchung bewußt auf das philosophische Gebiet.
So bildet seine ganze Einstellung den stärksten Gegensatz zur form-
analytischen Betrachtungsweise; im Text überwiegt die philosophische
Spekulation, insofern das "Problem Bruegel« als Sichtbarmachung welt-
anschaulicher Begriffsreihen gefaßt wird. Bezeichnenderweise steht ein
Hegel-Zitat dem Text als Motto voran. Ausdrücklich und selbstbewußt
wird im Vorwort betont, das Buch wende sich nicht an die breiteren
Kreise des Publikums, auch nicht an die engeren der Fachgelehrten, die
doch nur der Halbwahrheit zugänglich wären, sondern nur an die, denen
der »Bruegelsche Kosmos« ein Erlebnis und besonderes geistesgeschicht-
liches Phänomen bedeute. Die Schöpfungen Bruegels seien Verwirk-
lichungen einer Weltanschauung. Meditation über Welt und Leben, das
ist der Grundakkord, der für Tolnai das ganze Bruegelsche Schaffen
durchklingt. Und dies sucht er nun im vorliegenden Buche an einem
Ausschnitt des Lebenswerkes, den Handzeichnungen, zu erhärten. Die Stil-
entwicklung des Künstlers ist nach Ansicht des Verfassers nichts anderes
als der Wandel seiner geistigen Einstellung zu Natur und menschlichem
Leben, dem Kosmos. Bestimmte weltanschauliche Begriffskategorien, die
Tolnai in seinem Stoff bestätigt zu finden glaubt und nach denen er ihn
gliedert, heben sich für ihn kenntlich heraus. Die auf den Zeichnungen
fast nie fehlende Datierung gibt ihm die Möglichkeit, die Zeichnungen
nach Gruppen zu ordnen und unter eine seiner Meinung nach für eine
bestimmte Zeit geltende weltanschauliche Idee zu subsumieren. Den
zeitlichen Anfang machen die großen Gebirgsszenerien und weltland-
schaftlichen Zeichnungen einschließlich der verblüffend einfachen, ganz
unarchäologisch gefaßten Ansicht des römischen »Lungotevere« der
Jahre 1552—1555, entstanden bei der zweimaligen Alpenüberquerung
vor und nach der Romreise und gleich nach der Niederlassung in
Antwerpen. Bekanntermaßen führte Bruegel diese Fahrt aus auf Veran-
lassung des Verlegers Hieronymus Cock, um Material und Eindrücke zu
sammeln zur Fertigung von Vorlagen für eine von Cock geplante Folge
gestochener Landschaftsansichten. Auch darauf ist von jeher hingewiesen,
daß venezianische Landschaftskompositionen mit Gebirgsszenerien, wie
sie vor allem die Holzschnitte Domenico Campagnolas boten, nicht ohne
Eindruck auf Bruegel geblieben sind. Das starke künstlerische Erlebnis,
das diese Zeichnungen ausströmen, ist die Freiheit von allem kleinlichen
Sehen, die Gestaltung von Raumdimensionen in Bergen und breit
gelagerten Weiten aus einem ganz großen Gefühl für organische Struktur
der Gebirgsmassive, den Rhythmus in ihrer Lagerung, den Reichtum ihrer
Silhouetten, sowie für wogende Flächenbewegung des Geländes. Hier
überall spürt Tolnai ein weltschöpferisches Gebahren, ein Erleben der
»Weltgenese«. Er macht den Künstler »zum Gestalter der Weltseele«,