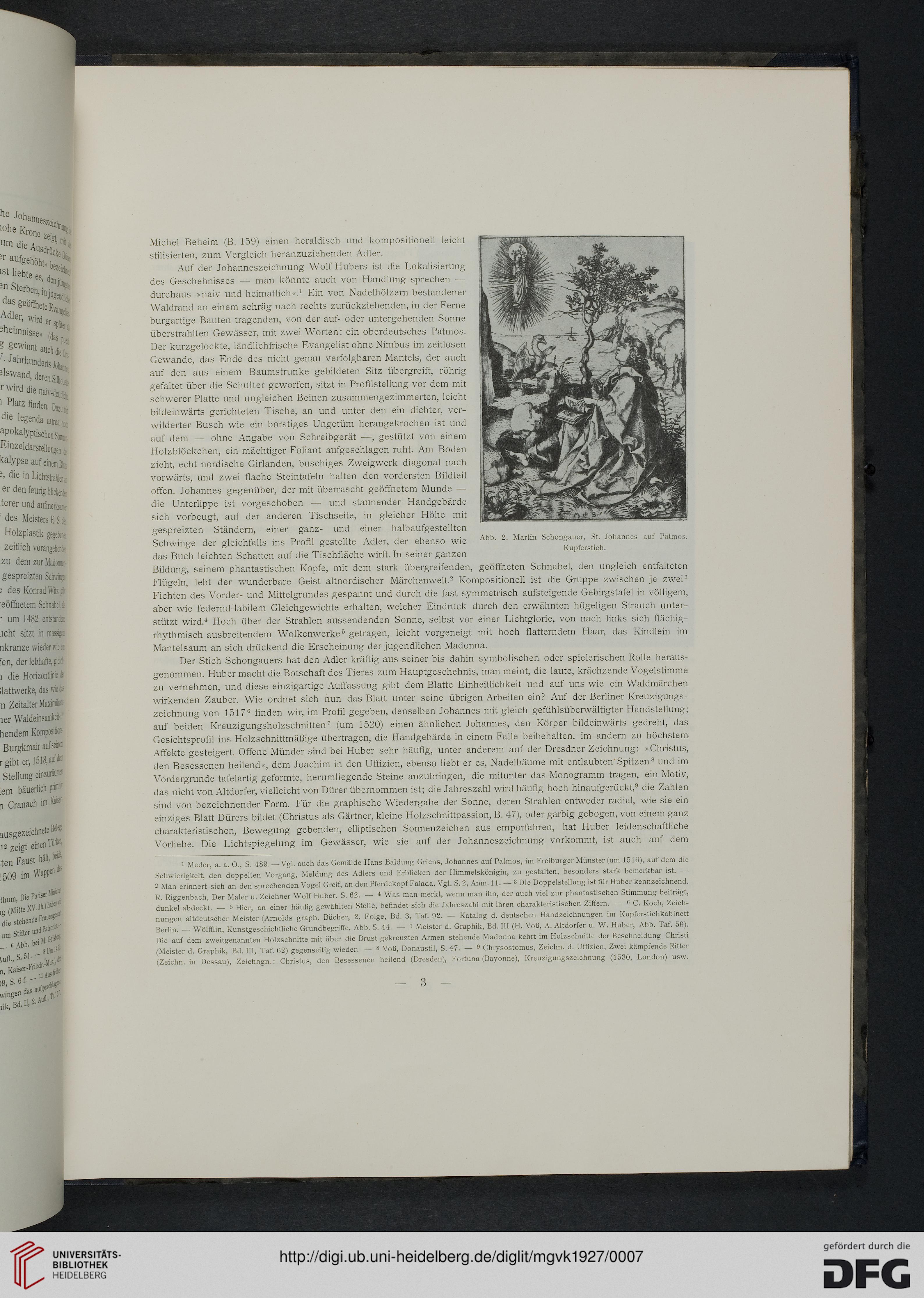Johan
he
10he^„e2,
;raufgehöh,,b D<
'st liebte es Z**
=n Sterbe n J***
Udi geöffnete
Adle^v,rde
-Luisse. fAj ^
w,rd die naiv-dec-;
,Platz «"den. Daa:
d'e legenda aurea,
apokalyptischen &c,
Emzeldarstellnngenj
xalypse auf einem
;» die in Lichtstrafe:
er den
terer und aufmerke
des Heisters Eit
Holzplastik gegefc-
zeitlich vorangttai
zu dem zur Madomr
gespreizten Sdmp
: des Konrad Wz:
;eöffnetem Schnabel _
- um 1482 entstaafc
jcht sitzt in masap
nkranze wieder Kita
ren, der lebhafte, gl;::
1 die Horizonfc i"
llattwerke, das wie*
n Zeitalter Maxi»--
ler Waldeinsamkei:'
hendem Komposita
BurgkmairaufiM«
rgibt er, I5l8,aufda:
Stellung einzuräunff
lern bäuerlich po*
t, Cranach im Öf
ausgezeichnete
12 zeigt einen
ten Faust hält,
■ 509 im Wappe"^
,g (Milte XV. lW<**
,9,s'6 Lr.*^
«-ingen das au« -
iik, Bd-
.Michel Beheim (B. 159) einen heraldisch und kompositionell leicht
stilisierten, zum Vergleich heranzuziehenden Adler.
Auf der Johanneszeichnung Wolf Hubers ist die Lokalisierung
des Geschehnisses — man könnte auch von Handlung sprechen —
durchaus »naiv und heimatlich«.1 Ein von Nadelhölzern bestandener
Waldrand an einem schräg nach rechts zurückziehenden, in der Ferne
burgartige Bauten tragenden, von der auf- oder untergehenden Sonne
überstrahlten Gewässer, mit zwei Worten: ein oberdeutsches Patmos.
Der kurzgelockte, ländlichfrische Evangelist ohne Nimbus im zeitlosen
Gewände, das Ende des nicht genau verfolgbaren Mantels, der auch
auf den aus einem Baumstrunke gebildeten Sitz übergreift, röhrig
gefaltet über die Schulter geworfen, sitzt in Profilstellung vor dem mit
schwerer Platte und ungleichen Beinen zusammengezimmerten, leicht
bildeinwärts gerichteten Tische, an und unter den ein dichter, ver-
wilderter Busch wie ein borstiges Ungetüm herangekrochen ist und
auf dem — ohne Angabe von Schreibgerät —, gestützt von einem
Holzblöckchen, ein mächtiger Foliant aufgeschlagen ruht. Am Boden
zieht, echt nordische Girlanden, buschiges Zweigwerk diagonal nach
vorwärts, und zwei flache Steintafeln halten den vordersten Bildteil
offen. Johannes gegenüber, der mit überrascht geöffnetem Munde —
die Unterlippe ist vorgeschoben — und staunender Handgebärde
sich vorbeugt, auf der anderen Tischseite, in gleicher Höhe mit
gespreizten Ständern, einer ganz- und einer halbaufgestellten
Schwinge der gleichfalls ins Profil gestellte Adler, der ebenso wie
das Buch leichten Schatten auf die Tischfläche wirft. In seiner ganzen
Bildung, seinem phantastischen Kopfe, mit dem stark übergreifenden, geöffneten Schnabel, den ungleich entfalteten
Flügeln, lebt der wunderbare Geist altnordischer Märchenwelt.'2 Kompositionell ist die Gruppe zwischen je zwei3
Fichten des Vorder- und Mittelgrundes gespannt und durch die fast symmetrisch aufsteigende Gebirgstafel in völligem,
aber wie federnd-labilem Gleichgewichte erhalten, welcher Eindruck durch den erwähnten hügeligen Strauch unter-
stützt wird.* Hoch über der Strahlen aussendenden Sonne, selbst vor einer Lichtglorie, von nach links sich flächig-
rhythmisch ausbreitendem Wolkenwerke5 getragen, leicht vorgeneigt mit hoch flatterndem Haar, das Kindlein im
Mantelsaum an sich drückend die Erscheinung der jugendlichen Madonna.
Der Stich Schongauers hat den Adler kräftig aus seiner bis dahin symbolischen oder spielerischen Rolle heraus-
genommen. Huber macht die Botschaft des Tieres zum Hauptgeschehnis, man meint, die laute, krächzende Vogelstimme
zu vernehmen, und diese einzigartige Auffassung gibt dem Blatte Einheitlichkeit und auf uns wie ein Waldmärchen
wirkenden Zauber. Wie ordnet sich nun das Blatt unter seine übrigen Arbeiten ein? Auf der Berliner Kreuzigungs-
zeichnung von 15176 finden wir, im Profil gegeben, denselben Johannes mit gleich gefühlsüberwältigter Handstellung;
auf beiden Kreuzigungsholzschnitten' (um 1520) einen ähnlichen Johannes, den Körper bildeinwärts gedreht, das
Gesichtsprofil ins Holzschnittmäßige übertragen, die Handgebärde in einem Falle beibehalten, im andern zu höchstem
Affekte gesteigert. Offene Münder sind bei Huber sehr häufig, unter anderem auf der Dresdner Zeichnung: »Christus,
den Besessenen heilend«, dem Joachim in den Uffizien, ebenso liebt er es, Nadelbäume mit entlaubten'Spitzen3 und im
Vordergrunde tafelartig geformte, herumliegende Steine anzubringen, die mitunter das Monogramm tragen, ein Motiv,
das nicht von Altdorfer, vielleicht von Dürer übernommen ist; die Jahreszahl wird häufig hoch hinaufgerückt,9 die Zahlen
sind von bezeichnender Form. Für die graphische Wiedergabe der Sonne, deren Strahlen entweder radial, wie sie ein
einziges Blatt Dürers bildet (Christus als Gärtner, kleine Holzschnittpassion, B. 47), oder garbig gebogen, von einem ganz
charakteristischen, Bewegung gebenden, elliptischen Sonnenzeichen aus emporfahren, hat Huber leidenschaftliche
Vorliebe. Die Lichtspiegelung im Gewässer, wie sie auf der Johanneszeichnung vorkommt, ist auch auf dem
Martin Schongauer, St. Johannes auf Patmos.
Kupferstich.
1 Meder, a. a. O., S. 489. — Vgl. auch das Gemälde Hans Baidung Griens, Johannes auf Patmos, im Freiburger Münster (um 1516), auf dem die
Schwierigkeit, den doppelten Vorgang, Meldung des Adlers und Erblicken der Himmelskönigin, zu gestalten, besonders stark bemerkbar ist. —
2 Man erinnert sich an den sprechenden Vogel Greif, an den Pferdekopf Falada. Vgl. S. 2, Anm. 11. — 3 Die Doppelstellung ist für Huber kennzeichnend.
R. Riggenbach, Der Maler u. Zeichner Wolf Huber. S. 62. — 1 Was man merkt, wenn man ihn, der auch viel zur phantastischen Stimmung beiträgt,
dunkel abdeckt. — Hier, an einer häufig gewählten Stelle, befindet sich die Jahreszahl mit ihren charakteristischen Ziffern. — C. Koch, Zeich-
nungen altdeutscher Meister (Arnolds graph. Bücher, 2. Folge, Bd. 3, Taf. 92. — Katalog d. deutschen Handzeichnungen im Kupferstichkabinett
Berlin. — Wolfllin, KunstgeschichUiche Grundbegriffe. Abb. S. 44. — ' Meister d. Graphik, Bd. III (H. Voß, A. Altdorfer u. W. Huber, Abb. Taf. 59).
Die auf dem zweitgenannten Holzschnitte mit über die Brust gekreuzten Armen stehende Madonna kehrt im Holzschnitte der Beschneidung Christi
(Meister d. Graphik, Bd. III, Taf. 62) gegenseitig wieder. — 8 Voß, Donaustil, S. 47. — 9 Chrysostomus, Zeichn. d. Uffizien, Zwei kämpfende Ritter
(Zeichn. in Dessau), Zeichngn.: Christus, den Besessenen heilend (Dresden), Fortuna (Bayonne), Kreuzigungszeichnung (1530, London) usw.
— 3 —
he
10he^„e2,
;raufgehöh,,b D<
'st liebte es Z**
=n Sterbe n J***
Udi geöffnete
Adle^v,rde
-Luisse. fAj ^
w,rd die naiv-dec-;
,Platz «"den. Daa:
d'e legenda aurea,
apokalyptischen &c,
Emzeldarstellnngenj
xalypse auf einem
;» die in Lichtstrafe:
er den
terer und aufmerke
des Heisters Eit
Holzplastik gegefc-
zeitlich vorangttai
zu dem zur Madomr
gespreizten Sdmp
: des Konrad Wz:
;eöffnetem Schnabel _
- um 1482 entstaafc
jcht sitzt in masap
nkranze wieder Kita
ren, der lebhafte, gl;::
1 die Horizonfc i"
llattwerke, das wie*
n Zeitalter Maxi»--
ler Waldeinsamkei:'
hendem Komposita
BurgkmairaufiM«
rgibt er, I5l8,aufda:
Stellung einzuräunff
lern bäuerlich po*
t, Cranach im Öf
ausgezeichnete
12 zeigt einen
ten Faust hält,
■ 509 im Wappe"^
,g (Milte XV. lW<**
,9,s'6 Lr.*^
«-ingen das au« -
iik, Bd-
.Michel Beheim (B. 159) einen heraldisch und kompositionell leicht
stilisierten, zum Vergleich heranzuziehenden Adler.
Auf der Johanneszeichnung Wolf Hubers ist die Lokalisierung
des Geschehnisses — man könnte auch von Handlung sprechen —
durchaus »naiv und heimatlich«.1 Ein von Nadelhölzern bestandener
Waldrand an einem schräg nach rechts zurückziehenden, in der Ferne
burgartige Bauten tragenden, von der auf- oder untergehenden Sonne
überstrahlten Gewässer, mit zwei Worten: ein oberdeutsches Patmos.
Der kurzgelockte, ländlichfrische Evangelist ohne Nimbus im zeitlosen
Gewände, das Ende des nicht genau verfolgbaren Mantels, der auch
auf den aus einem Baumstrunke gebildeten Sitz übergreift, röhrig
gefaltet über die Schulter geworfen, sitzt in Profilstellung vor dem mit
schwerer Platte und ungleichen Beinen zusammengezimmerten, leicht
bildeinwärts gerichteten Tische, an und unter den ein dichter, ver-
wilderter Busch wie ein borstiges Ungetüm herangekrochen ist und
auf dem — ohne Angabe von Schreibgerät —, gestützt von einem
Holzblöckchen, ein mächtiger Foliant aufgeschlagen ruht. Am Boden
zieht, echt nordische Girlanden, buschiges Zweigwerk diagonal nach
vorwärts, und zwei flache Steintafeln halten den vordersten Bildteil
offen. Johannes gegenüber, der mit überrascht geöffnetem Munde —
die Unterlippe ist vorgeschoben — und staunender Handgebärde
sich vorbeugt, auf der anderen Tischseite, in gleicher Höhe mit
gespreizten Ständern, einer ganz- und einer halbaufgestellten
Schwinge der gleichfalls ins Profil gestellte Adler, der ebenso wie
das Buch leichten Schatten auf die Tischfläche wirft. In seiner ganzen
Bildung, seinem phantastischen Kopfe, mit dem stark übergreifenden, geöffneten Schnabel, den ungleich entfalteten
Flügeln, lebt der wunderbare Geist altnordischer Märchenwelt.'2 Kompositionell ist die Gruppe zwischen je zwei3
Fichten des Vorder- und Mittelgrundes gespannt und durch die fast symmetrisch aufsteigende Gebirgstafel in völligem,
aber wie federnd-labilem Gleichgewichte erhalten, welcher Eindruck durch den erwähnten hügeligen Strauch unter-
stützt wird.* Hoch über der Strahlen aussendenden Sonne, selbst vor einer Lichtglorie, von nach links sich flächig-
rhythmisch ausbreitendem Wolkenwerke5 getragen, leicht vorgeneigt mit hoch flatterndem Haar, das Kindlein im
Mantelsaum an sich drückend die Erscheinung der jugendlichen Madonna.
Der Stich Schongauers hat den Adler kräftig aus seiner bis dahin symbolischen oder spielerischen Rolle heraus-
genommen. Huber macht die Botschaft des Tieres zum Hauptgeschehnis, man meint, die laute, krächzende Vogelstimme
zu vernehmen, und diese einzigartige Auffassung gibt dem Blatte Einheitlichkeit und auf uns wie ein Waldmärchen
wirkenden Zauber. Wie ordnet sich nun das Blatt unter seine übrigen Arbeiten ein? Auf der Berliner Kreuzigungs-
zeichnung von 15176 finden wir, im Profil gegeben, denselben Johannes mit gleich gefühlsüberwältigter Handstellung;
auf beiden Kreuzigungsholzschnitten' (um 1520) einen ähnlichen Johannes, den Körper bildeinwärts gedreht, das
Gesichtsprofil ins Holzschnittmäßige übertragen, die Handgebärde in einem Falle beibehalten, im andern zu höchstem
Affekte gesteigert. Offene Münder sind bei Huber sehr häufig, unter anderem auf der Dresdner Zeichnung: »Christus,
den Besessenen heilend«, dem Joachim in den Uffizien, ebenso liebt er es, Nadelbäume mit entlaubten'Spitzen3 und im
Vordergrunde tafelartig geformte, herumliegende Steine anzubringen, die mitunter das Monogramm tragen, ein Motiv,
das nicht von Altdorfer, vielleicht von Dürer übernommen ist; die Jahreszahl wird häufig hoch hinaufgerückt,9 die Zahlen
sind von bezeichnender Form. Für die graphische Wiedergabe der Sonne, deren Strahlen entweder radial, wie sie ein
einziges Blatt Dürers bildet (Christus als Gärtner, kleine Holzschnittpassion, B. 47), oder garbig gebogen, von einem ganz
charakteristischen, Bewegung gebenden, elliptischen Sonnenzeichen aus emporfahren, hat Huber leidenschaftliche
Vorliebe. Die Lichtspiegelung im Gewässer, wie sie auf der Johanneszeichnung vorkommt, ist auch auf dem
Martin Schongauer, St. Johannes auf Patmos.
Kupferstich.
1 Meder, a. a. O., S. 489. — Vgl. auch das Gemälde Hans Baidung Griens, Johannes auf Patmos, im Freiburger Münster (um 1516), auf dem die
Schwierigkeit, den doppelten Vorgang, Meldung des Adlers und Erblicken der Himmelskönigin, zu gestalten, besonders stark bemerkbar ist. —
2 Man erinnert sich an den sprechenden Vogel Greif, an den Pferdekopf Falada. Vgl. S. 2, Anm. 11. — 3 Die Doppelstellung ist für Huber kennzeichnend.
R. Riggenbach, Der Maler u. Zeichner Wolf Huber. S. 62. — 1 Was man merkt, wenn man ihn, der auch viel zur phantastischen Stimmung beiträgt,
dunkel abdeckt. — Hier, an einer häufig gewählten Stelle, befindet sich die Jahreszahl mit ihren charakteristischen Ziffern. — C. Koch, Zeich-
nungen altdeutscher Meister (Arnolds graph. Bücher, 2. Folge, Bd. 3, Taf. 92. — Katalog d. deutschen Handzeichnungen im Kupferstichkabinett
Berlin. — Wolfllin, KunstgeschichUiche Grundbegriffe. Abb. S. 44. — ' Meister d. Graphik, Bd. III (H. Voß, A. Altdorfer u. W. Huber, Abb. Taf. 59).
Die auf dem zweitgenannten Holzschnitte mit über die Brust gekreuzten Armen stehende Madonna kehrt im Holzschnitte der Beschneidung Christi
(Meister d. Graphik, Bd. III, Taf. 62) gegenseitig wieder. — 8 Voß, Donaustil, S. 47. — 9 Chrysostomus, Zeichn. d. Uffizien, Zwei kämpfende Ritter
(Zeichn. in Dessau), Zeichngn.: Christus, den Besessenen heilend (Dresden), Fortuna (Bayonne), Kreuzigungszeichnung (1530, London) usw.
— 3 —