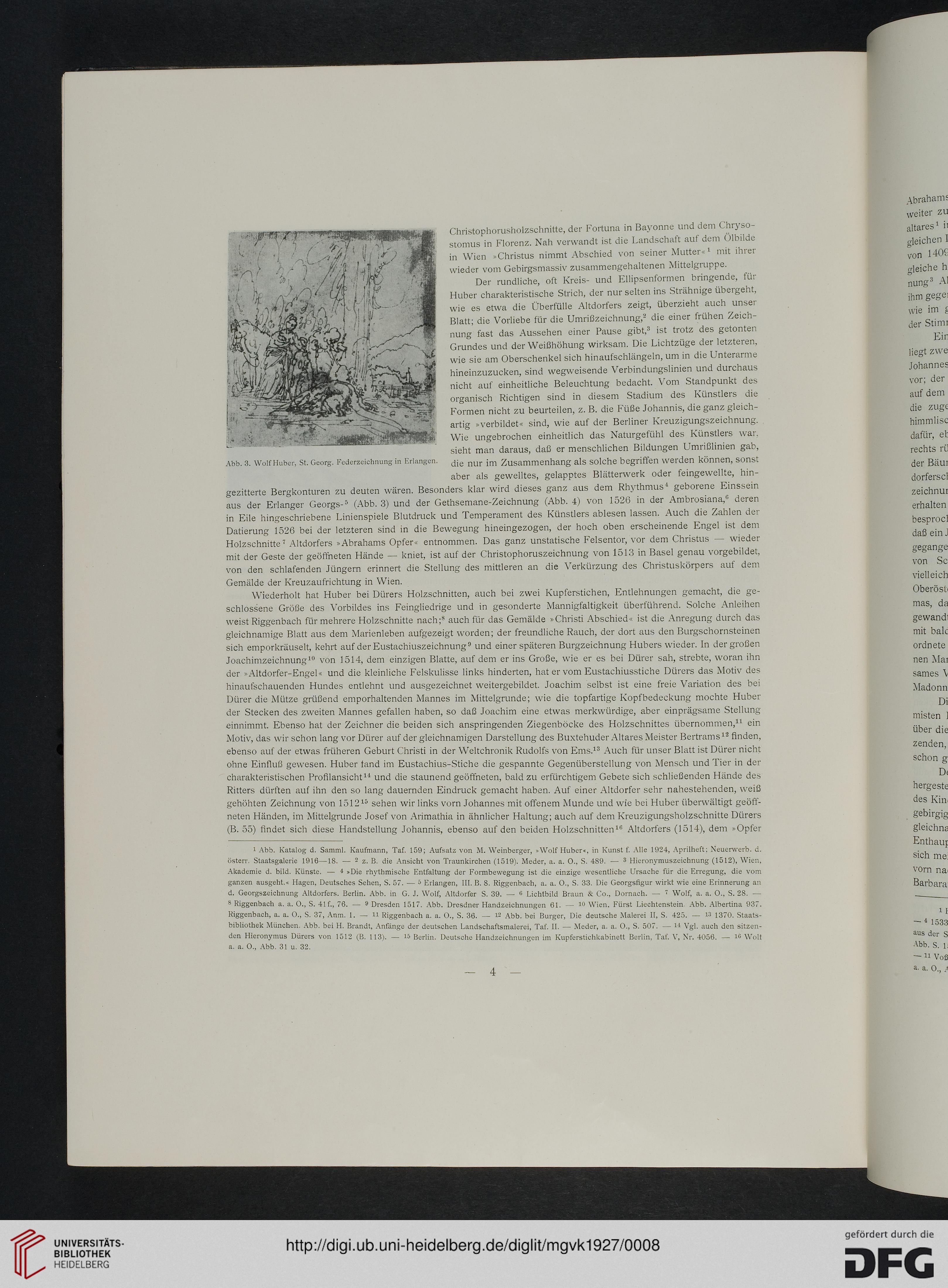Abb. 3. Wolf Huber, St.
Fcdcrzcichn
Christophorusholzschnitte, der Fortuna in Bayonne und dem Chryso-
stomus in Florenz. Nah verwandt ist die Landschaft auf dem ülbilde
in Wien »Christus nimmt Abschied von seiner Mutter«1 mit ihrer
wieder vom Gebirgsmassiv zusammengehaltenen Mittelgruppe.
Der rundliche, oft Kreis- und Ellipsenformen bringende, für
Huber charakteristische Strich, der nur selten ins Strähnige übergeht,
wie es etwa die Überfülle Altdorfers zeigt, überzieht auch unser
Blatt; die Vorliebe für die Umrißzeichnung,2 die einer frühen Zeich-
nung fast das Aussehen einer Pause gibt,3 ist trotz des getonten
Grundes und der Weißhöhung wirksam. Die Lichtzüge der letzteren,
wie sie am Oberschenkel sich hinaufschlängeln, um in die Unterarme
hineinzuzucken, sind wegweisende Verbindungslinien und durchaus
nicht auf einheitliche Beleuchtung bedacht. Vom Standpunkt des
organisch Richtigen sind in diesem Stadium des Künstlers die
Formen nicht zu beurteilen, z. B. die Füße Johannis, die ganz gleich-
artig »verbildet« sind, wie auf der Berliner Kreuzigungszeichnung.
Wie ungebrochen einheitlich das Naturgefühl des Künstlers war.
sieht man daraus, daß er menschlichen Bildungen Umrißlinien gab,
die nur im Zusammenhang als solche begriffen werden können, sonst
aber als gewelltes, gelapptes Blätterwerk oder feingewellte, hin-
gezitterte Bergkonturen zu deuten wären. Besonders klar wird dieses ganz aus dem Rhythmus1 geborene Einssein
aus der Erlanger Georgs-5 (Abb. 3) und der Gethsemane-Zeichnung (Abb. 4) von 1526 in der Ambrosiana,0 deren
in Eile hingeschriebene Linienspiele Blutdruck und Temperament des Künstlers ablesen lassen. Auch die Zahlen der
Datierung 1526 bei der letzteren sind in die Bewegung hineingezogen, der hoch oben erscheinende Engel ist dem
Holzschnitte 7 Altdorfers »Abrahams Opfer« entnommen. Das ganz unstatische Felsentor, vor dem Christus — wieder
mit der Geste der geöffneten Hände — kniet, ist auf der Christophoruszeichnung von 1513 in Basel genau vorgebildet,
von den schlafenden Jüngern erinnert die Stellung des mittleren an die Verkürzung des Christuskörpers auf dem
Gemälde der Kreuzaufrichtung in Wien.
Wiederholt hat Huber bei Dürers Holzschnitten, auch bei zwei Kupferstichen, Entlehnungen gemacht, die ge-
schlossene Größe des Vorbildes ins Feingliedrige und in gesonderte Mannigfaltigkeit überführend. Solche Anleihen
weist Riggenbach für mehrere Holzschnitte nach;8 auch für das Gemälde »Christi Abschied« ist die Anregung durch das
gleichnamige Blatt aus dem Marienleben aufgezeigt worden; der freundliche Rauch, der dort aus den Burgschornsteinen
sich emporkräuselt, kehrt auf der Eustachiuszeichnung9 und einer späteren Burgzeichnung Hubers wieder. In der großen
Joachimzeichnung10 von 1514, dem einzigen Blatte, auf dem er ins Große, wie er es bei Dürer sah, strebte, woran ihn
der »Altdorfer-Engel« und die kleinliche Felskulisse links hinderten, hat er vom Eustachiusstiche Dürers das Motiv des
hinaufschauenden Hundes entlehnt und ausgezeichnet weitergebildet. Joachim selbst ist eine freie Variation des bei
Dürer die Mütze grüßend emporhaltenden Mannes im Mittelgrunde; wie die topfartige Kopfbedeckung mochte Huber
der Stecken des zweiten Mannes gefallen haben, so daß Joachim eine etwas merkwürdige, aber einprägsame Stellung
einnimmt. Ebenso hat der Zeichner die beiden sich anspringenden Ziegenböcke des Holzschnittes übernommen,11 ein
Motiv, das wir schon lang vor Dürer auf der gleichnamigen Darstellung des Buxtehuder Altares Meister Bertrams12 finden,
ebenso auf der etwas früheren Geburt Christi in der Weltchronik Rudolfs von Ems.13 Auch für unser Blatt ist Dürer nicht
ohne Einfluß gewesen. Huber fand im Eustachius-Stiche die gespannte Gegenüberstellung von Mensch und Tier in der
charakteristischen Profilansicht11 und die staunend geöffneten, bald zu erfürchtigem Gebete sich schließenden Hände des
Ritters dürften auf ihn den so lang dauernden Eindruck gemacht haben. Auf einer Altdorfer sehr nahestehenden, weiß
gehöhten Zeichnung von 151215 sehen wir links vorn Johannes mit offenem Munde und wie bei Huber überwältigt geöff-
neten Händen, im Mittelgrunde Josef von Arimathia in ähnlicher Haltung; auch auf dem Kreuzigungsholzschnitte Dürers
(B. 55) findet sich diese Handstellung Johannis, ebenso auf den beiden Holzschnitten16 Altdorfers (1514), dem »Opfer
1 Abb. Katalog d. Samml. Kaufmann, Taf. 159; Aufsatz von M. Weinberger, »Wolf Huber., in Kunst f. Alle 1924, Aprilheft; Neuerwerb, d.
österr. Staatsgalerie 1916—18. — 2 z. B. die Ansicht von Traunkirchen (1519). Meder, a. a. O., S. 489. — 3 Hieronymuszeichnung (1512), Wien,
Akademie d. bild. Künste. — i »Die rhythmische Entfaltung der Formbewegung ist die einzige wesentliche Ursache für die Erregung, die vom
ganzen ausgeht.« Hagen, Deutsches Sehen, S. 57. — 5 Erlangen, III. B. 8. Riggenbach, a. a. O., S. 33. Die Georgsfigur wirkt wie eine Erinnerung an
d. Georgszeichnung Altdorfers. Berlin. Abb. in G. J. Wolf, Altdorfer S. 39. — « Lichtbild Braun & Co., Dornach. — T Wolf, a. a. O., S. 28. —
8 Riggenbach a. a. O., S. 41 f., 76. — 9 Dresden 1517. Abb. Dresdner Handzeichnungen 61. — 10 Wien. Fürst Liechtenstein Abb. Albertina 937.
Riggenbach, a. a. 0., S. 37, Anm. 1. — 11 Riggenbach a. a. 0., S. 36. — 12 Abb. bei Burger, Die deutsche Malerei II, S. 425. — 13 1370. Staats-
bibliothek München. Abb. bei H. Brandt, Anfänge der deutschen Landschaftsmalerei, Taf. II. — Meder, a. a. 0., S. 507. — n Vgl. auch den sitzen-
den Hieronymus Dürers von 1512 (B. 113). - 15 Berlin. Deutsche Handzeichnungen im Kupferstichkabinett Berlin. Taf. V, Nr. 4056 - 1« Wolt
a. a. O., Abb. 31 u. 32.
— 4 —
Fcdcrzcichn
Christophorusholzschnitte, der Fortuna in Bayonne und dem Chryso-
stomus in Florenz. Nah verwandt ist die Landschaft auf dem ülbilde
in Wien »Christus nimmt Abschied von seiner Mutter«1 mit ihrer
wieder vom Gebirgsmassiv zusammengehaltenen Mittelgruppe.
Der rundliche, oft Kreis- und Ellipsenformen bringende, für
Huber charakteristische Strich, der nur selten ins Strähnige übergeht,
wie es etwa die Überfülle Altdorfers zeigt, überzieht auch unser
Blatt; die Vorliebe für die Umrißzeichnung,2 die einer frühen Zeich-
nung fast das Aussehen einer Pause gibt,3 ist trotz des getonten
Grundes und der Weißhöhung wirksam. Die Lichtzüge der letzteren,
wie sie am Oberschenkel sich hinaufschlängeln, um in die Unterarme
hineinzuzucken, sind wegweisende Verbindungslinien und durchaus
nicht auf einheitliche Beleuchtung bedacht. Vom Standpunkt des
organisch Richtigen sind in diesem Stadium des Künstlers die
Formen nicht zu beurteilen, z. B. die Füße Johannis, die ganz gleich-
artig »verbildet« sind, wie auf der Berliner Kreuzigungszeichnung.
Wie ungebrochen einheitlich das Naturgefühl des Künstlers war.
sieht man daraus, daß er menschlichen Bildungen Umrißlinien gab,
die nur im Zusammenhang als solche begriffen werden können, sonst
aber als gewelltes, gelapptes Blätterwerk oder feingewellte, hin-
gezitterte Bergkonturen zu deuten wären. Besonders klar wird dieses ganz aus dem Rhythmus1 geborene Einssein
aus der Erlanger Georgs-5 (Abb. 3) und der Gethsemane-Zeichnung (Abb. 4) von 1526 in der Ambrosiana,0 deren
in Eile hingeschriebene Linienspiele Blutdruck und Temperament des Künstlers ablesen lassen. Auch die Zahlen der
Datierung 1526 bei der letzteren sind in die Bewegung hineingezogen, der hoch oben erscheinende Engel ist dem
Holzschnitte 7 Altdorfers »Abrahams Opfer« entnommen. Das ganz unstatische Felsentor, vor dem Christus — wieder
mit der Geste der geöffneten Hände — kniet, ist auf der Christophoruszeichnung von 1513 in Basel genau vorgebildet,
von den schlafenden Jüngern erinnert die Stellung des mittleren an die Verkürzung des Christuskörpers auf dem
Gemälde der Kreuzaufrichtung in Wien.
Wiederholt hat Huber bei Dürers Holzschnitten, auch bei zwei Kupferstichen, Entlehnungen gemacht, die ge-
schlossene Größe des Vorbildes ins Feingliedrige und in gesonderte Mannigfaltigkeit überführend. Solche Anleihen
weist Riggenbach für mehrere Holzschnitte nach;8 auch für das Gemälde »Christi Abschied« ist die Anregung durch das
gleichnamige Blatt aus dem Marienleben aufgezeigt worden; der freundliche Rauch, der dort aus den Burgschornsteinen
sich emporkräuselt, kehrt auf der Eustachiuszeichnung9 und einer späteren Burgzeichnung Hubers wieder. In der großen
Joachimzeichnung10 von 1514, dem einzigen Blatte, auf dem er ins Große, wie er es bei Dürer sah, strebte, woran ihn
der »Altdorfer-Engel« und die kleinliche Felskulisse links hinderten, hat er vom Eustachiusstiche Dürers das Motiv des
hinaufschauenden Hundes entlehnt und ausgezeichnet weitergebildet. Joachim selbst ist eine freie Variation des bei
Dürer die Mütze grüßend emporhaltenden Mannes im Mittelgrunde; wie die topfartige Kopfbedeckung mochte Huber
der Stecken des zweiten Mannes gefallen haben, so daß Joachim eine etwas merkwürdige, aber einprägsame Stellung
einnimmt. Ebenso hat der Zeichner die beiden sich anspringenden Ziegenböcke des Holzschnittes übernommen,11 ein
Motiv, das wir schon lang vor Dürer auf der gleichnamigen Darstellung des Buxtehuder Altares Meister Bertrams12 finden,
ebenso auf der etwas früheren Geburt Christi in der Weltchronik Rudolfs von Ems.13 Auch für unser Blatt ist Dürer nicht
ohne Einfluß gewesen. Huber fand im Eustachius-Stiche die gespannte Gegenüberstellung von Mensch und Tier in der
charakteristischen Profilansicht11 und die staunend geöffneten, bald zu erfürchtigem Gebete sich schließenden Hände des
Ritters dürften auf ihn den so lang dauernden Eindruck gemacht haben. Auf einer Altdorfer sehr nahestehenden, weiß
gehöhten Zeichnung von 151215 sehen wir links vorn Johannes mit offenem Munde und wie bei Huber überwältigt geöff-
neten Händen, im Mittelgrunde Josef von Arimathia in ähnlicher Haltung; auch auf dem Kreuzigungsholzschnitte Dürers
(B. 55) findet sich diese Handstellung Johannis, ebenso auf den beiden Holzschnitten16 Altdorfers (1514), dem »Opfer
1 Abb. Katalog d. Samml. Kaufmann, Taf. 159; Aufsatz von M. Weinberger, »Wolf Huber., in Kunst f. Alle 1924, Aprilheft; Neuerwerb, d.
österr. Staatsgalerie 1916—18. — 2 z. B. die Ansicht von Traunkirchen (1519). Meder, a. a. O., S. 489. — 3 Hieronymuszeichnung (1512), Wien,
Akademie d. bild. Künste. — i »Die rhythmische Entfaltung der Formbewegung ist die einzige wesentliche Ursache für die Erregung, die vom
ganzen ausgeht.« Hagen, Deutsches Sehen, S. 57. — 5 Erlangen, III. B. 8. Riggenbach, a. a. O., S. 33. Die Georgsfigur wirkt wie eine Erinnerung an
d. Georgszeichnung Altdorfers. Berlin. Abb. in G. J. Wolf, Altdorfer S. 39. — « Lichtbild Braun & Co., Dornach. — T Wolf, a. a. O., S. 28. —
8 Riggenbach a. a. O., S. 41 f., 76. — 9 Dresden 1517. Abb. Dresdner Handzeichnungen 61. — 10 Wien. Fürst Liechtenstein Abb. Albertina 937.
Riggenbach, a. a. 0., S. 37, Anm. 1. — 11 Riggenbach a. a. 0., S. 36. — 12 Abb. bei Burger, Die deutsche Malerei II, S. 425. — 13 1370. Staats-
bibliothek München. Abb. bei H. Brandt, Anfänge der deutschen Landschaftsmalerei, Taf. II. — Meder, a. a. 0., S. 507. — n Vgl. auch den sitzen-
den Hieronymus Dürers von 1512 (B. 113). - 15 Berlin. Deutsche Handzeichnungen im Kupferstichkabinett Berlin. Taf. V, Nr. 4056 - 1« Wolt
a. a. O., Abb. 31 u. 32.
— 4 —