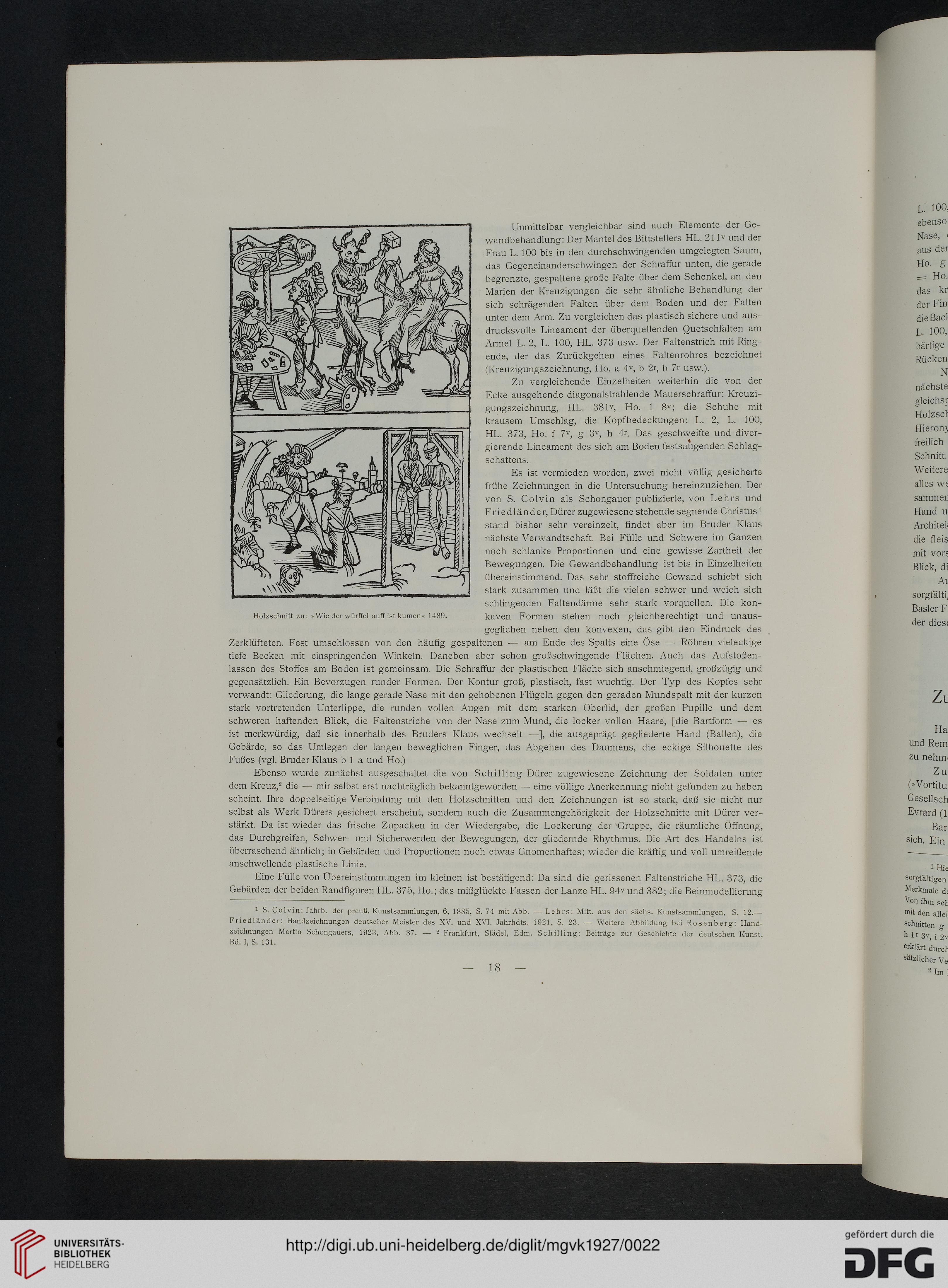Unmittelbar vergleichbar sind auch Elemente der Ge-
wandbehandlung: Der Mantel des Bittstellers HL. 21 lv und der
Frau L. 100 bis in den durchschwingenden umgelegten Saum,
das Gegeneinanderschwingen der Schraffur unten, die gerade
begrenzte, gespaltene große Falte über dem Schenkel, an den
Marien der Kreuzigungen die sehr ähnliche Behandlung der
sich schrägenden Falten über dem Boden und der Falten
unter dem Arm. Zu vergleichen das plastisch sichere und aus-
drucksvolle Lineament der überquellenden Quetschfalten am
Ärmel L. 2, L. 100, HL. 373 usw. Der Faltenstrich mit Ring-
ende, der das Zurückgehen eines Faltenrohres bezeichnet
(Kreuzigungszeichnung, Ho. a 4v, b 2r, b 7r usw.).
Zu vergleichende Einzelheiten weiterhin die von der
Ecke ausgehende diagonalstrahlende Mauerschraffur: Kreuzi-
gungszeichnung, HL. 381v Ho. 1 8v; die Schuhe mit
krausem Umschlag, die Kopfbedeckungen: L. 2, L. 100,
HL. 373, Ho. f 7V, g 3V, h 4r. Das geschweifte und diver-
gierende Lineament des sich am Boden festsaugenden Schlag-
schattens.
Es ist vermieden worden, zwei nicht völlig gesicherte
frühe Zeichnungen in die Untersuchung hereinzuziehen. Der
von S. Colvin als Schongauer publizierte, von Lehrs und
Friedländer, Dürer zugewiesene stehende segnende Christus1
stand bisher sehr vereinzelt, findet aber im Bruder Klaus
nächste Verwandtschaft. Bei Fülle und Schwere im Ganzen
noch schlanke Proportionen und eine gewisse Zartheit der
Bewegungen. Die Gewandbehandlung ist bis in Einzelheiten
übereinstimmend. Das sehr stoffreiche Gewand schiebt sich
stark zusammen und läßt die vielen schwer und weich sich
schlingenden Faltendärme sehr stark vorquellen. Die kon-
kaven Formen stehen noch gleichberechtigt und unaus-
geglichen neben den konvexen, das gibt den Eindruck des
Zerklüfteten. Fest umschlossen von den häufig gespaltenen — am Ende des Spalts eine Öse — Röhren vieleckige
tiefe Becken mit einspringenden Winkeln. Daneben aber schon großschwingende Flächen. Auch das Aufstoßen-
lassen des Stoffes am Boden ist gemeinsam. Die Schraffur der plastischen Fläche sich anschmiegend, großzügig und
gegensätzlich. Ein Bevorzugen runder Formen. Der Kontur groß, plastisch, fast wuchtig. Der Typ des Kopfes sehr
verwandt: Gliederung, die lange gerade Nase mit den gehobenen Flügeln gegen den geraden Mundspalt mit der kurzen
stark vortretenden Unterlippe, die runden vollen Augen mit dem starken Oberlid, der großen Pupille und dem
schweren haftenden Blick, die Faltenstriche von der Nase zum Mund, die locker vollen Haare, [die Bartform — es
ist merkwürdig, daß sie innerhalb des Bruders Klaus wechselt —], die ausgeprägt gegliederte Hand (Ballen), die
Gebärde, so das Umlegen der langen beweglichen Finger, das Abgehen des Daumens, die eckige Silhouette des
Fußes (vgl. Bruder Klaus b 1 a und Ho.)
Ebenso wurde zunächst ausgeschaltet die von Schilling Dürer zugewiesene Zeichnung der Soldaten unter
dem Kreuz,2 die — mir selbst erst nachträglich bekanntgeworden — eine völlige Anerkennung nicht gefunden zu haben
scheint. Ihre doppelseitige Verbindung mit den Holzschnitten und den Zeichnungen ist so stark, daß sie nicht nur
selbst als Werk Dürers gesichert erscheint, sondern auch die Zusammengehörigkeit der Holzschnitte mit Dürer ver-
stärkt. Da ist wieder das frische Zupacken in der Wiedergabe, die Lockerung der Gruppe, die räumliche Öffnung,
das Durchgreifen, Schwer- und Sicherwerden der Bewegungen, der gliedernde Rhythmus. Die Art des Handelns ist
überraschend ähnlich; in Gebärden und Proportionen noch etwas Gnomenhaftes; wieder die kräftig und voll umreißende
anschwellende plastische Linie.
Eine Fülle von Übereinstimmungen im kleinen ist bestätigend: Da sind die gerissenen Faltenstriche HL. 373, die
Gebärden der beiden Randfiguren HL. 375, Ho.; das mißglückte Fassen der Lanze HL. 94v und 382; die Beinmodellierung
1 S. Colvin: Jahrb. der preuß. Kunstsammlungen, 6, 1885, S. 74 mit Abb. — Lehrs: Mitt. aus den sächs. Kunstsammlungen, S. 12.—
Friedländer: Handzeichnungen deutscher Meister des XV. und XVI. Jahrhdts. 1921, S. 23. — Weitere Abbildung bei Rosenberg: Hand-
zeichnungen Martin Schongauers, 1923, Abb. 37. — 2 Frankfurt, Städel, Edm. Schilling: Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst
Bd. I, S. 131.
Holzschnitt zu: »Wie der würffei auff istkumen« 1489.
wandbehandlung: Der Mantel des Bittstellers HL. 21 lv und der
Frau L. 100 bis in den durchschwingenden umgelegten Saum,
das Gegeneinanderschwingen der Schraffur unten, die gerade
begrenzte, gespaltene große Falte über dem Schenkel, an den
Marien der Kreuzigungen die sehr ähnliche Behandlung der
sich schrägenden Falten über dem Boden und der Falten
unter dem Arm. Zu vergleichen das plastisch sichere und aus-
drucksvolle Lineament der überquellenden Quetschfalten am
Ärmel L. 2, L. 100, HL. 373 usw. Der Faltenstrich mit Ring-
ende, der das Zurückgehen eines Faltenrohres bezeichnet
(Kreuzigungszeichnung, Ho. a 4v, b 2r, b 7r usw.).
Zu vergleichende Einzelheiten weiterhin die von der
Ecke ausgehende diagonalstrahlende Mauerschraffur: Kreuzi-
gungszeichnung, HL. 381v Ho. 1 8v; die Schuhe mit
krausem Umschlag, die Kopfbedeckungen: L. 2, L. 100,
HL. 373, Ho. f 7V, g 3V, h 4r. Das geschweifte und diver-
gierende Lineament des sich am Boden festsaugenden Schlag-
schattens.
Es ist vermieden worden, zwei nicht völlig gesicherte
frühe Zeichnungen in die Untersuchung hereinzuziehen. Der
von S. Colvin als Schongauer publizierte, von Lehrs und
Friedländer, Dürer zugewiesene stehende segnende Christus1
stand bisher sehr vereinzelt, findet aber im Bruder Klaus
nächste Verwandtschaft. Bei Fülle und Schwere im Ganzen
noch schlanke Proportionen und eine gewisse Zartheit der
Bewegungen. Die Gewandbehandlung ist bis in Einzelheiten
übereinstimmend. Das sehr stoffreiche Gewand schiebt sich
stark zusammen und läßt die vielen schwer und weich sich
schlingenden Faltendärme sehr stark vorquellen. Die kon-
kaven Formen stehen noch gleichberechtigt und unaus-
geglichen neben den konvexen, das gibt den Eindruck des
Zerklüfteten. Fest umschlossen von den häufig gespaltenen — am Ende des Spalts eine Öse — Röhren vieleckige
tiefe Becken mit einspringenden Winkeln. Daneben aber schon großschwingende Flächen. Auch das Aufstoßen-
lassen des Stoffes am Boden ist gemeinsam. Die Schraffur der plastischen Fläche sich anschmiegend, großzügig und
gegensätzlich. Ein Bevorzugen runder Formen. Der Kontur groß, plastisch, fast wuchtig. Der Typ des Kopfes sehr
verwandt: Gliederung, die lange gerade Nase mit den gehobenen Flügeln gegen den geraden Mundspalt mit der kurzen
stark vortretenden Unterlippe, die runden vollen Augen mit dem starken Oberlid, der großen Pupille und dem
schweren haftenden Blick, die Faltenstriche von der Nase zum Mund, die locker vollen Haare, [die Bartform — es
ist merkwürdig, daß sie innerhalb des Bruders Klaus wechselt —], die ausgeprägt gegliederte Hand (Ballen), die
Gebärde, so das Umlegen der langen beweglichen Finger, das Abgehen des Daumens, die eckige Silhouette des
Fußes (vgl. Bruder Klaus b 1 a und Ho.)
Ebenso wurde zunächst ausgeschaltet die von Schilling Dürer zugewiesene Zeichnung der Soldaten unter
dem Kreuz,2 die — mir selbst erst nachträglich bekanntgeworden — eine völlige Anerkennung nicht gefunden zu haben
scheint. Ihre doppelseitige Verbindung mit den Holzschnitten und den Zeichnungen ist so stark, daß sie nicht nur
selbst als Werk Dürers gesichert erscheint, sondern auch die Zusammengehörigkeit der Holzschnitte mit Dürer ver-
stärkt. Da ist wieder das frische Zupacken in der Wiedergabe, die Lockerung der Gruppe, die räumliche Öffnung,
das Durchgreifen, Schwer- und Sicherwerden der Bewegungen, der gliedernde Rhythmus. Die Art des Handelns ist
überraschend ähnlich; in Gebärden und Proportionen noch etwas Gnomenhaftes; wieder die kräftig und voll umreißende
anschwellende plastische Linie.
Eine Fülle von Übereinstimmungen im kleinen ist bestätigend: Da sind die gerissenen Faltenstriche HL. 373, die
Gebärden der beiden Randfiguren HL. 375, Ho.; das mißglückte Fassen der Lanze HL. 94v und 382; die Beinmodellierung
1 S. Colvin: Jahrb. der preuß. Kunstsammlungen, 6, 1885, S. 74 mit Abb. — Lehrs: Mitt. aus den sächs. Kunstsammlungen, S. 12.—
Friedländer: Handzeichnungen deutscher Meister des XV. und XVI. Jahrhdts. 1921, S. 23. — Weitere Abbildung bei Rosenberg: Hand-
zeichnungen Martin Schongauers, 1923, Abb. 37. — 2 Frankfurt, Städel, Edm. Schilling: Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst
Bd. I, S. 131.
Holzschnitt zu: »Wie der würffei auff istkumen« 1489.