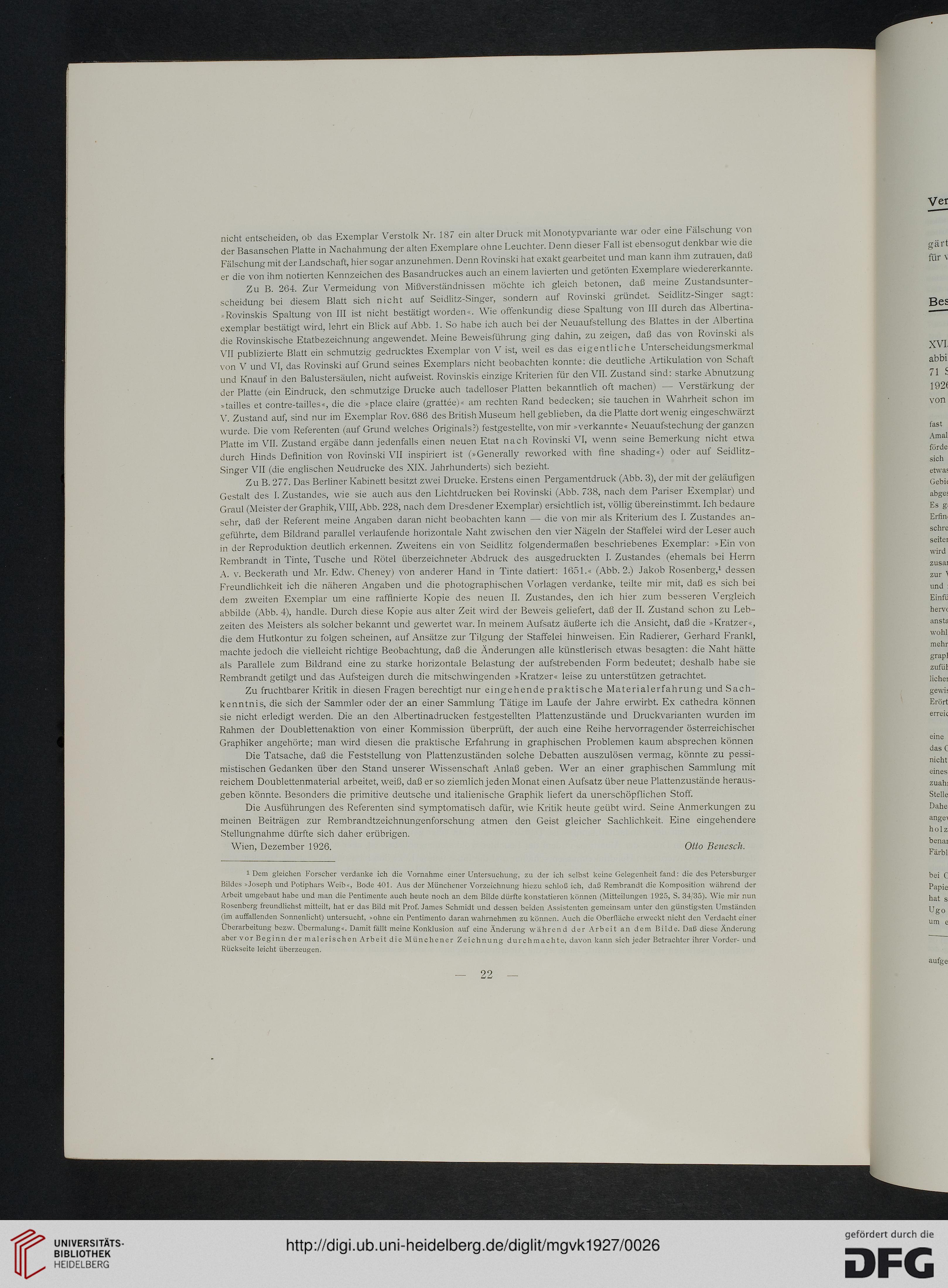nicht entscheiden, ob das Exemplar Verstolk Nr. 187 ein alter Druck mit Monotypvariante war oder eine Fälschung von
der Basanschen Platte in Nachahmung der alten Exemplare ohne Leuchter. Denn dieser Fall ist ebensogut denkbar wie die
Fälschung mit der Landschaft, hier sogar anzunehmen. Denn Rovinski hat exakt gearbeitet und man kann ihm zutrauen, daß
er die von ihm notierten Kennzeichen des Basandruckes auch an einem lavierten und getönten Exemplare wiedererkannte.
Zu B. 264. Zur Vermeidung von Mißverständnissen möchte ich gleich betonen, daß meine Zustandsunter-
scheidung bei diesem Blatt sich" nicht auf Seidlitz-Singer, sondern auf Rovinski gründet. Seidlitz-Singer sagt:
»Rovinskis Spaltung von III ist nicht bestätigt worden«. Wie offenkundig diese Spaltung von III durch das Albertina-
exemplar bestätigt wird, lehrt ein Blick auf Abb. 1. So habe ich auch bei der Neuaufstellung des Blattes in der Albertina
die Rovinskische Etatbezeichnung angewendet. Meine Beweisführung ging dahin, zu zeigen, daß das von Rovinski als
VII publizierte Blatt ein schmutzig gedrucktes Exemplar von V ist, weil es das eigentliche Unterscheidungsmerkmal
von V und VI, das Rovinski auf Grund seines Exemplars nicht beobachten konnte: die deutliche Artikulation von Schaft
und Knauf in den Balustersäulen, nicht aufweist. Rovinskis einzige Kriterien für den VII. Zustand sind: starke Abnutzung
der Platte (ein Eindruck, den schmutzige Drucke auch tadelloser Platten bekanntlich oft machen) — Verstärkung der
»tailles et contre-tailles«, die die »»place claire (grattee)« am rechten Rand bedecken; sie tauchen in Wahrheit schon im
V. Zustand auf, sind nur im Exemplar Rov. 686 des British Museum hell geblieben, da die Platte dort wenig eingeschwärzt
wurde. Die vom Referenten (auf Grund welches Originals?) festgestellte, von mir »verkannte« Neuaufstechung der ganzen
Platte im VII. Zustand ergäbe dann jedenfalls einen neuen Etat nach Rovinski VI, wenn seine Bemerkung nicht etwa
durch Hinds Definition von Rovinski VII inspiriert ist (»Generally revvorked with fine shading«) oder auf Seidlitz-
Singer VII (die englischen Neudrucke des XIX. Jahrhunderts) sich bezieht.
Zu B. 277. Das Berliner Kabinett besitzt zwei Drucke. Erstens einen Pergamentdruck (Abb. 3), der mit der geläufigen
Gestalt des I. Zustandes, wie sie auch aus den Lichtdrucken bei Rovinski (Abb. 738, nach dem Pariser Exemplar) und
Graul (Meister der Graphik, VIII, Abb. 228, nach dem Dresdener Exemplar) ersichtlich ist, völlig übereinstimmt. Ich bedaure
sehr, daß der Referent meine Angaben daran nicht beobachten kann — die von mir als Kriterium des I. Zustandes an-
geführte, dem Bildrand parallel verlaufende horizontale Naht zwischen den vier Nägeln der Staffelei wird der Leser auch
in der Reproduktion deutlich erkennen. Zweitens ein von Seidlitz folgendermaßen beschriebenes Exemplar: »Ein von
Rembrandt in Tinte, Tusche und Rötel überzeichneter Abdruck des ausgedruckten I. Zustandes (ehemals bei Herrn
A. v. Beckerath und Mr. Edw. Cheney) von anderer Hand in Tinte datiert: 1651.« (Abb. 2.) Jakob Rosenberg,1 dessen
Freundlichkeit ich die näheren Angaben und die photographischen Vorlagen verdanke, teilte mir mit, daß es sich bei
dem zweiten Exemplar um eine raffinierte Kopie des neuen II. Zustandes, den ich hier zum besseren Vergleich
abbilde (Abb. 4), handle. Durch diese Kopie aus alter Zeit wird der Beweis geliefert, daß der II. Zustand schon zu Leb-
zeiten des Meisters als solcher bekannt und gewertet war. In meinem Aufsatz äußerte ich die Ansicht, daß die »Kratzer«,
die dem Hutkontur zu folgen scheinen, auf Ansätze zur Tilgung der Staffelei hinweisen. Ein Radierer, Gerhard Frankl,
machte jedoch die vielleicht richtige Beobachtung, daß die Änderungen alle künstlerisch etwas besagten: die Naht hätte
als Parallele zum Bildrand eine zu starke horizontale Belastung der aufstrebenden Form bedeutet; deshalb habe sie
Rembrandt getilgt und das Aufsteigen durch die mitschwingenden »Kratzer« leise zu unterstützen getrachtet.
Zu fruchtbarer Kritik in diesen Fragen berechtigt nur eingehende praktische Materialerfahrung und Sach-
kenntnis, die sich der Sammler oder der an einer Sammlung Tätige im Laufe der Jahre erwirbt. Ex cathedra können
sie nicht erledigt werden. Die an den Albertinadrucken festgestellten Plattenzustände und Druckvarianten wurden im
Rahmen der Doublettenaktion von einer Kommission überprüft, der auch eine Reihe hervorragender österreichischei
Graphiker angehörte; man wird diesen die praktische Erfahrung in graphischen Problemen kaum absprechen können
Die Tatsache, daß die Feststellung von Plattenzuständen solche Debatten auszulösen vermag, könnte zu pessi-
mistischen Gedanken über den Stand unserer Wissenschaft Anlaß geben. Wer an einer graphischen Sammlung mit
reichem Doublettenmaterial arbeitet, weiß, daß er so ziemlich jeden Monat einen Aufsatz über neue Plattenzustände heraus-
geben könnte. Besonders die primitive deutsche und italienische Graphik liefert da unerschöpflichen Stoff.
Die Ausführungen des Referenten sind symptomatisch dafür, wie Kritik heute geübt wird. Seine Anmerkungen zu
meinen Beiträgen zur Rembrandtzeichnungenforschung atmen den Geist gleicher Sachlichkeit. Eine eingehendere
Stellungnahme dürfte sich daher erübrigen.
Wien, Dezember 1926. Otto Benesch.
burticr
1 Dem gleichen Forscher verdanke ich die Vornahme einer Untersuchung, zu der ich selbst keine Gelegenheit fand: die des Petersbu _
Bildes »Joseph und Poöphars Weib«, Bode 401. Aus der Münchener Vorzeichnung hiezu schloß ich, daß Rembrandt die Komposition während der
Arbeit umgebaut habe und man die Pentimente auch heute noch an dem Bilde dürfte konstatieren können (Mitteilungen 1925, S. 34/35). Wie mir nun
Rosenberg freundlichst mitteilt, hat er das Bild mit Prof. James Schmidt und dessen beiden Assistenten gemeinsam unter den günstigsten Umständen
(im auffallenden Sonnenlicht) untersucht, .ohne ein Pentimento daran wahrnehmen zu können. Auch die Oberfläche erweckt nicht den Verdacht einer
Überarbeitung bezw. Übermalung«. Damit fallt meine Konklusion auf eine Änderung während der Arbeit an dem Bilde. Daß diese Änderung
aber vor Beginn der malerischen Arbeit die Münchener Zeichnung durchmachte, davon kann sich jeder Betrachter ihrer Vorder- und
Rückseite leicht überzeugen.
22 —
der Basanschen Platte in Nachahmung der alten Exemplare ohne Leuchter. Denn dieser Fall ist ebensogut denkbar wie die
Fälschung mit der Landschaft, hier sogar anzunehmen. Denn Rovinski hat exakt gearbeitet und man kann ihm zutrauen, daß
er die von ihm notierten Kennzeichen des Basandruckes auch an einem lavierten und getönten Exemplare wiedererkannte.
Zu B. 264. Zur Vermeidung von Mißverständnissen möchte ich gleich betonen, daß meine Zustandsunter-
scheidung bei diesem Blatt sich" nicht auf Seidlitz-Singer, sondern auf Rovinski gründet. Seidlitz-Singer sagt:
»Rovinskis Spaltung von III ist nicht bestätigt worden«. Wie offenkundig diese Spaltung von III durch das Albertina-
exemplar bestätigt wird, lehrt ein Blick auf Abb. 1. So habe ich auch bei der Neuaufstellung des Blattes in der Albertina
die Rovinskische Etatbezeichnung angewendet. Meine Beweisführung ging dahin, zu zeigen, daß das von Rovinski als
VII publizierte Blatt ein schmutzig gedrucktes Exemplar von V ist, weil es das eigentliche Unterscheidungsmerkmal
von V und VI, das Rovinski auf Grund seines Exemplars nicht beobachten konnte: die deutliche Artikulation von Schaft
und Knauf in den Balustersäulen, nicht aufweist. Rovinskis einzige Kriterien für den VII. Zustand sind: starke Abnutzung
der Platte (ein Eindruck, den schmutzige Drucke auch tadelloser Platten bekanntlich oft machen) — Verstärkung der
»tailles et contre-tailles«, die die »»place claire (grattee)« am rechten Rand bedecken; sie tauchen in Wahrheit schon im
V. Zustand auf, sind nur im Exemplar Rov. 686 des British Museum hell geblieben, da die Platte dort wenig eingeschwärzt
wurde. Die vom Referenten (auf Grund welches Originals?) festgestellte, von mir »verkannte« Neuaufstechung der ganzen
Platte im VII. Zustand ergäbe dann jedenfalls einen neuen Etat nach Rovinski VI, wenn seine Bemerkung nicht etwa
durch Hinds Definition von Rovinski VII inspiriert ist (»Generally revvorked with fine shading«) oder auf Seidlitz-
Singer VII (die englischen Neudrucke des XIX. Jahrhunderts) sich bezieht.
Zu B. 277. Das Berliner Kabinett besitzt zwei Drucke. Erstens einen Pergamentdruck (Abb. 3), der mit der geläufigen
Gestalt des I. Zustandes, wie sie auch aus den Lichtdrucken bei Rovinski (Abb. 738, nach dem Pariser Exemplar) und
Graul (Meister der Graphik, VIII, Abb. 228, nach dem Dresdener Exemplar) ersichtlich ist, völlig übereinstimmt. Ich bedaure
sehr, daß der Referent meine Angaben daran nicht beobachten kann — die von mir als Kriterium des I. Zustandes an-
geführte, dem Bildrand parallel verlaufende horizontale Naht zwischen den vier Nägeln der Staffelei wird der Leser auch
in der Reproduktion deutlich erkennen. Zweitens ein von Seidlitz folgendermaßen beschriebenes Exemplar: »Ein von
Rembrandt in Tinte, Tusche und Rötel überzeichneter Abdruck des ausgedruckten I. Zustandes (ehemals bei Herrn
A. v. Beckerath und Mr. Edw. Cheney) von anderer Hand in Tinte datiert: 1651.« (Abb. 2.) Jakob Rosenberg,1 dessen
Freundlichkeit ich die näheren Angaben und die photographischen Vorlagen verdanke, teilte mir mit, daß es sich bei
dem zweiten Exemplar um eine raffinierte Kopie des neuen II. Zustandes, den ich hier zum besseren Vergleich
abbilde (Abb. 4), handle. Durch diese Kopie aus alter Zeit wird der Beweis geliefert, daß der II. Zustand schon zu Leb-
zeiten des Meisters als solcher bekannt und gewertet war. In meinem Aufsatz äußerte ich die Ansicht, daß die »Kratzer«,
die dem Hutkontur zu folgen scheinen, auf Ansätze zur Tilgung der Staffelei hinweisen. Ein Radierer, Gerhard Frankl,
machte jedoch die vielleicht richtige Beobachtung, daß die Änderungen alle künstlerisch etwas besagten: die Naht hätte
als Parallele zum Bildrand eine zu starke horizontale Belastung der aufstrebenden Form bedeutet; deshalb habe sie
Rembrandt getilgt und das Aufsteigen durch die mitschwingenden »Kratzer« leise zu unterstützen getrachtet.
Zu fruchtbarer Kritik in diesen Fragen berechtigt nur eingehende praktische Materialerfahrung und Sach-
kenntnis, die sich der Sammler oder der an einer Sammlung Tätige im Laufe der Jahre erwirbt. Ex cathedra können
sie nicht erledigt werden. Die an den Albertinadrucken festgestellten Plattenzustände und Druckvarianten wurden im
Rahmen der Doublettenaktion von einer Kommission überprüft, der auch eine Reihe hervorragender österreichischei
Graphiker angehörte; man wird diesen die praktische Erfahrung in graphischen Problemen kaum absprechen können
Die Tatsache, daß die Feststellung von Plattenzuständen solche Debatten auszulösen vermag, könnte zu pessi-
mistischen Gedanken über den Stand unserer Wissenschaft Anlaß geben. Wer an einer graphischen Sammlung mit
reichem Doublettenmaterial arbeitet, weiß, daß er so ziemlich jeden Monat einen Aufsatz über neue Plattenzustände heraus-
geben könnte. Besonders die primitive deutsche und italienische Graphik liefert da unerschöpflichen Stoff.
Die Ausführungen des Referenten sind symptomatisch dafür, wie Kritik heute geübt wird. Seine Anmerkungen zu
meinen Beiträgen zur Rembrandtzeichnungenforschung atmen den Geist gleicher Sachlichkeit. Eine eingehendere
Stellungnahme dürfte sich daher erübrigen.
Wien, Dezember 1926. Otto Benesch.
burticr
1 Dem gleichen Forscher verdanke ich die Vornahme einer Untersuchung, zu der ich selbst keine Gelegenheit fand: die des Petersbu _
Bildes »Joseph und Poöphars Weib«, Bode 401. Aus der Münchener Vorzeichnung hiezu schloß ich, daß Rembrandt die Komposition während der
Arbeit umgebaut habe und man die Pentimente auch heute noch an dem Bilde dürfte konstatieren können (Mitteilungen 1925, S. 34/35). Wie mir nun
Rosenberg freundlichst mitteilt, hat er das Bild mit Prof. James Schmidt und dessen beiden Assistenten gemeinsam unter den günstigsten Umständen
(im auffallenden Sonnenlicht) untersucht, .ohne ein Pentimento daran wahrnehmen zu können. Auch die Oberfläche erweckt nicht den Verdacht einer
Überarbeitung bezw. Übermalung«. Damit fallt meine Konklusion auf eine Änderung während der Arbeit an dem Bilde. Daß diese Änderung
aber vor Beginn der malerischen Arbeit die Münchener Zeichnung durchmachte, davon kann sich jeder Betrachter ihrer Vorder- und
Rückseite leicht überzeugen.
22 —