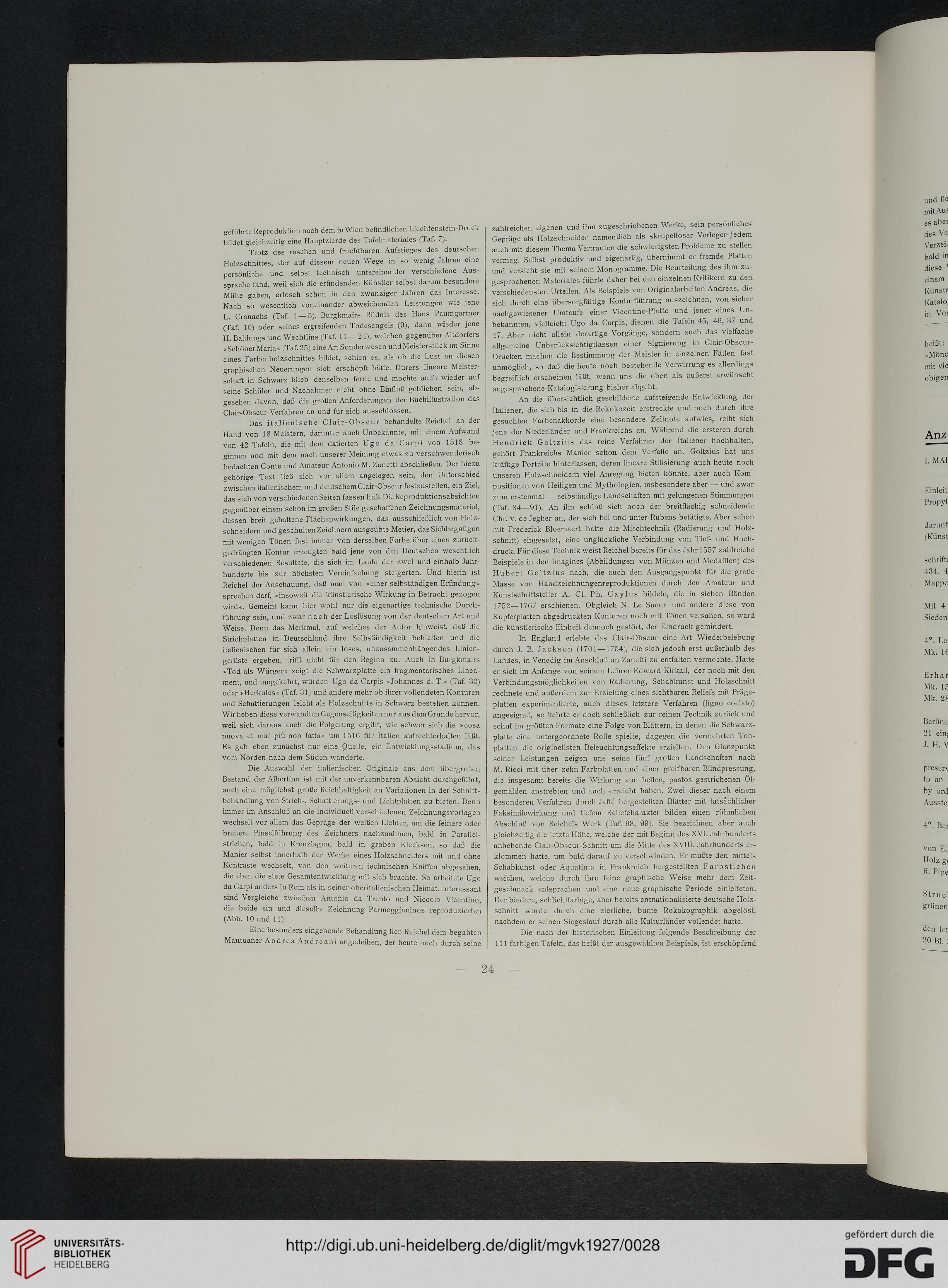geführte Reproduktion nach dem in Wien befindlichen Liechtenstein-Druck
bildet gleichzeitig eine Hauptzierde des Tafelmatcriales (Taf. 7).
Trotz des raschen und fruchtbaren Aufstieges des deutschen
Holzschnittes, der auf diesem neuen Wege in so wenig Jahren eine
persönliche und selbst technisch untereinander verschiedene Aus-
sprache fand, weil sich die erfindenden Künstler selbst darum besondere
Mühe gaben, erlosch schon in den zwanziger Jahren das Interesse.
Nach so wesentlich voneinander abweichenden Leistungen wie jene
L. Cranachs (Taf. 1—5). Burgkmairs Bildnis des Hans Paumgartner
(Taf. 10) oder seines ergreifenden Todesengcls (9), dann wieder jene
H. Baidungs und Wechtlins (Taf. 11 — 24), welchen gegenüber Altdorfers
»SchönerMaria« (Tat 25) eine Art Sonderwesen und Meisterstück im Sinne
eines Farbenholzschnittes bildet, schien es, als ob die Lust an diesen
graphischen Neuerungen sich erschöpft hätte. Dürers lineare Meister-
schaft in Schwarz blieb denselben ferne und mochte auch wieder auf
seine Schüler und Nachahmer nicht ohne Einfluß geblieben sein, ab-
gesehen davon, daß die großen Anforderungen der Buchillustration das
Clair-Obscur-Verfahren an und für sich ausschlössen.
Das italienische Clair-Obscur behandelte Reichel an der
Hand von 18 Meistern, darunter auch Unbekannte, mit einem Aufwand
von 42 Tafeln, die mit dem datierten Ugo da Carpi von 1518 be-
ginnen und mit dem nach unserer Meinung etwas zu verschwenderisch
bedachten Conte und Amateur Antonio M. Zanetti abschließen. Der hiezu
gehörige Text ließ sich vor allem angelegen sein, den Unterschied
zwischen italienischem und deutschem Clair-Obscur festzustellen, ein Ziel,
das sich von verschiedenen Seiten fassen ließ. Die Reproduktionsabsichten
gegenüber einem schon im großen Stile geschaffenen Zeichnungsmaterial,
dessen breit gehaltene Flächenwirkungen, das ausschließlich von Holz-
schneidern und geschuItenZeichnern ausgeübte Metier, das Sichbegnügen
mit wenigen Tönen fast immer von derselben Farbe über einen zurück-
gedrängten Kontur erzeugten bald jene von den Deutschen wesentlich
verschiedenen Resultate, die sich im Laufe der zwei und einhalb Jahr-
hunderte bis zur höchsten Vereinfachung steigerten. Und hierin ist
Reichel der Anschauung, daß man von »einer selbständigen Erfindung«
sprechen darf, »insoweit die künstlerische Wirkung in Betracht gezogen
wird«. Gemeint kann hier wohl nur die eigenartige technische Durch-
führung sein, und zwar nach der Loslösung von der deutschen Art und
Weise. Denn das Merkmal, auf welches der Autor hinweist, daß die
Strichplatten in Deutschland ihre Selbständigkeit behielten und die
italienischen für sich allein ein loses, unzusammenhängendes Linien-
gerüste ergeben, trifft nicht für den Beginn zu. Auch in Burgkmairs
»Tod als Würger« zeigt die Schwarzplatte ein fragmentarisches Linea-
ment, und umgekehrt, würden Ugo da Caipis »Johannes d. T.« (Taf. 30)
oder »Herkules« (Taf. 31) und andere mehr ob ihrer vollendeten Konturen
und Schattierungen leicht als Holzschnitte in Schwarz bestehen können.
Wir heben diese verwandten Gegenseitigkeiten nur aus dem Grunde hervor,
weil sich daraus auch die Folgerung ergibt, wie schwer sich die »cosa
nuova et mai piü non fatta* um 1516 für Italien aufrechterhalten läßt.
Es gab eben zunächst nur eine Quelle, ein Entwicklungsstadium, das
vom Norden nach dem Süden wanderte.
Die Auswahl der italienischen Originale aus dem übergroßen
Bestand der Albertina ist mit der unverkennbaren Absicht durchgeführt,
auch eine möglichst große Reichhaltigkeit an Variationen in der Schnitt-
behandlung von Strich-, Schattierungs- und Lichtplatten zu bieten. Denn
immer im Anschluß an die individuell verschiedenen Zeichnungsvorlagen
wechselt vor allem das Gepräge der weißen Lichter, um die feinere oder
breitere Pinselführung des Zeichners nachzuahmen, bald in Parallel-
strichen, bald in Kreuzlagen, bald in groben Klecksen, so daß die
Manier selbst innerhalb der Werke eines Holzschneiders mit und ohne
Kontraste wechselt, von den weiteren technischen Kniffen abgesehen,
die eben die stete Gesamtentwicklung mit sich brachte. So arbeitete U"o
da Carpi anders in Rom als in seiner oberitalienischen Heimat. Interessant
sind Vergleiche zwischen Antonio da Trento und Niccolo Vicentino,
die beide ein und dieselbe Zeichnung Parmeggianinos reproduzierten
(Abb. 10 und 11).
Eine besonders eingehende Behandlung ließ Reichel dem begabten
Mantuaner Andrea Andreani angedeihen, der heute noch durch seine
zahlreichen eigenen und ihm zugeschriebenen Werke, sein persönliches
Gepräge als Holzschneider namentlich als skrupelloser Verleger jedem
auch mit diesem Thema Vertrauten die schwierigsten Probleme zu stellen
vermag. Selbst produktiv und eigenartig, übernimmt er fremde Platten
und versieht sie mit seinem Monogramme. Die Beurteilung des ihm zu-
gesprochenen Materiales führte daher bei den einzelnen Kritikern zu den
verschiedensten Urteilen. Als Beispiele von Originalarbeiten Andreas, die
sich durch eine übersorgfältige Konturführung auszeichnen, von sicher
nachgewiesener Umtaufe einer Vicentino-Platte und jener eines Un-
bekannten, vielleicht Ugo da Carpis, dienen die Tafeln 45, 46, 37 und
47. Aber nicht allein derartige Vorgänge, sondern auch das vielfache
allgemeine Unberücksichtigtlassen einer Signierung in Clair-Obscui-
Drucken machen die Bestimmung der Meister in einzelnen Fällen fast
unmöglich, so daß die heute noch bestehende Verwirrung es allerdings
begreiflich erscheinen läßt, wenn uns die oben als äußerst erwünscht
angesprochene Katalogisierung bisher abgeht.
An die übersichtlich geschilderte aufsteigende Entwicklung der
Italiener, die sich bis in die Rokokozeit ei streckte und noch durch ihre
gesuchten Farbenakkorde eine besondere Zeitnote aufwies, reiht sich
jene der Niederländer und Frankreichs an. Während die ersteren durch
Hendrick Goltzius das reine Verfahren der Italiener hochhalten,
gehört Frankreichs Manier schon dem Verfalle an. Goltzius hat uns
kräftige Porträte hinterlassen, deren lineare Stilisierung auch heute noch
unseren Holzschneidern viel Anregung bieten könnte, aber auch Kom-
positionen von Heiligen und Mythologien, insbesondere aber ■— und zwar
zum erstenmal — selbständige Landschaften mit gelungenen Stimmungen
(Taf. 84—91). An ihn schloß sich noch der breitflächig schneidende
Chr. v. de Jegher an, der sich bei und unter Rubens betätigte. Aber schon
mit Frederick Bloemaert hatte die Mischtechnik (Radierung und Holz-
schnitt) eingesetzt, eine unglückliche Verbindung von Tief- und Hoch-
druck. Für diese Technik weist Reichel bereits für das Jahr 1557 zahlreiche
Beispiele in den Imagines (Abbildungen von Münzen und Medaillen) des
Hubert Goltzius nach, die auch den Ausgangspunkt für die große
Masse von Handzeichnungenreproduktionen durch den Amateur und
Kunstschriftsteller A. Cl. Ph. Caylus bildete, die in sieben Bänden
1752—1767 erschienen. Obgleich N. Le Sueur und andere diese von
Kupferplatten abgedruckten Konturen noch mit Tönen versahen, so ward
die künstlerische Einheit dennoch gestört, der Eindruck gemindert.
In England erlebte das Clair-Obscur eine Art Wiederbelebung
durch J. B. Jackson (1701 —1754), die sich jedoch erst außerhalb des
Landes, in Venedig im Anschluß an Zanetti zu entfalten vermochte. Hatte
er sich im Anfange von seinem Lehrer Edward Kirkall, der noch mit den
Verbindungsmöglichkeiten von Radierung, Schabkunst und Holzschnitt
rechnete und außerdem zur Erzielung eines sichtbaren Reliefs mit Präge-
platten experimentierte, auch dieses letztere Verfahren (ligno coelato)
angeeignet, so kehrte er doch schließlich zur reinen Technik zurück und
schuf im größten Formate eine Folge von Blättern, in denen die Schwarz-
platte eine untergeordnete Rolle spielte, dagegen die vermehrten Ton-
platten die originellsten Beleuchtungseffekte erzielten. Den Glanzpunkt
seiner Leistungen zeigen uns seine fünf großen Landschaften nach
M. Ricci mit über zehn Farbplatten und einer greifbaren Blindpressung,
die insgesamt bereits die Wirkung von hellen, pastos gestrichenen Öl-
gemälden anstrebten und auch erreicht haben. Zwei dieser nach einem
besonderen Verfahren durch Jaffe hergestellten Blätter mit tatsachlicher
Faksimilewirkung und tiefem Reliefcharakter bilden einen rühmlichen
Abschluß von Reichels Werk (Taf. 98, 99). Sie bezeichnen aber auch
gleichzeitig die letzte Höhe, welche der mit Beginn des XVI. Jahrhunderts
anhebende Clair-Obscur-Schnitt um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts er-
klommen hatte, um bald darauf zu verschwinden. Er mußte den mittels
Schabkunst oder Aquatinta in Frankreich hergestellten Farbstichen
weichen, welche durch ihre feine graphische Weise mehr dem Zeit-
geschmack entsprachen und eine neue graphische Periode einleiteten.
Der biedere, schlichtfarbige, aber bereits entnationalisierte deutsche Holz-
schnitt wurde durch eine zierliche, bunte Rokokographik abgelöst,
nachdem er seinen Siegeslauf durch alle Kulturländer vollendet hatte.
Die nach der historischen Einleitung folgende Beschreibung der
111 farbigen Tafeln, das heißt der ausgewählten Beispiele, ist erschöpfend
— 24 —
bildet gleichzeitig eine Hauptzierde des Tafelmatcriales (Taf. 7).
Trotz des raschen und fruchtbaren Aufstieges des deutschen
Holzschnittes, der auf diesem neuen Wege in so wenig Jahren eine
persönliche und selbst technisch untereinander verschiedene Aus-
sprache fand, weil sich die erfindenden Künstler selbst darum besondere
Mühe gaben, erlosch schon in den zwanziger Jahren das Interesse.
Nach so wesentlich voneinander abweichenden Leistungen wie jene
L. Cranachs (Taf. 1—5). Burgkmairs Bildnis des Hans Paumgartner
(Taf. 10) oder seines ergreifenden Todesengcls (9), dann wieder jene
H. Baidungs und Wechtlins (Taf. 11 — 24), welchen gegenüber Altdorfers
»SchönerMaria« (Tat 25) eine Art Sonderwesen und Meisterstück im Sinne
eines Farbenholzschnittes bildet, schien es, als ob die Lust an diesen
graphischen Neuerungen sich erschöpft hätte. Dürers lineare Meister-
schaft in Schwarz blieb denselben ferne und mochte auch wieder auf
seine Schüler und Nachahmer nicht ohne Einfluß geblieben sein, ab-
gesehen davon, daß die großen Anforderungen der Buchillustration das
Clair-Obscur-Verfahren an und für sich ausschlössen.
Das italienische Clair-Obscur behandelte Reichel an der
Hand von 18 Meistern, darunter auch Unbekannte, mit einem Aufwand
von 42 Tafeln, die mit dem datierten Ugo da Carpi von 1518 be-
ginnen und mit dem nach unserer Meinung etwas zu verschwenderisch
bedachten Conte und Amateur Antonio M. Zanetti abschließen. Der hiezu
gehörige Text ließ sich vor allem angelegen sein, den Unterschied
zwischen italienischem und deutschem Clair-Obscur festzustellen, ein Ziel,
das sich von verschiedenen Seiten fassen ließ. Die Reproduktionsabsichten
gegenüber einem schon im großen Stile geschaffenen Zeichnungsmaterial,
dessen breit gehaltene Flächenwirkungen, das ausschließlich von Holz-
schneidern und geschuItenZeichnern ausgeübte Metier, das Sichbegnügen
mit wenigen Tönen fast immer von derselben Farbe über einen zurück-
gedrängten Kontur erzeugten bald jene von den Deutschen wesentlich
verschiedenen Resultate, die sich im Laufe der zwei und einhalb Jahr-
hunderte bis zur höchsten Vereinfachung steigerten. Und hierin ist
Reichel der Anschauung, daß man von »einer selbständigen Erfindung«
sprechen darf, »insoweit die künstlerische Wirkung in Betracht gezogen
wird«. Gemeint kann hier wohl nur die eigenartige technische Durch-
führung sein, und zwar nach der Loslösung von der deutschen Art und
Weise. Denn das Merkmal, auf welches der Autor hinweist, daß die
Strichplatten in Deutschland ihre Selbständigkeit behielten und die
italienischen für sich allein ein loses, unzusammenhängendes Linien-
gerüste ergeben, trifft nicht für den Beginn zu. Auch in Burgkmairs
»Tod als Würger« zeigt die Schwarzplatte ein fragmentarisches Linea-
ment, und umgekehrt, würden Ugo da Caipis »Johannes d. T.« (Taf. 30)
oder »Herkules« (Taf. 31) und andere mehr ob ihrer vollendeten Konturen
und Schattierungen leicht als Holzschnitte in Schwarz bestehen können.
Wir heben diese verwandten Gegenseitigkeiten nur aus dem Grunde hervor,
weil sich daraus auch die Folgerung ergibt, wie schwer sich die »cosa
nuova et mai piü non fatta* um 1516 für Italien aufrechterhalten läßt.
Es gab eben zunächst nur eine Quelle, ein Entwicklungsstadium, das
vom Norden nach dem Süden wanderte.
Die Auswahl der italienischen Originale aus dem übergroßen
Bestand der Albertina ist mit der unverkennbaren Absicht durchgeführt,
auch eine möglichst große Reichhaltigkeit an Variationen in der Schnitt-
behandlung von Strich-, Schattierungs- und Lichtplatten zu bieten. Denn
immer im Anschluß an die individuell verschiedenen Zeichnungsvorlagen
wechselt vor allem das Gepräge der weißen Lichter, um die feinere oder
breitere Pinselführung des Zeichners nachzuahmen, bald in Parallel-
strichen, bald in Kreuzlagen, bald in groben Klecksen, so daß die
Manier selbst innerhalb der Werke eines Holzschneiders mit und ohne
Kontraste wechselt, von den weiteren technischen Kniffen abgesehen,
die eben die stete Gesamtentwicklung mit sich brachte. So arbeitete U"o
da Carpi anders in Rom als in seiner oberitalienischen Heimat. Interessant
sind Vergleiche zwischen Antonio da Trento und Niccolo Vicentino,
die beide ein und dieselbe Zeichnung Parmeggianinos reproduzierten
(Abb. 10 und 11).
Eine besonders eingehende Behandlung ließ Reichel dem begabten
Mantuaner Andrea Andreani angedeihen, der heute noch durch seine
zahlreichen eigenen und ihm zugeschriebenen Werke, sein persönliches
Gepräge als Holzschneider namentlich als skrupelloser Verleger jedem
auch mit diesem Thema Vertrauten die schwierigsten Probleme zu stellen
vermag. Selbst produktiv und eigenartig, übernimmt er fremde Platten
und versieht sie mit seinem Monogramme. Die Beurteilung des ihm zu-
gesprochenen Materiales führte daher bei den einzelnen Kritikern zu den
verschiedensten Urteilen. Als Beispiele von Originalarbeiten Andreas, die
sich durch eine übersorgfältige Konturführung auszeichnen, von sicher
nachgewiesener Umtaufe einer Vicentino-Platte und jener eines Un-
bekannten, vielleicht Ugo da Carpis, dienen die Tafeln 45, 46, 37 und
47. Aber nicht allein derartige Vorgänge, sondern auch das vielfache
allgemeine Unberücksichtigtlassen einer Signierung in Clair-Obscui-
Drucken machen die Bestimmung der Meister in einzelnen Fällen fast
unmöglich, so daß die heute noch bestehende Verwirrung es allerdings
begreiflich erscheinen läßt, wenn uns die oben als äußerst erwünscht
angesprochene Katalogisierung bisher abgeht.
An die übersichtlich geschilderte aufsteigende Entwicklung der
Italiener, die sich bis in die Rokokozeit ei streckte und noch durch ihre
gesuchten Farbenakkorde eine besondere Zeitnote aufwies, reiht sich
jene der Niederländer und Frankreichs an. Während die ersteren durch
Hendrick Goltzius das reine Verfahren der Italiener hochhalten,
gehört Frankreichs Manier schon dem Verfalle an. Goltzius hat uns
kräftige Porträte hinterlassen, deren lineare Stilisierung auch heute noch
unseren Holzschneidern viel Anregung bieten könnte, aber auch Kom-
positionen von Heiligen und Mythologien, insbesondere aber ■— und zwar
zum erstenmal — selbständige Landschaften mit gelungenen Stimmungen
(Taf. 84—91). An ihn schloß sich noch der breitflächig schneidende
Chr. v. de Jegher an, der sich bei und unter Rubens betätigte. Aber schon
mit Frederick Bloemaert hatte die Mischtechnik (Radierung und Holz-
schnitt) eingesetzt, eine unglückliche Verbindung von Tief- und Hoch-
druck. Für diese Technik weist Reichel bereits für das Jahr 1557 zahlreiche
Beispiele in den Imagines (Abbildungen von Münzen und Medaillen) des
Hubert Goltzius nach, die auch den Ausgangspunkt für die große
Masse von Handzeichnungenreproduktionen durch den Amateur und
Kunstschriftsteller A. Cl. Ph. Caylus bildete, die in sieben Bänden
1752—1767 erschienen. Obgleich N. Le Sueur und andere diese von
Kupferplatten abgedruckten Konturen noch mit Tönen versahen, so ward
die künstlerische Einheit dennoch gestört, der Eindruck gemindert.
In England erlebte das Clair-Obscur eine Art Wiederbelebung
durch J. B. Jackson (1701 —1754), die sich jedoch erst außerhalb des
Landes, in Venedig im Anschluß an Zanetti zu entfalten vermochte. Hatte
er sich im Anfange von seinem Lehrer Edward Kirkall, der noch mit den
Verbindungsmöglichkeiten von Radierung, Schabkunst und Holzschnitt
rechnete und außerdem zur Erzielung eines sichtbaren Reliefs mit Präge-
platten experimentierte, auch dieses letztere Verfahren (ligno coelato)
angeeignet, so kehrte er doch schließlich zur reinen Technik zurück und
schuf im größten Formate eine Folge von Blättern, in denen die Schwarz-
platte eine untergeordnete Rolle spielte, dagegen die vermehrten Ton-
platten die originellsten Beleuchtungseffekte erzielten. Den Glanzpunkt
seiner Leistungen zeigen uns seine fünf großen Landschaften nach
M. Ricci mit über zehn Farbplatten und einer greifbaren Blindpressung,
die insgesamt bereits die Wirkung von hellen, pastos gestrichenen Öl-
gemälden anstrebten und auch erreicht haben. Zwei dieser nach einem
besonderen Verfahren durch Jaffe hergestellten Blätter mit tatsachlicher
Faksimilewirkung und tiefem Reliefcharakter bilden einen rühmlichen
Abschluß von Reichels Werk (Taf. 98, 99). Sie bezeichnen aber auch
gleichzeitig die letzte Höhe, welche der mit Beginn des XVI. Jahrhunderts
anhebende Clair-Obscur-Schnitt um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts er-
klommen hatte, um bald darauf zu verschwinden. Er mußte den mittels
Schabkunst oder Aquatinta in Frankreich hergestellten Farbstichen
weichen, welche durch ihre feine graphische Weise mehr dem Zeit-
geschmack entsprachen und eine neue graphische Periode einleiteten.
Der biedere, schlichtfarbige, aber bereits entnationalisierte deutsche Holz-
schnitt wurde durch eine zierliche, bunte Rokokographik abgelöst,
nachdem er seinen Siegeslauf durch alle Kulturländer vollendet hatte.
Die nach der historischen Einleitung folgende Beschreibung der
111 farbigen Tafeln, das heißt der ausgewählten Beispiele, ist erschöpfend
— 24 —